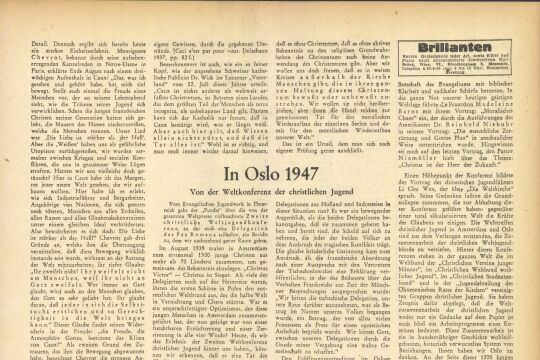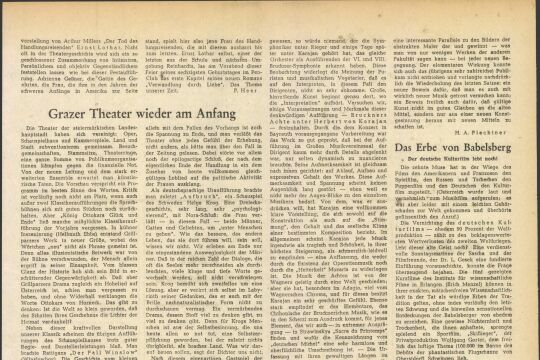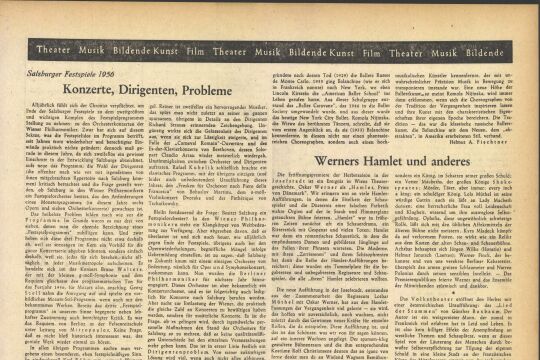Der Dirigent Franz Welser-Möst beim Forum Sacré CSur im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern über Popmusik, Liturgie und die Besonderheiten des Ohrs.
Stört es Sie, dass heute der Trend mehr in Richtung Popmusik geht?
Franz Welser-Möst: Dem muss ich heftig widersprechen, das stimmt einfach nicht. Es wird immer die große "Klassikkrise" herbeigeredet und -geschrieben. Klassische Musik war immer ein Minderheitenprogramm - und das macht auch gar nichts. Man kann und soll niemandem seinen Geschmack vorschreiben, man kann Leuten nur bei der Geschmacksbildung helfen. Ich selber habe auch gar nichts gegen Popmusik. Ich werde oft gefragt, was ich zuhause für Musik höre; meine Antwort ist: nichts. Jemand, der den ganzen Tag im OP steht, wird sich zuhause auch keine Videos von Operationen anschauen. Das hat auch physische Gründe: ich muss ganz einfach von Zeit zu Zeit meine Ohren entlasten. Trotzdem bekomme ich manches an Popmusik mit - meine Frau hört immer den Verkehrsfunk, weil sie begeistert ist, wenn andere Leute im Stau stecken - und manches gefällt mir, anderes nicht. Popkultur hat es im übrigen immer gegeben. Die Tanzmusik der Renaissance war auch nichts anderes. Diese Bereiche bestehen nebeneinander, und es gibt keinen Grund, sie gegeneinander auszuspielen.
Von vielen wird die Musik, die in den Gottesdiensten zu hören ist, als eher langweilig empfunden. Glauben Sie, dass man mit "schwungvollerer" Musik mehr Leute in die Kirchen locken könnte?
Welser-Möst: Ich glaube, wir müssen uns da ein wenig mit dem Begriff "Tradition" beschäftigen. Tradition heißt nicht einfach "konservieren", sondern "weitertragen". Es geht um die Frage, woher Menschen im Ritus, im Gottesdienst ihre Emotionen nehmen. Ich bin ja selbst mit der Kirchenmusik groß geworden, und das hieß vor allem Haydn-, Mozart- und Schubert-Messen. Ich liebe diese Stücke, aber das lässt sich nicht generalisieren. Musik in der Liturgie dient primär der spirituellen Vertiefung; welche Musik das am besten leistet, lässt sich nicht so einfach sagen. Ich bin mit sechs Jahren Ministrant geworden, habe dann acht Jahre lang ministriert und dabei - ohne es freilich inhaltlich genau zu verstehen - sehr hautnah mitbekommen, wie sich das II. Vaticanum auf die Liturgie ausgewirkt hat: also auch, wie plötzlich sogenannte Popmusik in die Kirchen gekommen ist, und wie das viel Zustimmung aber auch viel Ablehnung ausgelöst hat. Ich denke aber, es hat nicht dazu geführt, dass mehr Leute in die Kirche gegangen sind.
Es scheint, als ob Kirche, Liturgie für zeitgenössische Komponisten keine Herausforderung mehr darstellten - im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten. Stimmt dieser Eindruck?
Welser-Möst: Das muss man ein wenig zurechtrücken. Schauen Sie sich einmal an, was wir heute im Konzertrepertoire an geistlichen Werken haben: Mozart-Requiem, Brahms-Requiem, Verdi-Requiem - das sind einsame Höhepunkte. Ich habe das ja selbst erlebt, was da alles aus diversen Archiven von Klöstern in Oberösterreich ausgegraben wurde. Der überwiegende Teil der Kirchenmusik ist ganz einfach Gebrauchsmusik. Auch ein Herr Mozart hat ja zunächst einmal komponiert, um Geld zu verdienen, und nicht aus der großen Inspiration heraus. Natürlich gibt es von ihm Kirchenmusik, die unglaublich inspiriert ist; aber es ist nicht so, dass Musik, die für den sakralen Raum komponiert wurde, per se von besonderer Tiefe ist. Dass es kaum zeitgenössische Kirchenmusik gibt, hat auch mit der Entwicklung seit 1968 zu tun, dass sich vieles von tradierten Formen wegbewegt hat und viele Komponisten mit der Form einer Messe nichts mehr anfangen können. Es gibt aber sehr wohl Künstler, denken Sie an Krzysztof Penderecki oder Arvo Pärt, die zwar nicht für eine katholische Liturgie schreiben, aber dennoch von einer christlichen Mystik inspiriert sind.
Warum gibt es so wenige weibliche Dirigenten?
Welser-Möst: Also, den Zölibat und ähnliches hat es in der klassischen Musik nicht gegeben ... Das hat schlicht mit geschichtlichen Entwicklungen zu tun. Man sieht es auch bei den Orchestern. Ich probe derzeit mit einem Orchester (Wiener Philharmoniker; Anm.), in dem noch immer sehr wenige Damen sitzen. In meiner Zeit als Chefdirigent an der Züricher Oper wurden mehr als 30 Stellen neu besetzt - und 75 Prozent waren Frauen. Nicht weil sie Frauen waren, sondern weil sie ganz einfach beim Probespiel besser gespielt haben. Auch bei den Dirigenten werden sich die Dinge weiter entwickeln, das braucht noch Zeit. Auf lange Sicht wird Qualität zählen, sonst nichts.
Klassische Musik hat viel mit Tradition zu tun. Würden Sie sich selbst als traditionsbewussten Menschen bezeichnen?
Welser-Möst: Absolut. Aber nur, wenn man es so versteht, wie ich vorhin angedeutet habe: Tradition ist eine Bewegung, nicht Stillstand. Ich kann nicht verleugnen, woher ich komme, kann meine Wurzeln nicht abschneiden. Wir haben es auch in der Musik mit bestimmten Naturgegebenheiten zu tun. Es gibt einfach eine Tonleiter, es gibt eine Oktave - das lässt sich nicht leugnen. Das führt zurück bis zu den alten Griechen, wo Musik übrigens als Wissenschaft verstanden wurde, was ich sehr interessant finde. Johannes Kepler mit seinen "Harmonices Mundi" ist hier auch zu nennen, der sich selbst als Musiker und Astronom bezeichnet hat. Und noch etwas ist für mich faszinierend: Wenn ein Mensch stirbt, so ist das letzte Organ, das abstirbt, das Ohr. Das Ohr ist nach wie vor medizinisch wenig erforscht, da stehen wir noch vor großen Rätseln. Bemerkenswert scheint mir überdies, dass es der Sitz unseres Gleich-Gewichts ist. Das Ohr hört sich auch Dinge zurecht - jenseits der naturwissenschaftlich überprüfbaren Fakten: So können Dirigenten oder Orchestermusiker Lautstärken ertragen, die größer sind, als die eines Presslufthammers. Das Ohr unterscheidet also sehr genau zwischen Lärm und Musik. Sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und sie anzuerkennen, das hat meines Erachtens auch sehr viel mit Tradition zu tun.
Bei Ihrem Festvortrag anlässlich der Eröffnung der vier neuen Säle im Wiener Musikverein haben Sie gesagt: "Erklären Sie einem Schüler heute, wer Sarastro ist und warum er im Smoking auf einem Motorrad auf die Bühne fahren muss". Wie würden Sie es erklären?
Welser-Möst: Kunst muss fähig sein, auf innere Bedürfnisse des Menschen zu antworten. Wenn Sie mit einer gewissen Vorbildung in eine Aufführung etwa der "Zauberflöte" hineingehen, so werden Sie bestimmte Überhöhungen oder Verfremdungen nachvollziehen können. Nun sind aber im Gefolge der 68er-Bewegung Selbstverständlichkeiten in der klassischen Bildung nicht mehr so gegeben. Ich sage das ganz wertfrei - aber man muss es sehen. Es hat eine starke Ausrichtung auf die Naturwissenschaften gegeben, und dabei ist anderes in der Schule mehr in den Hintergrund getreten. Dessen müssen wir uns als reproduzierende Künstler bewusst sein. Wenn wir also eine "Zauberflöte" zur Aufführung bringen, so sehen wir uns mit anderen Ansprüchen und Rahmenbedingungen konfrontiert als vor 30 Jahren. Aber etwas ist gleich geblieben: Es gibt zwei Dinge, die zum Erfolg führen: Qualität und Leidenschaft. Wenn das vorhanden ist, mache ich mir um die Zukunft der klassischen Musik keine Sorgen.
Erklärt man also den Sarastro in der heutigen Zeit, indem man ihn in einen Smoking steckt und auf ein Motorrad setzt?
Welser-Möst: Das kann man so allgemein nicht sagen. Generell aber gilt: Man darf sein Publikum nicht unterschätzen. Und wir müssen davon weg kommen, zu glauben, dass Provokation das einzig adäquate Mittel der Interpretation ist; es ist eines, aber nicht das einzige.
Das Gespräch moderierte Rudolf Mitlöhner.
Franz Welser-Möst, 1960 in Linz geboren, zählt zu den weltweit führenden Dirigenten der jüngeren Generation. 1990 bis 1996 war er Musikdirektor des London Philharmonic Orchestra, 1995 wurde er Chefdirigent des Zürcher Opernhauses. Seit 2002 ist er Musikdirektor des Cleveland Orchestra, dem Opernhaus Zürich ist er weiterhin als Principal Conductor verbunden. In Wien sorgte er Anfang dieser Saison für Aufsehen, als er an der Staatsoper kurzfristig für Christian Thielemann bei einer Aufführungsserie von "Tristan und Isolde" einsprang - und dem Haus am Ring eine Sternstunde bescherte. 2007 wird er dort eine Neueinstudierung von Wagners "Ring" leiten; mit dem dafür dem Vernehmen nach ursprünglich vorgesehenen Regisseur Martin KuÇsej konnte sich Welser-Möst inhaltlich nicht einigen. Staatsoperndirektor Ioan Holender bestritt indes, dass KuÇsej überhaupt ein Angebot hatte - wie auch, dass Welser-Möst ab 2007 Musikdirektor seines Hauses hätte werden sollen. Welser-Möst jedenfalls lehnte dieses behauptete Angebot laut eigenen Angaben mit Verweis auf seine Tätigkeit in Cleveland ab.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!