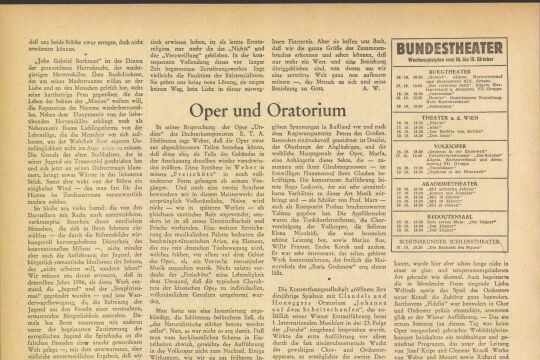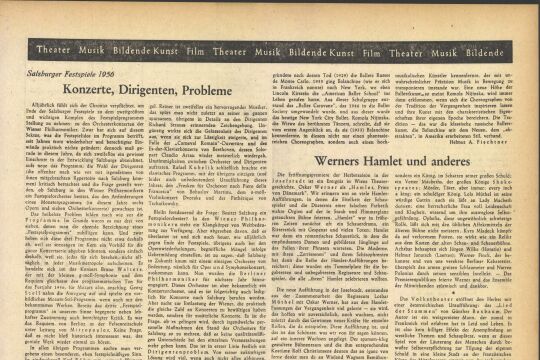Franz Welser-Möst, Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, über seine Annäherung an Mozarts "Don Giovanni", die Wiener Philharmoniker und sein Debüt beim Neujahrskonzert.
Geplant war, dass Franz Welser-Möst zum Jahreswechsel die "Fledermaus" in der Staatsoper dirigiert. Als Dirigent für einen neuen "Don Giovanni" und "Figaro" war er nicht vorgesehen. Gekommen ist es anders: Zum Jahreswechsel dirigiert er sein erstes Neujahrskonzert, und mit "Don Giovanni" eröffnet er am Samstag den auf zwei Saisonen verteilen neuen Mozart-/Da-Ponte-Zyklus der Wiener Staatsoper.
Die Furche: Herr Generalmusikdirektor, vor wenigen Wochen haben Sie in Japan hintereinander Bruckners Neunte mit den Wiener Philharmonikern und Bruckners Siebente mit dem Cleveland Orchestra dirigiert. Was war das für eine Erfahrung für Sie?
Franz Welser-Möst: Eine tolle: zwei der besten Orchester der Welt mit der gleichen Musik. Bei den einen ist es die Muttersprache, bei den anderen eine Sprache, die sie unglaublich gut gelernt haben zu sprechen. Beide Orchester haben auf Grund der jeweiligen Tradition sehr verschiedene Persönlichkeiten. Für einen Dirigenten ist es schon ein Traum, dass man so etwas innerhalb kürzester Zeit erlebt.
Die Furche: Auch wenn es unfair ist, zu fragen: Was hätte dem Zuhörer Franz Welser-Möst besser gefallen?
Welser-Möst: Das Problem liegt im Wort besser, es kommt darauf an, wie man es definiert. Die Wiener Philharmoniker spielen die Musik mit einer Art von Dialekt. Man kann zwar eine Sprache lernen, aber es gibt gewisse Eigenheiten eines Dialekts, die man nicht lernen kann. Wenn Sie den Wiener Philharmonikern beim zweiten Themenblock im langsamen Satz der Neunten Bruckner sagen: Denken Sie an "Parsifal" - dann wissen sie genau, was sie zu tun haben. Sagen Sie das einem reinen Konzertorchester, haben die keine Ahnung, wovon Sie reden. Die Wiener Philharmoniker haben aufgrund ihrer Persönlichkeit, die sich aus dem Opernalltag speist, einen Mut und eine Spontaneität, die ein Konzertorchester nicht hat. Bei den Clevelandern findet eine Vertiefung statt von Mal zu Mal, was unglaublich schön ist. Besser? Ich weiß es nicht, es hat beides seine großen Reize.
Die Furche: Ihre zweite Premiere als Musikdirektor der Staatsoper gilt Mozarts "Don Giovanni", für E. T. A. Hoffmann die "Oper aller Opern", für Tschaikowsky die Krone der gesamten Opernliteratur - und für Sie?
Welser-Möst: Der Spruch geht zurück auf einen großen Kollegen von mir, der schon lange tot ist: Beethoven klopft an die Himmelstür, Mozart war schon dort. Was ich damit sagen will: Das zählt schon zum Göttlichsten, was wir in unserer Kultur haben. Man kann da nur mit einer großen Demut herangehen. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern sich der Substanz anzunähern - man kommt ohnedies nie ganz hin.
Die Furche: Mozart bezeichnet "Don Giovanni" als "dramma giocoso". Wo setzt man hier als Interpret an - vor allem, wenn man mit diesem Werk schon einige Erfahrung hat?
Welser-Möst: Je mehr Erfahrung man hat, desto mehr lernt man die verschiedenen Tiefen kennen, schätzen und lieben. Zum Beispiel die Zerlina-Arie "Batti, batti" ("Schlage, schlage, guter Masetto"): Wenn man "Don Giovanni" zum ersten Mal einstudiert, ist das etwas, was nicht wichtig ist; aber das gewinnt dann an Wichtigkeit. Das Cellosolo im 6/8-Takt soll nicht nach Hühnerhof klingen, denn Zerlina ist kein dummes Huhn, ganz im Gegenteil. Diese Art von subtiler Verführungskunst, die sie gegenüber Masetto zeigt, muss man spüren, vielleicht nicht hören. Man muss diesen Dingen genügend Raum geben, das hat nichts mit langsamem Tempo zu tun. Oder die Pausen beim ersten Auftritt der Donna Elvira, wo dieses Suchende ausgedrückt wird. Das ist das Fantastische an Mozart, das ist mit ein Grund, warum wir einen Don Giovanni, obwohl er nach unseren Normen so ein Unsympathling ist, trotzdem sympathisch finden: weil Mozart uns zeigt, dass der Mensch auch seine Schattenseiten hat. Deshalb können wir uns in diesen Figuren so leicht wiedererkennen.
Die Furche: Jede Oper ist auch eine Botschaft. Was soll der Mensch von heute von "Don Giovanni" mitnehmen?
Welser-Möst: Don Giovanni ist ein Mensch, der die Kerze von beiden Enden abbrennt. Er ist jemand, der durch dieses Stück mit einem ganz anderen Tempo durchgeht als die übrigen Figuren. Das sind Dinge, die haben auch mit unserer Zeit zu tun: Wir werden zwar alle älter, aber wird rennen dauernd irgendetwas nach, weil wir glauben, wir versäumen etwas. Ich glaube, dass diese Figur, dieses Alles-Nehmen, der nackte Egoismus, etwas ist, was uns den Spiegel vorhält. Dazu kommen noch die anderen Figuren. Mozart ist, was die Frauenfiguren anlangt, immer seiner Zeit voraus gewesen. Diese Zerlina ist keine dumme Bauernmagd, die Donna Elvira keine hysterische Kuh, das sind komplexe Figuren. Wie Mozart die Frauen zeichnet - das finde ich wahnsinnig modern.
Die Furche: Noch eine zweite Premiere steht für Sie in diesem Monat an: das erste Neujahrskonzert. Welche Beziehung verbindet Sie mit Strauß?
Welser-Möst: Ich kann mich an Diskussionen mit Orchestern erinnern: Wie früh spielt man diesen zweiten Schlag? Da gibt es keine Regel, außer dass man zuhören muss, wie die Melodie geht und welchen Grundcharakter sie hat, danach richtet es sich. Ich habe vor mir jetzt ein Orchester, das diese Sprache ganz natürlich spricht.
Die Furche: Wie ist das Programm zustande gekommen?
Welser-Möst: Als ich mit Philharmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg begonnen habe, darüber zu sprechen, habe ich ihn auf einen familiären Bezug hingewiesen: Zwei Stücke, die bisher noch nie beim Neujahrskonzert zu hören waren, die "Amazonen-Polka" und die "Debüt-Quadrille", hat Johann Strauß Sohn bei seinem öffentlichen Debüt 1844 im Casino Hietzing uraufgeführt; Besitzer des Casinos war mein Urururgroßvater, Ferdinand Dommayer. In Zürich haben wir die Strauß-Oper "Simplicius" ausgegraben, drei Stücke aus dem Programm im ersten Teil beziehen sich darauf: der "Reitermarsch", "Donauweibchen" - einer meiner Lieblingswalzer - und "Mutig voran".
Die Furche: Apropos mutig voran: Staatsopernpremieren, Neujahrskonzert, Musikdirektor eines der wichtigsten Orchester - bleiben da noch Wünsche für die nächsten 25 Jahre?
Welser-Möst: Wäre ich ein typischer Österreicher, würde ich sagen: die Frühpension.
Die Furche: Und wenn Sie es nicht so "typisch" nehmen?
Welser-Möst: Man kann es nur so nehmen, wie es kommt. Ich habe früh in meinem Leben gelernt, dass es auch morgen vorbei sein kann. Ich denke nie darüber nach, ich war nie ein Stratege, diese Aufgaben sind immer an mich herangetragen worden. Wenn es klappt, ist das wunderbar, man stellt sich seiner Aufgabe und versucht, sie bestmöglich zu erfüllen. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, und es kommt irgendetwas anderes. Die Welt ist groß genug, es ist für jeden etwas da.
* Das Gespräch führte Walter Dobner
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!