Auch mit dem zweiten Teil ihres Mozart/Da-Ponte-Zyklus’, "Le nozze di Figaro“, bleibt die Wiener Staatsoper - vor allem szenisch - unter den Erwartungen.
Dass dieser dreiteilige Zyklus überhaupt zustande kommt, ist Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst zu danken. Nach Absagen einiger Dirigenten hat er selbst den Vorschlag gemacht, den gesamten Zyklus zu übernehmen. Der Regisseur dieser Produktionen stand schon fest: der einstige Jean-Pierre Ponnelle-Assistent Jean-Louis Martinoty. Ein belesener Mann, der nicht nur die jeweilige Oper, sondern auch ihr Umfeld neugierig erkundet und im Falle des "Figaro“ sich auch für die Beziehungen zu Rossinis "Barbier“ interessiert.
Seltsames Kruzifix
Aber intellektuelle Auseinandersetzung ist eines, dies in die Realität zu übertragen etwas anderes. Das gelingt Martinoty auch mit diesem "Figaro“ nicht. Er kann damit die durch lange Jahre gezeigte, mustergültige Ponnelle-Produktion in keiner Phase des Geschehens vergessen machen. Das beginnt schon beim Bühnenbild: Hans Schavernoch ist zu diesem Sujet partout nichts anderes eingefallen, als eine mehr oder minder offene Bühne mit einigen Bildern zu drapieren, mit einem halben Christuskreuz, das im Laufe des Abends nicht näher erläutert wird, in der Mitte. Einige wenige Requisiten begleiten diese Szenerie.
Um genügend Platz für entsprechend gezeichnete Charaktere zu bieten? Leider nein. Wie schon zuletzt bei "Don Giovanni“ versäumt es Martinoty, den einzelnen Protagonisten entsprechend klare Konturen zu geben, ihre Beziehungen zueinander konzise zu zeichnen. Anstelle dessen werden dem Betrachter zwar ästhetisch untadelige, im Wesentlichen nur gefällige Arrangements serviert. Nichts von der für dieses Werk so typischen, harschen Gesellschaftskritik dringt durch.
Zu hoffen ist, dass die Absicht, Martinoty für die noch ausstehende neue "Così fan tutte“ als Regisseur einzusetzen, möglichst bald fallen gelassen wird. Gerade von einem ersten Haus, das noch dazu Mozart in einem besonderen Maße verpflichtet ist, darf man wenn schon nicht stilbildende, so wenigstens in jeder Beziehung hochkarätige Neuproduktionen erwarten. Oder sollte das - wollte man eine erste Zwischenbilanz der erst jungen Ära Dominique Meyer ziehen - nur für Stücke der klassischen Moderne ("Cardillac“) und des Barock ("Alcina“) gelten?
Freilich, die Zeit, die Meyer für die Vorbereitung seiner Wiener Direktion zur Verfügung stand, war äußerst kurz. Die erste Saison, für die mit "Anna Bolena“ ein Sängerfest (Netrebko, Garanˇca) avisiert ist und mit "Kátja Kabanová“ der Beginn eines über mehrere Spielzeiten verteilten Janáˇcek-Zyklus, ist noch nicht vorbei. Trotzdem: Dass Mozart im Haus am Ring nicht und nicht in der zu erwartenden Qualität gelingen will, muss nachdenklich stimmen.
Franz Welser-Möst hätte klare Vorstellungen für eine Art Wiener Mozartstil des 21. Jahrhunderts, alleine schon, was Tempogestaltung oder Phrasierung anlangt. Straff und zumeist auf Durchsichtigkeit konzentriert durchmisst er die Partitur, kann seine Ideen aber nur stellenweise durchsetzen, denn die Besetzung ist nur zum Teil rollendeckend. Wirklich überzeugen kann nur, trotz distanzierten Beginns, Staatsoperndebütant Luca Pisaroni als viriler Figaro. Mit dieser Partie hätte wohl auch Erwin Schrott mehr Fortüne, sein Almaviva wirkt unangemessen steif und lässt profunde Tiefe vermissen.
Barbarina sticht hervor
Dorothea Röschmann wiederum hat als Gräfin vor allem in der Höhe ziemliche Probleme. Anna Bonitatibus fehlt es für den Cherubino an entsprechendem Atem, Sylvia Schwartz besitzt für die Susanne ein (noch) zu kleines Volumen, Donna Ellens matronenhafte Marcellina ist als Figur interessanter als stimmlich. Nur durchschnittlich die übrigen Protagonisten mit Ausnahme von Daniela Fally als Barbarina. Unverständlich fantasielos agierte die neue Studienleiterin Kathleen Kelly am Hammerklavier.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!























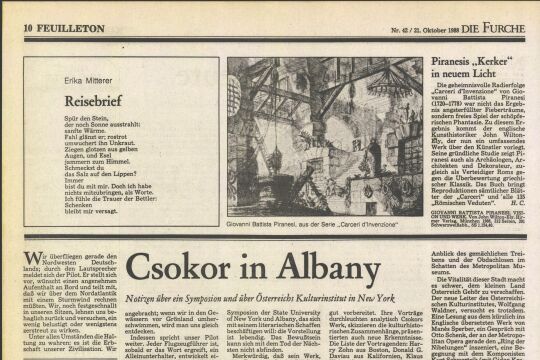



















































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)





















