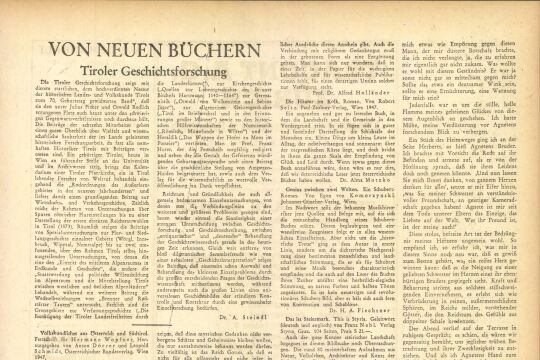Die kleinen Dinge
FOKUS
Glück ist das Gefühl, lebendig zu sein
Wir leben in Österreich im Wohlstand und in Frieden. Dennoch fehlen vielen im Alltag Freude und Lust am Leben. Warum ist das so? Betrachtungen des Philosophen Peter Strasser.
Wir leben in Österreich im Wohlstand und in Frieden. Dennoch fehlen vielen im Alltag Freude und Lust am Leben. Warum ist das so? Betrachtungen des Philosophen Peter Strasser.
Was ist Glück? Die Frage scheint müßig. Es sei denn, man nimmt an, uns wäre unser Wissen nicht recht geheuer. Dafür scheint einiges zu sprechen. Sonst wäre kaum begreiflich, dass die Ethik des Hedonismus, welche im Glück den höchsten Wert erblickt, akkurat den „Vordenkern“ unserer glücksorientierten Gesellschaft missfällt. Womit hat das zu tun? Offenbar damit, dass die durchschnittliche, massenhafte Art, heute glücklich sein zu wollen, als oberflächlich, wenn nicht gar als Ausdruck einer falschen Lebenseinstellung beurteilt wird. Hinter diesem Urteil steht eine grundlegende Unterscheidung: die zwischen dem faktischen und dem wahren Glück.
Einer der großen Dialektiker des amerikanischen Way of Life, Walker Percy, berichtet in seinem 1966 erschienenen Roman „The Last Gentleman“ über eine Lebendigkeitsepisode. Sie ist wohl Percys eigenem Vater geschuldet. Will Barrett, so der Name des Sohnes im Roman, äußert an einer Stelle den erstaunlichen Satz: „War is better than Monday morning.“ Zunächst erinnert sich Barrett, dass an Tagen, an denen es schlechte Neuigkeiten gab, dort, wo er zu Hause war, nämlich im Süden der USA, die Familien enger zusammenrückten. Man war dann plötzlich in jener eigentümlichen Stimmung, in der man, wie Percy überraschend anmerkt, sogar noch die banalen Azaleen vor dem Haus „sehen“ konnte.
Katastrophenlebendigkeit
Besonders eindringlich geschildert wird die Hochstimmung des Vaters, als dieser sich auf den Weg zum Rekrutierungskommando macht. Am 7. Dezember 1941 hatten japanische Flugzeuge den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor angegriffen, einen Tag später erklärten die USA Japan den Krieg. An jenem Montag sei es eine Freude gewesen, den Vater aus dem Haus gehen zu sehen. Plötzlich hatten die Gebäude, die Bäume, ja selbst die Risse im Gehsteig ihr – wie es in Peter Handkes Übersetzung heißt – „bösartiges Gegenwärtigsein“ verloren. Die schlimme Drohung, die sich jeden Morgen an gewöhnlichen Wochentagen einstellte, war wie weggeblasen.
Vermutlich kennen wir alle, aus hoffentlich geringfügigerem Anlass, diese Form der kollektiven Hochstimmung, die in den genannten Beispielen eine gespenstische Katastrophenlebendigkeit herbeizitiert. Denn unabhängig davon lässt sich über die Erhitzung des Kollektivs, das kämpferisch oder hymnisch gestimmt sein mag, beim Einzelnen das Gefühl erzeugen, erst als Teil der erregten Masse „wirklich“ zu existieren, also im existenziellen Sinne des Wortes „da zu sein“.
Die Praxis des Glücks kann sich bis zur reinen Äußerlichkeit steigern. Das Erlebnismoment tritt dann immer weiter in den Hintergrund zugunsten dessen, was man zu tun und zu erreichen hat, um allgemein als glücklicher Mensch zu gelten. Am Schluss hat man alles, was nach allgemeiner Ansicht erforderlich ist, um glücklich zu sein, nur eines hat man nicht – das Gefühl, glücklich zu sein. Man glaubt zwar, alles zu haben, um glücklich zu sein, und dabei ist an die Stelle des Glücks schon längst der bloße Glaube daran, dass man glücklich sei, getreten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!