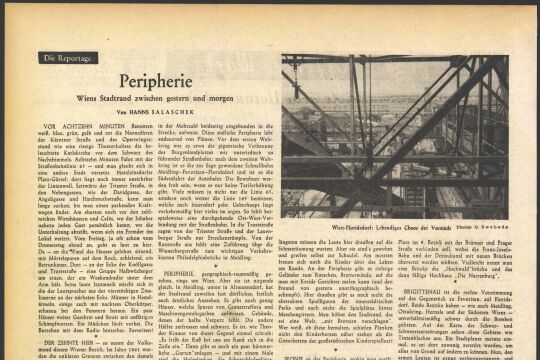48 Stunden in Berlin mit einem Geschäftemacher aus der Wortverliererbranche: dem Kärntner Schriftsteller Egyd Gstättner.
Wie meistens, wenn ich in eine Millionenstadt komme, war ich auch nach Berlin aus gänzlich nichtigem Anlass gereist: Diesmal hatte mich nämlich das deutsche Nachrichtenmagazin Focus eingeladen, vor Ort eine Reportage über ein Fußballspiel zwischen Deutschen Bundestagsabgeordneten und Polnischen Parlamentariern zu machen. Frau Pawlak, die Ressortleiterin, war eben wegen meiner angeblichen ironischen Fähigkeiten und meiner Vorliebe für Nichtigkeiten auf mich gekommen und meinte, mit diesem geistigen Handwerkszeug ausgestattet werde es mir sicher gelingen, den richtigen Ton zu treffen und dem Event das Gewicht zu verleihen, das ihm gebührt, also Leichtgewicht.
Der Fall war der: Die Polen wollten die EU-Osterweiterung weitertreiben, die Deutschen wollten gewinnen, beide in kurzen Hosen und beide mit den Nationaltrikots ihrer Länder verkleidet. Mit meinen beinahe tausend Flugkilometern war ich sicher der mit Abstand am weitesten angereiste und insofern auch der kurioseste aller akkreditierten Zaungäste. Aber wenn sich in ganz Deutschland niemand dafür findet ... Eine ziemlich alberne und peinliche Geschichte also. Und ich habe mein Wort - und genaugenommen und bestellungsgemäß exakt 10.280 Druckzeichen - auch nur verloren, weil mir Focus ein nicht bloß dichterfürstliches, sondern ausnahmsweise wirklich fürstliches Honorar in Aussicht gestellt hatte. Ich war also, könnte man sagen, wirklich als Geschäftsmann in Berlin, als Geschäftemacher aus der Wortverliererbranche. Worte verlieren ist auch viel leichter als den Osten zu erweitern.
Verlorene Worte
Dieses verlorene Wort jemals wiederzufinden, habe ich übrigens gar kein Interesse. Geschäft ist Geschäft. Ohnehin ist mir das Unnötige und Unnütze lieber als das Nötige und Nützliche, das Nichtige lieber als das Wichtige, das programmierte Nichtige lieber als das unvorhergesehene Nichtige: Da spart man sich die Vorsätze, die falschen Erwartungen und richtigen Enttäuschungen. Und gerade in eine Stadt, in die so viele gekommen sind, um die Welt zu erobern, komme ich ausgesprochen gern, um gar nichts zu tun und mir eineinhalb Stunden lang an einer Trainingsplatzoutlinie die Beine in den Bauch zu stehen.
Umso riesiger eine Stadt, desto weniger Lust habe ich, Aufsehen in ihr zu erregen. Und schon gar nicht wollte ich mich aufgrund meiner achtundvierzig Stunden in Berlinliteratur versuchen. Der Heimvorteil in der Schriftstellerei ist noch viel markanter als im Fußball, nicht unbedingt, was die Publikumsunterstützung, aber was die Kenntnis der so genannten Ortsgegebenheiten, der Eigenheiten, Charakteristika und mitunter Tücken der Spielstätte betrifft. Mein Thema ist nicht die Stadt, mein Thema sind zwei Tage Tagestourismus in ihr. Der Tourist hat einen großen Vorteil: Das Vorrecht, ungescholten blöd zu sein; umgekehrt nur die eine Pflicht, das nicht zu bestreiten. Wenn ein Fahrgast in der S-Bahn plötzlich aufsteht und von der Station Savigniplatz bis zur Station Friedrichstraße Donizettiarien intoniert, kann er ja unmöglich sagen, ob das hier normal ist.
Letztes Nazidenkmal
Soviel Zeit hat man als Geschäftsmann und Tourist gerade, in die Stadtbahn zu steigen und nach Spandau hinauszufahren, zum Olympiastadion, zum letzten noch in Betrieb stehenden Nazidenkmal. Die ursprüngliche Stahlbetonkonstruktion der Arena wollte Hitler nicht und soll deswegen sogar mit der Absage der Olympischen Spiele 1936 gedroht haben. Ich frage mich nur: Wem? Dem Architekten? Jedenfalls wurde das riesige Oval nachträglich mit Natursteinplatten verkleidet, die in Handarbeit aufgerauht worden waren, sodass die Friedensspiele - wie sie vom Veranstalter bezeichnet worden sind - doch noch stattgefunden haben und eben erst drei Jahre später abgesagt und storniert worden sind. Mit Frieden spielt man nicht. Das Stadion mit seinen achtzigtausend Plätzen war Hitler außerdem viel zu klein: Noch viel größer und gewaltiger hätte es nach Ansicht des Möchtegernarchitekten und Möchtegernweltherrschers werden müssen, Architektur für ein tausendjähriges Reich, Architektur für die Ewigkeit in der Welthauptstadt Germania. Für einen wie mich, dessen gesamte Heimatstadt jedenfalls der Einwohnerzahl nach in dieses eine Stadion passte, mutet es noch immer ziemlich gigantomanisch an. Aber heute stehen solche Arenen in vielen Städten auf der ganzen Welt, nur ohne Natursteinplatten.
Vor sechzig Jahren ist in diesem Stadion der Vater noch keine zwanzig Jahre alt gesessen und hat mitangehört, wie Goebbels den großdeutschen Herrenpöbel angepeitscht und angebrüllt hat, ob er den totalen Krieg will. Und die Herrenherde wollte ihn, auf Teufel komm heraus. Damals, glaube ich, hat es dem Vater - sehr jung und kaum erwachsen noch, aber doch viel zu spät - gedämmert, welche bestialischen Ungeheuer, welch skrupellose Weltenschlächter und menschheitsverachtenden Monster die Nazis sind, die Masse der Mitläufer und oft Mitsprinter aber nicht bloß bösartig und durchtrieben, sondern auch von geradezu selbstmörderischer Dummheit. Es hat den Vater arg gegraust, und von dem Tag an hat er Stadien für den Rest seines Lebens überhaupt gemieden, selbst das in Klagenfurt, in das bloß zehntausend Leute passen und wo, soweit meine Erinnerung zurückreicht, noch nie ein Politiker mehr als Gute Unterhaltung ins Mikrophon gesagt hat.
Soviel Zeit hat man als Geschäftsmann und Tagestourist gerade, am Kurfürstendamm einen Doppeldeckerbus zu besteigen und eine Stadtrundfahrt zu unternehmen: Die postmodern umschalten Trümmer der Gedächtniskirche, das Europacenter, das KaDeWe, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die Philharmonie, die Daimler City, der Dom, das Nikolaiviertel, der Alexanderplatz, der Fernsehturm, das Rote Rathaus und die Stadtfahne, die auf einem seiner Türmchen weht: Rotweißrot mit einem Bärli in der Mitte seltsam, diese rotweißroten Fahnen verfolgen mich, wohin ich komme. Das Denkmal von Marx und Lenin wie zwei überlebensgroße querschnittsgelähmte Autisten in einer mittlerweile abgerissenen Bahnhofswartehalle, wie hinbestellt und nicht abgeholt, trotzig zeitlos, zeitlos trotzig. Beim nächsten Mal wird alles besser, soll ein anonymer Graffitikünstler auf den Sockel gesprüht haben, mittlerweile ist auch das bereinigt, jedenfalls gelöscht.
Großkotzige Bauten
Das Schloss Charlottenburg, das Ägyptische Museum und Nofretete ("Ich bin eine Berlinerin!"), die Aeroflotzentrale neben der Komischen Oper und die großkotzige Russische Botschaft. Fassaden, Fronten, Fronten, Fassaden. Die Cafés in der Prachtstraße Unter den Linden. Alle Augenblicke eine mächtige Polizeieskorte mit Blaulicht und Hupen und Trara, eine ganze Reihe schwarzer BMW und Mercedes, immer auch ein Notarztwagen für den Fall der Fälle - Deutsche denken an alles -, nochmals Polizei, dann wieder Volk. Nirgendwo ein Trabi, nur im Spielzeugformat in den Schaufenstern der Souvenirläden. Außerdem Marmorstaubbüsten von Wilhelm I., Friedrich II., Bismarck, Goethe, Bach, Lenin, Mozart, Sissi aus Österreich (Danke, ganz lieb!). Fritz aus Zinn, Fritz auf Sockel aus Zinn, Fritz aus Alabaster, Schiller (mini/medium/maxi), Karl Marx aus Gips, Kaffeehäferl "Breschnew & Honecker im Zungenkuss vereint", Reichstagseierbecher DM 14.95.
Reichstag, Brandenburger Tor, weiter, weiter: Topography of Terror, Gestapo, SS and Reichssicherheitshauptamt on the Prinz Albrecht-Terrain, dann Honeckers ehemaliger Regierungssitz, der ehemalige Palast der Republik, also der ostdeutschen, eine Faserplattenbruchbude, derzeit zur Asbestbeseitigung verschalt, anschließend wird sie wohl ganz geschleift. Grenzhäuschen, Grenzbalken, Wachsgrenzsoldat und das Haus am Checkpoint Charlie, der ehemaligen Diplomatengrenzkontrollstelle. Straßenhändler gehen noch immer mit Mützen und Uniformen der Sowjetarmee hausieren, viel Geschäft machen sie nicht an diesem Tag.
Todesstreifen
Jetzt biegen wir in den sogenannten Todesstreifen ein. Das wollen alle wissen, wo denn genau der Osten war und wo der Westen, wo die Grenze verlaufen ist und wo die Mauer. War das ein Jubel in der Stadt und im Land und auf der Welt, als diese Berliner Mauer, woran niemand geglaubt hat, doch noch gefallen ist in den letzten Oktobertagen des Jahres 1989, 28 Jahre, nachdem sie plötzlich da war: Auch das keine Architektur für ein tausendjähriges Reich, auch das keine Architektur für die Ewigkeit. Die Architektur der Mächtigen ist hier letztlich immer nur für ein paar Jahre. Nur weiß man eben nicht, dass das Vorübergehende vorübergeht, bevor es vorübergegangen ist.
Den Fall hab ich schon, der Vater noch im Fernsehen gesehen und die vielen Dokumentationen in der Folge: Das Wirsinddasvolkvolk, die wackere DDR-Armee, die über Nacht keine DDR mehr hatte und ein paar Stunden lang nicht wusste, wohin mit ihrem freischwebenden bedingungslosen Gehorsam, die DDR-Gefangenen in den DDR-Gefängnissen, die über Nacht rückwirkend von Verbrechern verurteilt und eingesperrt worden waren, Fragen von rückgängigzumachenden Zwangsenteignungen, wo nicht genug Heimat für alle da ist. Jetzt ist die Mauer geschleift, aber seit das Unfassbare unfassbar geworden ist, ist es erst so richtig unfassbar, gerade das Unsichtbare ist das Sensationellste und übt eine magische Anziehungskraft aus.
Bloß ein paar hundert Meter Mauer hat man mitten in der Stadt für die Doppeldeckerbustouristen stehen gelassen. Und ausgerechnet am Beginn des Mauerrests ist der Film verschossen, und bis er zurückgespult und ein neuer eingelegt ist ist der Mauerrest längst passiert und weg und nicht mehr festzuhalten mit Kodak. What a pity! Aber zumindest virtuell ist die Mauer längst wieder aufgebaut: Auf jeder zweiten Ansichtskarte steht sie noch, mit oder ohne Volk, mit oder ohne Graffiti ganz nach Belieben, und ein paar Brösel angeblichen Originalmauerbetons hängen in einem Plastikbeutelchen dabei, ein Fingerhut voll Geschichtsstaub für die Wohnzimmervitrine daheim.
Das sieht man auch als Geschäftsmann und Tagestourist von der Stadt, dass sie gleichzeitig unvergleichlich geschichtsträchtig und unvergleichlich jung ist, weil die Weltgeschichtsgeschichten einander wie nirgendwo sonst derart entgegengesetzt und unversöhnbar waren, dass sie einander immer wieder restlos ausradieren und vollkommen zerstören müssen haben. Wie nirgendwo sonst ist Geschichte hier wirklich nur Geschichte, also Erzählung und erzählt wirklich wahrnehmbar. Außer der Sprache, den Worten ist alles verloren gegangen. Wie nirgendwo sonst keine gewachsene, eine immer wieder neugeborene Stadt um den Preis vieler schrecklicher Fehlgeburten. Ein bisschen restaurierter Schinkelklassizismus, wo früher Osten war, da eine Schwindelakropolis, dort ein Schwindelpantheon, die Humboldt-Universität geht locker als Wiener Hofburg durch. Schon im 19. Jahrhundert haben die Preußen einmal alles plattgemacht: In keinem Neuberlin durfte ein Altberlin enthalten sein.
Geschleift, ausradiert
Quadratkilometer für Quadratkilometer nicht ein Gebäudekomplex, der älter als allerhöchstens vierzig, fünfzig Jahre wäre, meistens jünger, als müsste tatsächlich jede Generation, jeder Mensch, um ein eigenes Leben zu leben, auch sein eigenes Haus bauen und zuvor das Haus des Vaters niederreißen. Wer nichts erbt, kann auch keine Sünde erben. Verglichen mit der deutschen leben in Österreichs Hauptstadt Großväter in den Häusern ihrer Großväter. Unsichtbar und nur als Wort gibt es dort nur das Wort Traditionsbruch.
Momentan wird also gerade der alte Osten geschleift und ausradiert. Ein paar Jahre noch, und auch diese Geschichte wird restlos unsichtbar und ein Fall fürs historische Museum sein, sobald die Renovierung und Restaurierung dieses historischen Museums eben abgeschlossen ist: Die ganze Stadt voller Baukräne, nachts sind sie alle mit Neonlichtketten geschmückt: Die Metropole als gigantomanisches Baustellenfest. Vor allem rund um den Reichstagspalast und den Potsdamer Platz wird gerade ein Newest York aus der Erde gestampft, Glaswolkenkratzer um Glaswolkenkratzer um jeden Preis. Ein postmodernes, gläsernes Germania wird demnächst Wirklichkeit werden, eine gläserne Metropole für gläserne Menschen und gläserne Geschichte; es steht zu hoffen - und vieles spricht dafür -, dass es dann gar keine Steine mehr gibt, mit denen irgendjemand werfen könnte, der im Glaswolkenkratzer sitzt. Und schon gar keine Natursteinplatten.