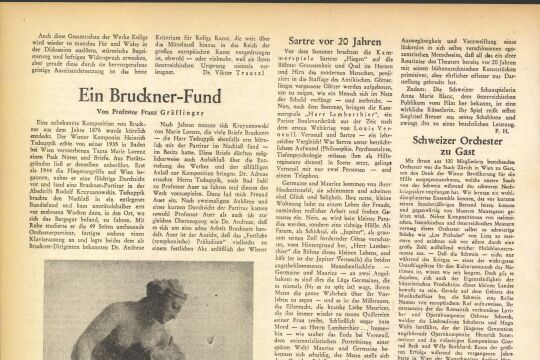"Jedem das Seine" von Hassler und Turrini in Klagenfurt.
Es ist sattsam bekannt, dass das Vergangenheitsbewusstsein des Durchschnittsösterreichers stark ausgeprägt, aber auch äußerst selektiv ist. Und weil die Österreicher sich lieber an die einstige Pracht und Größe der Monarchie erinnern als an die Rolle des Landes zwischen 1938 und 1945, springen hin und wieder die Künstler ein, um die kollektive Verdrängung zu durchbrechen.
Mit ihrem - vom scheidenden Intendanten des Klagenfurter Stadttheaters Dietmar Pflegerl in Auftrag gegebenen - Werk Jedem das Seine kommt diese gewiss verdienstvolle Tat, eine jener Lücken in der Erinnerungskultur der Republik einem breiteren Publikum erneut ins Gedächtnis zu rufen, den Autoren Silke Hassler und Peter Turrini zu. In dem provokant mit Volksoperette untertitelten Werk, zu dem Roland Neuwirth die Musik komponierte, geht es um das Schicksal einer Gruppe ungarisch-jüdischer Zwangsarbeiter, wie sie in den letzten Kriegsmonaten zu Hunderttausenden vor der im Osten herannahenden Roten Armee in Richtung Mauthausen getrieben worden sind. Diese so genannten Todesmärsche forderten noch wenige Wochen vor Kriegsende zig-tausende Opfer, sei es durch Erschöpfung, durch mörderische Exzesse der Wachmannschaften oder durch antisemitische Übergriffe einer marodierenden Zivilbevölkerung.
Fiktion über Holocaust?
Es ist ein gewagtes Unterfangen, etwas, was vermeintlich als kaum erzählbar und als undarstellbar gilt, auf das Theater zu bringen. Spätestens seit Spielbergs Schindlers Liste (1993) und Benignis Komödie Das Leben ist schön (1997) gibt es eine breite Diskussion darüber, ob und wie sich die Geschichte der Verfolgung und Ermordung der Juden in Europa massenmedial aufbereiten lässt. Auf der einen Seite steht die Frage, ob die Darstellung der Schoa am Ende gar nur als fiktive möglich ist, andererseits gibt es starke Bedenken gegenüber jeder fiktionalen Darstellung, zumal durch die Nachgeborenen und angesichts der Tatsache, dass die Zeitzeugen auszusterben beginnen und mit ihnen die innerste Wahrheit des erlebten Entsetzens.
Muss nicht vor dem Unfassbaren jede dramaturgische Erzählung, jede Repräsentation versagen? Zu groß scheint die Gefahr, das Leiden der Opfer zu bagatellisieren, das Böse der Täter zu personalisieren und damit zu banalisieren. Die Dimension der Katastrophe droht zugunsten von Schicksalspathos und Holocaust-Sentimentalismus leicht aus dem Bewusstsein zu geraten. Zudem trägt jede Darstellung unweigerlich zur Gewöhnung und Trivialisierung des Unfassbaren bei.
Allen Einwänden zum Trotz hat die populärkulturelle Beschäftigung mit dem Thema zugenommen. Im Film und vor allem im Fernsehen ist der Trend zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs unübersehbar, und durch die Gesetzmäßigkeiten des Mediums schreibt sich eine bestimmte Sicht der Geschichte in unsere Kultur ein. Der amerikanische Historiker Hayden White nennt das "facts from fiction", was meint, dass der Erinnerungsdiskurs zunehmend durch affektheischende, emotionsgeladene Bilder eines pseudoaufklärerischen Geschichtsfilmgenres dominiert wird, der die wissenschaftliche Forschung mit ihren differenzierenden Deutungen überlagert.
Keine neue Sicht
Mit welchem Gewinn Turrini/Hassler dieses Thema nun für das Theater wieder entdeckt haben, lässt sich weder auf der Ebene des Stückes noch auf der Ebene der Inszenierung leicht beantworten. Denn es ist weder den Autoren noch dem Regisseur der Uraufführung Michael Sturminger gelungen, eine innere Wahrheit sichtbar zu machen - oder auch nur mehr als die schiere Behauptung, dass sich, was Fakt ist, zugetragen hat. Vielleicht muss man bescheidener sein und ihr Verdienst allein darin sehen, zur Erinnerung an diese Geschehnisse an-und innezuhalten.
Turrini und Hassler haben ein Stück geschrieben, das nicht frei von routinierten handwerklichen Kunstgriffen zur vermeintlichen Komplexitätssteigerung und Vortäuschung von Bedeutsamkeit ist. Sie erzählen von Juden, die auf ihrem Todesmarsch einige Zeit in einer Scheune gefangen gehalten werden und dort unter Todesgefahr Kunst (pikanterweise die Operette Wiener Blut) gegen Kartoffeln tauschen. Doppelsinnig ist das Spiel mit der Bezeichnung Volksoperette: Sie ist nicht nur imaginärer Fluchtort der Verfolgten - "Die Welt da draußen will uns töten, deshalb müssen wir so tun, als wären wir in einer anderen" -, sie weist auch auf das Wegschauen, das Verdrängen, auf die ,Operettenseligkeit' des österreichischen Geschichtsbewusstseins hin.
Auf Nachspielen verzichtet
Es ist dem Regisseur hoch anzurechnen, auf das Nachspielen des Grauens verzichtet zu haben. Am Anfang lässt er - ein epischer Gestus, der schon im Stück selbst angelegt ist - die Regieanweisungen mitlesen und macht so auf der Ebene des Textes das Problem der Darstellung des Nicht-Darstellbaren durchsichtig. Aber offenbar traut er diesem Konzept nicht und setzt mit zunehmender Dauer auf Melodramatisierung. Dabei werden persönliche Schicksale sichtbar, die beliebig austauschbar sind und die man auch schon zu kennen glaubt.
Tatsächlich sind die Figuren von Hassler/Turrini bloß mythische Archetypen des "Holocaustgenres". Da gibt es auf der eine Seite den altklugen, stark jiddelnden Traditonsjuden (dargestellt von Lukas Miko), das kultivierte und assimilierte Professorenehepaar (sie heißt selbstverständlich Hannah, er Jakob und die deportierte Tochter Esther) und auf der anderen Seite der tumbe antisemitische Bauer (Dirk Nocker), der schnell kapiert und die Fronten wechselt, die gute Bäuerin Traudel (Josefin Platt), Vertreterin des ,anderen' Österreich, wodurch eine problematische und fragwürdige Entlastung geleistet wird, sowie die frömmelnde Magd Poldi (Winnie Böwe), der sogar eine gemeinsame Zukunft mit dem melancholischen Geiger (Aliosha Biz) in Aussicht steht. Jedem das Seine erweist sich als verzichtbarer Mainstream, enthält es doch für jeden etwas.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!