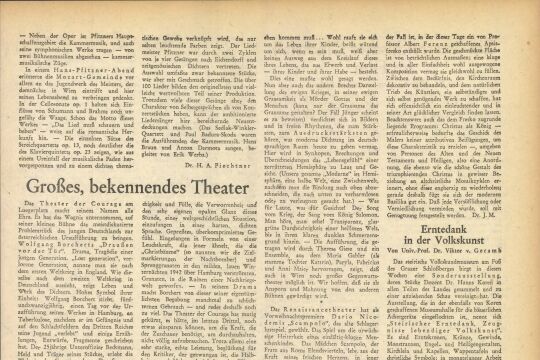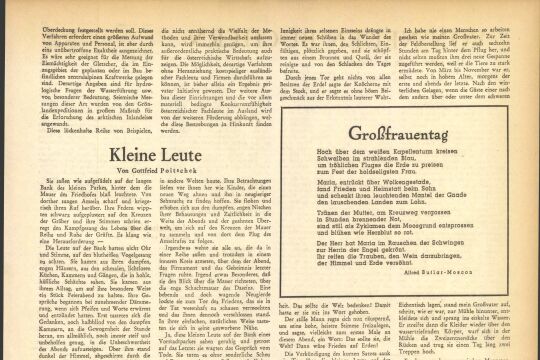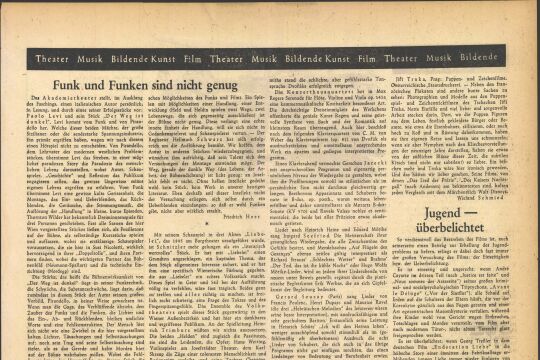Mit zwei Inszenierungen von Stücken des norwegischen Dramatikers Jon Fosse kehrt der 65-jährige Starregisseur Patrice Chéreau nach Wien zurück.
Die Themen des vor allem bei deutschen Regisseuren seit den 90er Jahren beliebten norwegischen Dramatikers Jon Fosse gleichen einander von Stück zu Stück. Eigentlich geht es immer nur um eines - die große existentielle Traurigkeit. Immer führt er melancholische, vom Leben enttäuschte, gescheiterte, einsame Menschen vor, ohne dass deren Leiden je genauer erklärt würde. Jeder scheint für sich allein, gefangen in der inneren Ausweglosigkeit des eigenen Ichs. Aus diesem Grund wird in diesen düsteren Stücken so oft geschwiegen, bricht das Gespräch zwischen den Figuren häufig einfach ab, ist das Ungesagte stets fast wichtiger als das Ausgesprochene.
In "Rêve d’automne“ fällt ein für Fosses Dramen charakteristischer Satz: "Wo ist das Leben hin / die Zeit vergeht / Die Tage / Wochen / Monate / Jahre / alles verschwindet einfach / im Nichts.“
Erinnerung, Vorwürfe, Wünsche
Schauplatz ist ein Friedhof. Chéreau hat das Stück in einem Saal des Musée du Louvre in Paris inszeniert, den sein Bühnenbildner Richard Peduzzi nun auf der Bühne der Halle E im Museumsquartier nachgebaut hat, was ein wenig um die Ecke gedacht wirkt. Am Anfang huscht eine barfüßige Gestalt im Totenhemd durch die riesigen Räume, in einer Nische ist Géricaults berühmtes Gemälde "Floß der Medusa“ zu erkennen. Sie liest die Bildtafeln, als wären es Grabinschriften, und legt vor einer einen Blumenstrauß nieder. Dann tritt eine junge blonde Frau auf, unruhig und mit suchendem Blick (gespielt von Valeria Bruni Tedeschi).
Wenig später kommt ein Mann (Pascal Greggory) in schäbigem Mantel, mit Tasche unter dem Arm, die sein gesamtes Hab und Gut zu beinhalten scheint. Nach längerer Zeit begegnen einander hier am Ort der Toten der Mann und die Frau. Offenbar hatten sie früher eine Beziehung, jetzt ist er verheiratet und hat einen Sohn. Erinnerungen, Vorwürfe, Wünsche werden erörtert, aber eigentlich reden sie aneinander vorbei. Sie hängt noch immer an ihm, er begehrt sie, vielleicht, traut sich aber nicht.
Tot auf dem Parkett
Dann treten die Eltern des Mannes auf. Der Zeitverlauf wird aufgehoben, Jahre vergehen in Augenblicken, und auf einmal stellt der Mann die Frau als seine neue Frau vor. Auch die Ex des Mannes tritt auf, erzählt vom Sterben ihres Mannes und vom Tod des gemeinsamen Sohnes. Am Ende liegen alle Männer tot auf dem Parkett der Bühne, drei Generationen, die Frauen gehen ab mit der lakonischen Bemerkung der Mutter, dass es Zeit sei. Wie bei fast jedem Stück von Fosse geht es um die wichtigsten, die allerletzten Dinge des Lebens: immer nur Liebe und Tod, wie es im Stück einmal heißt. Aber irgendwie will sich Chéreaus Zugang zum Stück nicht zeigen, wirkt die Kulisse des Museums als zu aufgesetzt, und kaum verträgt sich das französische Pathos mit Fosses karger Sprache. Es bleibt dem Zuschauer überlassen, Chéreaus Andeutungen mit Sinn zu füllen.
Anders ist das bei "I am the wind“, das Chéreau am Young Vic Theater in London eindringlich inszeniert hat.
Zwei Männer, nur "der Eine“ und "der Andere“ genannt (und vielleicht sind sie zwei Seiten ein und derselben Person) sind in einem zerbrechlichen Boot auf offener, rauer See unterwegs. Der Eine, ein ausgemergelter todessüchtiger Schmerzensmann mit brennenden Augen (Tom Brooke), kann den Lärm des Lebens nicht ertragen. Lebensmüde fühlt er sich wie ein großer Stein auf dem Grund des Meeres. Der Andere (Jack Laskey) versucht ihn wortreich zu überzeugen, dass man leben muss, findet dafür aber kaum Argumente. Stattdessen versucht er hilflos, gute Laune zu verbreiten. Am Ende, nachdem sie zusammen gegessen und getrunken haben, wird er den Todessehnsüchtigen nicht davor bewahrt haben können, sich in die Fluten zu stürzen.
Scheitern von Mitmenschlichkeit
Richard Peduzzi hat dafür einen einfachen dunklen Raum geschaffen mit einer raumfüllenden Wasserpfütze, im Hintergrund ist eine rechteckige Öffnung mit einem niedrigen Bootssteg zu erkennen. Chéreau ist hier eine sehr präzise Inszenierung mit zwei fabelhaften Darstellern gelungen, die zudem mit einem technischen Coup aufwartet, der das Geschehen illustriert: Plötzlich erhebt sich aus der Pfütze ein Floß, das mittels einer ausgeklügelten Hydraulik den Seegang imitiert. Ein Schwanken zwischen Leben und Tod. Aber das stärkste Bild, das Fosses großartigem, vielschichtigem, an Beckett erinnerndem Text ganz nahe kommt, gelingt Chéreau gleich zu Anfang: Der Andere trägt den halbnackten Einen wortlos auf dem Arm, drei, vier Minuten lang, bevor er ihn in seinen wärmenden Pullover kleidet. Es wird vergeblich sein. Das Scheitern von Mitmenschlichkeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!