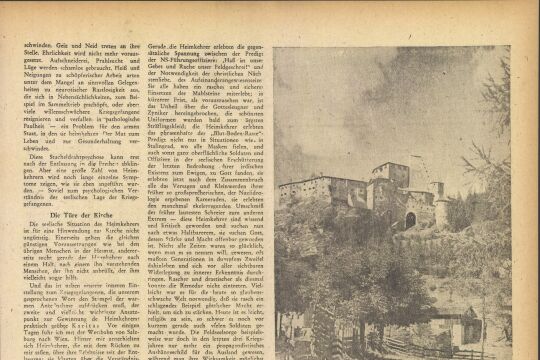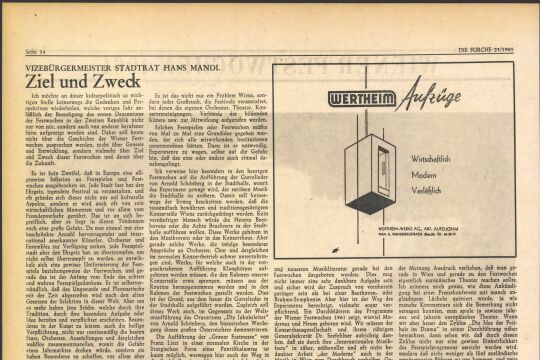Wiener-Festwochen-Bilanz 2011: Viele der Schauspielproduktionen handelten von den Grenzen des individuellen mit- und füreinander Lebenkönnens und auch -wollens.
In ihrem vorletzten Jahr als Schauspielchefin hat Stefanie Carp gezeigt, dass es dem aktuellen Theater durchaus darum geht, Zeitgenossenschaft zu behaupten. Dabei spannt sie den Bogen der Gäste und ihrer Produktionen zwischen Repräsentationsereignissen und eher ungewöhnlichen, unbekannten, neuen Projekten. So sind im Gesamtprogramm sowohl Inszenierungen von renommierten Regisseuren wie Christoph Marthaler, Robert Lepage, Frank Castorf, Patrice Chéreau, Andreas Kriegenburg, Alvis Hermanis oder von Festwochen-Intendant Luc Bondy selbst zu sehen gewesen. Nur wer Böses denken will, konnte dabei den Eindruck gewinnen, die big names seien nur deshalb vertreten, weil sie schon fast unweigerlich zur Geschichte des Wiener Festivals gehören und/oder Quote bringen sollten. Auch die Projekte der alten Meister zeugten von einem in der Häufigkeit kaum je da gewesenen Engagement, das sich nicht im Kunstwillen erschöpfte, sondern aktuelle Gesellschaftsanalyse leistete. Mit neuen interdisziplinären Projekten meist junger Künstler - etwa die Performance "Show Ghost“ des Wieners Jan Machacek oder Anton Tschechows "Kirschgarten“ in der Inszenierung des Finnen Kristian Smeds - boten die Wiener Festwochen heuer eine ausgewogene internationale Auswahl theatraler Auseinandersetzung mit Fragen nach Überlebensstrategien im Rahmen sozialer und ökologischer Engpässe, aber auch persönlicher Aufbruchssituationen.
Suche nach Glück
Hier wurde nicht nur Theater aus aller Welt zu einer thematischen Linie versammelt, sondern hier standen die Welt und ihre Ränder selbst im Zentrum. Die Terra incognita - sowohl geographisch gesehen, als auch auf die Komplexität des menschlichen Seins übertragen - zog sich durch fünf Wochen Festivalmarathon. Es wurde eine Welt gezeigt, deren Ränder sich zwar ökonomisch wie ökologisch massiv voneinander unterscheiden, in der sich die Konflikte aber auf der menschlichen, individuellen Ebene durchaus gleichen. Globalisiertes Theater. Die Suche nach dem Glück, nach lebendigen Beziehungen, nach erfahrbarem und verbindlichem Sinn, einem Ganzen in einer Welt, die vom Gesetz eines gnadenlosen Marktdenkens dominiert wird und nur mehr undeutlich wahrgenommen wird, kennzeichnete fast sämtliche Produktionen. Ob am Rand oder im Zentrum, in Fragen des Glücks und der transzendentalen Obdachlosigkeit gehören hüben wie drüben inzwischen so viele zum Prekariat.
Kornél Mundruczós "Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein“ aus Ungarn ebenso wie die amerikanische Version des Heldenmythos, der in Richard Maxwells "Neutral Hero“ an den Banalitäten des Alltags scheitert. Aber auch die deutsche Gegenwartsautorin Dea Loher erzählt in ihrer Szenenfolge "Diebe“ von den tragikomischen Versuchen ihrer Figuren, glücklich zu sein. Sie sind in ihren Überlebensstrategien zwar ökonomisch unabhängig, aber in ihrer Einsamkeit derart isoliert, dass jegliche Perspektive abhanden kommt. Die Instabilität der Wirklichkeit zeigt sich bei Loher in der kongenialen Inszenierung durch Andreas Kriegenburg in der Psyche der Figuren. Vom Blitz getroffen, gelingt ihnen dennoch ein Überleben, von den Freunden verraten, bleibt nur mehr der Sprung in die Tiefe. Bei Simon Stephens’ Bearbeitung von Jon Fosses eindringlichem Stück "I Am The Wind“ vermag auch Zuneigung und echte Freundschaft die innere Not des Freundes nicht auszugleichen. Auch in "The Sonic Life of a Giant Tortoise“ (Das Klangleben einer Riesenschildkröte) des japanischen Regisseurs Toshiki Okada sind die Figuren auf der Bühne aller Hoffnungen beraubt. Um weiterleben zu können, haben sie sich aus dem realen Leben in eine Welt aus Tagträumen zurückgezogen und vegetieren verlassenen Schildkrötenpanzern gleich nur mehr als leere Hüllen dahin.
Auffällig war, wie leise das zeitgenössische Theater von den eben kleinen Verwerfungen des Lebens berichtete. Kaum eine laute, polternde politische Geste war zu vernehmen, fast so als hätte das Theater sich als Medium, das Veränderung noch einfordern kann, verabschiedet. Kein Parolentheater, sondern fragile Menschendarstellung! Die Konflikte verbargen sich häufig kaum vernehmbar in rätselhaften Figurenkonstellationen und den wie beiläufigen Dialogen. So leise wurden die inneren Tumulte verhandelt, dass der Zuschauer sich nicht selten fragen konnte, wie etwa bei Simon Stephens’ großartigem Stück "Wastwater“, worum es denn eigentlich genau gegangen sei. In "A Castle of Dreams“ ist das Spiel schon gänzlich stumm. Man sieht einer Gruppe junger Menschen schlicht beim Nichtstun zu. Der Japaner Daisuke Miura entwickelt im transparenten Kobel ein trostloses Wohlstandsdesaster, das sich entlang einer fatalen Spirale aus Resignation, Perspektivelosigkeit und Langeweile spinnt.
Eigenartiger Realismus
Ivo van Hoves "Opening Night“ brachte die Entwicklung noch einmal auf den Punkt: Die Konflikte sind gänzlich ins Private gerutscht und so klein, dass der Regisseur eine Kamera benötigt, um sie erfahr- und sichtbar zu machen. All diese Beispiele offenbaren bei allen Unterschieden kleinste, detailgenaue Ausschnitte aus dem Leben und der Psyche verschiedenster Menschen, deren Konfliktpotential nur scheinbar wenig jenseits von "+-0“ zu sein scheint. Damit war die gleichnamige Eröffnungsproduktion von Christoph Marthaler fast schon eine programmatische Ansage.
Bei einer solchen Fokussierung überrascht es nicht, dass die großen ästhetischen Überraschungen und Experimente ausgeblieben sind. Es herrscht gegenwärtig im Theater ein eigenartiger Realismus vor, auch für die Belange der Zeit. Dabei zeigt das aktuelle Theater die Konflikte fast wie im richtigen Leben. Aber die Theatersituation genügt, um sie uns bewusst zu machen. Es braucht keine zusätzlichen dramatischen Vergrößerungen. Die diesjährigen Festwochen verlangten den Zuschauern einiges ab. Wer (nur) Spaß und gute Unterhaltung haben wollte, wurde meistens enttäuscht. Es gab viel gutes und manch sehr gutes Theater, dessen programmatische Auswahl insgesamt nicht dem Kalkül des Gefallenwollens untergeordnet wurde, das aber, auch wenn es das vielleicht nicht wollte, eines konnte: eine Art Schule der Wahrnehmung zu sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!