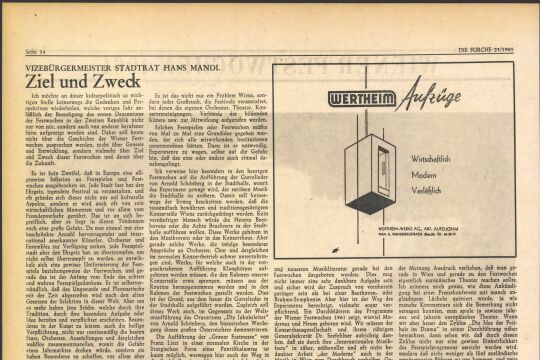Das Schauspielprogramm der Wiener Festwochen, das heuer zum letzten Mal von Stefanie Carp verantwortet wurde, bot einmal mehr einen spannenden Mix unterschiedlichster Produktionen.
Auf die Wiener Festwochen ist Verlass. Neben den Fixstartern - gleichsam einem Rotationsprinzip folgend waren in den letzten Jahren Ariane Mnouchkine, Simon McBurney, Christoph Marthaler, Rimini-Protokoll, Sebastian Nübling, Frank Castorf, Alvis Hermanis, Robert Lepage (wobei die drei Letztgenannten heuer nicht dabei waren) zu Gast - galt das Interesse in diesem Jahr der Erkundung von abseitigen Theaterlandschaften und Formaten. Genauer gesagt führten uns die Festwochen in die theatertopografischen Problemzonen der jungen Demokratien in Europa und Südamerika mit einigen Abstechern nach Afrika und Asien.
Stefanie Carps Programm fokussiert dabei aber weniger neue, ästhetisch gewagte Positionen als vielmehr ein dezidiert politisches Theater, das nicht die großen Fragen und Utopien, sondern das alltägliche Leben des Einzelnen in einer unsicheren Gegenwart reflektiert. Wobei die komplexe Wirklichkeit auch neue, innovative Bühnensprachen nicht ausschließen, sie teilweise sogar erfordern würde.
Dokumentartheater im besten Sinne
Mit der Ausgabe 2012 präsentierten sich die Festwochen erneut als Festival mit vorhersehbar hoher Qualität sowie erfreulich großer Risikobereitschaft. Dabei ist das nicht allein in dem Sinne gemeint, dass etwa die drastische und kontrovers zu diskutierende Dramatisierung von Coetzees Nobelpreisroman "Schande“ des ungarischen Regisseurs Kornél Mundruczós in Wien uraufgeführt wurde, obwohl sich die Produktion dezidiert an ein ungarisches Publikum wendet. Das Risiko liegt hier vielmehr darin, dass die Festwochen damit eine länderübergreifende kulturpolitische Aufgabe übernehmen, nämlich einem interessanten, als "unbequem“ weil als kritisch geltenden Künstler ein Forum geben, der im eigenen Land durch ökonomische Aushungerung mundtot gemacht werden würde. Ähnlich verhält es sich vermutlich auch mit dem theaterpädagogischen Projekt "Krizis“ von Árpád Schilling, das die schwierige Situation von Jugendlichen in einem Dorf in Südungarn behandelt. Als Format ist "Krizis“ zwar nicht unbedingt festwochentauglich, der Wert der Aufführung ist für die Mitspielenden wohl höher als für die Betrachtenden. Die Einladung ist aber in jenem Sinn nachvollziehbar, da sie sowohl die prekäre, problematische Situation Ungarns reflektiert als auch das Weiterarbeiten eines wichtigen Theaterleiters ermöglicht.
Ebenso steht die chinesische Produktion "Memory“ aus Peking für die-se Linie. Das Stück des Living Dance Studio ist Dokumentartheater im besten Sinne und thematisiert - nicht zuletzt durch das Zeigen eines bis heute in China verbotenen Films - die von der chinesischen Öffentlichkeit noch immer tabuisierten komplexen Vorgänge um die Roten Garden während der Kulturevolution der Jahre 1966 bis 1976. Die Erinnerungsarbeit steht aber gleichsam nicht für eine verbitterte Wahrheitssuche jenseits des offiziellen Geschichtsnarrativs, als vielmehr für die Konstruktion einer eigenen "wahrhaftigen“ Identität. Dieser Umstand ist fast paradigmatisch für eine Tendenz im heurigen Schauspielprogramm. Denn auch der lateinamerikanische Autorentheaterschwerpunkt "Das Leben danach“ (s. FURCHE Nr. 23, S. 13) hat anhand von Erinnerungsreisen durch das Leben und Schicksal der Eltern individuelle Geschichten in "der“ Geschichte gezeigt und zuerst der Spurensuche nach der eigenen Identität gedient.
Nicht die großen gesellschaftlichen Fragen standen im Zentrum. Und schon gar nicht die positive Formulierung von Utopien, außer vielleicht bei Ariane Mnouchkine, die in "Schiffbruch mit verrückter Hoffnung“ über den Umweg des frühen Films fast naiv an die einstigen humanistischen Ideale erinnerte.
Kein richtiges Leben im falschen
Daher fokussierten viele Produktionen auf die Auswirkungen der großen politischen, ökonomischen Erschütterungen, die bis in die individuellen Biografien durchschlagen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Und: Wie kann Zukunft aussehen, wenn die Vergangenheit vergessen, ausgeblendet wird? Die Performance "Ganesh versus The Third Reich“ aus Australien bringt die sadistischen Machtspiele des Regisseurs mit den Gewaltverbrechen Hitlers zusammen und zeigt geschichtsvergessenes Verhalten von Menschen in der Gruppe, wobei - besonders heikel - alle Akteure (außer dem Regisseur) mit Tourette- und Downsyndrom gehandicapt sind. Auch Filmregisseur Ulrich Seidl bricht die Schranken zwischen Berufsschauspielern und Laien auf und schafft Verständnis für eigene und fremde Verhaltensweisen: In "Böse Buben“ nach David Foster Wallaces "Interviews mit fiesen Männern“ thematisiert er (österreichische) Kellerfantasien. Der Rückzug ins Private gebiert Ungeheuer, konstatiert auch der Kinderpsychiater und Autor Paulus Hochgatterer in "Makulatur“. Der Abstieg in den Keller dient hier nicht der Aufarbeitung des Unbewussten, sondern vielmehr der Perpetuierung unterdrückter Triebvorstellungen und Machtgelüste.
Zwischen Glaube, Liebe, Hoffnung
Das Ergebnis anhaltender Krisen-Erfahrungen ist offenbar die Forderung nach der augenblicklichen, individuellen Glückserfüllung. Unter dem Diktat des hic et nunc werden auch menschliche Beziehungen als Selbstbedienungsladen wahrgenommen. Dementsprechend wiederholt die Protagonistin Elisabeth in Horváths "Glaube Liebe Hoffnung“ bis zuletzt "nur nicht den Kopf hängen lassen“, auch wenn sie längst nicht einmal mehr etwas zu fressen hat. Christoph Marthaler verbindet Horváths Elisabeth mit dem internationalen Mädchenhandel, wo jungen Frauen oft nichts anderes mehr bleibt, als den Körper, die eigene nackte Existenz, in die Waagschale zu werfen. In die Mühlen einer inhumanen Bürokratie geraten, wird vor der Folie der Wirtschaftskrise falsches Mitleid und soziales Unrecht noch deutlicher sichtbar. Nach Elisabeths Selbstmordversuch fischt der ehrgeizige Lebensretter Joachim gleich fünf Mädchen aus dem Wasser, da sind scheinbar schon mehrere ohne Hoffnung.
Das Schauspiel der Festwochen hat sich auch heuer mehr denn je als Medium behauptet, das Verborgenes freilegt und tabuisierte Themen sichtbar macht. Damit offenbarte Stefanie Carp ein Verständnis von Theater, das gesellschaftlich relevante Einmischung einfordert. Mit ihr geht eine bedeutende Ära zu Ende. Die Hoffnung - obwohl die Zukunft auch nicht mehr das ist, was sie einmal war, wie Karl Valentin diese Festwochen zusammengefasst hätte - richtet sich auf eine Nachbesetzung mit dem Blick auf lebendiges Theater.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!