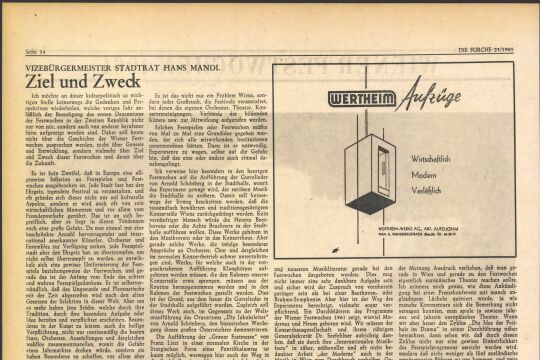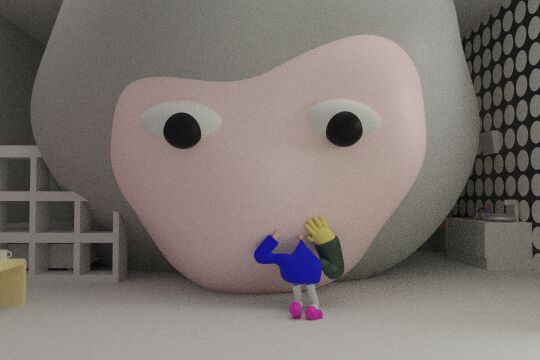Gut besucht waren bei den Wiener Festwochen 2018 über weite Strecken nur die Partys, bei denen sich das anvisierte Jungpublikum zur Clubkultur einfand.
Tomas Zierhofer-Kin zog nach den Festwochen 2018, die er heuer zum zweiten Mal verantwortete, Konsequenzen und erklärte am Montag seinen Rücktritt. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf Scholten, dem Geschäftsführer der Wiener Festwochen Wolfgang Wais sowie der Kulturstadträtin der Stadt Wien, Veronica Kaup-Hasler, wird sein für fünf Jahre laufender Vertrag (bis 2022) nun aufgelöst.
Trotz der Verbesserungen zum Vorjahr, trotz der künstlerischen Auseinandersetzungen mit unserer Zeit wurde das Versprechen nur teilweise gehalten, ein außergewöhnliches FEST zu bieten, das in und über Wien hinaus wirkt.
Plakate und Banner rund um das MuseumsQuartier Wien warben für das FEST. Allerdings gab es während der fünf Wochen hier kaum etwas zu sehen. Denn wie schon in seinem ersten Jahr erschloss Zierhofer-Kin für die Festwochen Räume abseits des Zentrums, wie etwa die Liesinger Sargfabrik F23 oder die Gösserhallen im 10. Bezirk, die Schauplatz einiger FEST-Produktionen waren. Dass er damit wirklich die Favoritner und Menschen aus einem kulturellen und sozialen Milieu erreichte, denen der Besuch der traditionellen Kunsttempel in der Innenstadt eher schwer fällt, lässt sich bezweifeln. Doch Zierhofer-Kins Anspruch, "niederschwelliges Theater" zu machen, blieb weitgehend aufrecht und fand auch heuer in der moderaten Preisgestaltung seinen Niederschlag. Gut besucht waren dort über weite Strecken nur die Partys, bei denen sich das anvisierte Jungpublikum zur Clubkultur einfand.
Wehmütige Reminiszenzen
Die Konsequenzen, die Zierhofer-Kin aus der heftigen Kritik seiner ersten Ausgabe gezogen hat, spiegelten sich im Programmheft und in Interviews. Hier wählte er ein deutlich dezenteres Wording - dass die Beschreibungen in den Programmzetteln allerdings oft wenig mit den tatsächlichen Produktionen zu tun hatten, steht auf einem anderen Blatt. Zierhofer-Kin verabschiedete sich auch von Programmschienen, wie etwa der "Akademie des Verlernens" oder dem "Performeum" mit Lectures und hochtrabenden, modischen Diskursevents. Und er mischte das Programm mit Versatzstücken, die vage an vergangene Festwochen vor seiner Zeit erinnerten. So muss wohl die Einladung von Christoph Marthalers wunderbar melancholischer wie witziger Inszenierung "Tiefer Schweb" verstanden werden, wirkte sie doch innerhalb des Programms wie eine wehmütige Reminiszenz. Buchstäblich diente das im Untertitel als "Auffangbecken" bezeichnete Stück dem Intendanten vor allem dazu, entlaufene Festwochenbesucher wieder einzufangen.
Ein ähnliches Kalkül kann mutmaßlich auch für die Programmierung der Musiktheater-Produktionen geltend gemacht werden, ohne dass die nur darin ihre Berechtigung gefunden hätten. Hans Zenders komponierte Interpretation von Schuberts "Winterreise" beschwichtigte nicht nur die Musiktheaterfans, mit dem Regisseur Kornél Mundruczó war wieder ein renommierter früherer Festwochengast in Wien. Die "Trojan Women" der National Changgeuk Company of Korea bescherten den Besuchern ein ungewohntes Hörund mit der interkulturellen Theatersprache des Regisseurs Ong Keng Sen auch neues Seherlebnis, das darüber hinaus als starkes künstlerisches Statement gegen die Grausamkeiten von Kriegen gelesen werden konnte.
Mit Tanztheater-Produktionen, wie Boris Charmatz' Wimmelbild "10000 gestes" oder Gisèle Viennes "Crowd", die man eher beim anstehenden ImPulsTanzfestival erwarten würde, fischte der Intendant in 'fremden' Zuschauerteichen.
So viel Gewalt war noch nie
Zierhofer-Kin übte sich im Spagat zwischen Kompromissen, die der Lerneffekt notwendig mit sich brachte, und eigenen Ansprüchen, etwa mit politisch motivierter Kunst einen Blick in die Welt und deren Komplexität zu wagen. Dass der Blick die Besucher veranlasst, "von einer neuen, anderen Welt nicht nur zu träumen", wie es im Programmbuch heißt, sondern diese zu einem Besseren hin zu verändern, kann dem Intendanten, sollte das ausbleiben, selbstverständlich nicht angelastet werden.
Als eines der auffälligsten Phänomene in der künstlerischen Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart erwies sich das Zeigen von Gewalt in ihrer Verstrickung in historische, politische und private Zusammenhänge. Dabei beließen es die Künstler oft nicht nur dabei, Gewalt zu zeigen, sondern im Sinne der gegenwärtig viel diskutierten immersiven Praktiken wurden mehrere Sinne adressiert (Kurt Hentschlägers "FeedX") oder eingewoben, wie etwa in "The Walking Forest" sowie in Charmatz' "A Dancer's Day", worin die Zuschauer zu Darstellern wurden. Frei nach Straubs/Huillets Worten, wonach nur Gewalt hilft, wo Gewalt herrscht, konnte das Filmscreening der Saloon-Szene aus Paul McCarthys mehrteiligem Work-in-Progress "CSSC/DADDA Vienna Edit" ("Coach Stage Stage Coach /Donald And Daisy Duck Adventures") verstanden werden. Das wüste, pornografische Porträt der gegenwärtigen US-amerikanischen Gesellschaft war nicht nur eine Ansammlung exzessivster Gewaltdarstellung, sondern erwies sich in seiner Drastik selbst als Gewaltakt gegenüber dem Publikum. Ähnlich präsentierte sich auch die verstörende fünfstündige Performance "Häusliche Gewalt" des Schweden Markus Öhrn. Die Kunst seiner denkwürdigen Arbeit liegt darin, dass er eine Spirale der Gewalt entwickelt, ohne sie einem voyeuristischen Blick anzudienen. Die dafür angewendeten Mittel waren die Dauer und der Verzicht auf eine Dramaturgie, Musik, die fast kontrafaktisch zum Geschehen live gespielt wurde, sowie die Stummheit der beiden fabelhaften Darsteller, was die Gewaltakte jäh erscheinen ließ. Die riesigen Pappköpfe unterliefen jegliche Form von Personalisierung und Psychologisierung des Spiels.
Seltsam kalt
Überhaupt die Masken: Augenscheinlich war die Präsenz von Masken und Puppen, mit der viele Produktionen ihr Personal gleichsam entindividualisierten und sie als Gemeinschaft, als kollektiv Betroffene zeigen. Bei Ersan Mondtags Inszenierung der "Orestie" offenbarte sich dieser Trend zuerst. Denn von oben, von einer göttlichen Perspektive aus betrachtet, sind die Menschen nichts als auf ihren Vorteil bedachte Ratten, die über kein demokratisches Verständnis verfügen. Eine solche Typisierung oder Anonymisierung der Darsteller nutzten auch andere Inszenierungen, etwa "La Plaza" des angesagten Künstlerduos El Conde de Torrefiel, die ihre Wirkung allerdings nicht voll entfalten konnte, weil mit dem Theater Akzent ein mehr als ungeeigneter Aufführungsort dafür gewählt worden war. Auch das Musical "The 2nd Season" arbeitete mit Puppen und erzählte auf unterhaltsame Weise von Waldtieren, die sich in Außerirdische verlieben und zugleich Kapitalismuskritik üben. In "The Suicide Sisters" der deutschen Regisseurin Susanne Kennedy treten vier Akteure mit Maske auf. Sie repräsentieren keine Figuren, sondern präsentieren vielmehr grenzüberschreitende Positionen ungeahnter Möglichkeiten. Diese problematisieren auch die Frage, was es bedeutet, wenn sich pubertierende Mädchen im Netz zeigen, und welche Konsequenzen eine unkontrollierbare anonyme, digitale Welt bringen kann. Trotz des brisanten Themas blieben "The Suicide Sisters" seltsam kalt. Dieser Schluss lässt sich für viele Arbeiten ziehen.
Dass die Reform seiner Reform vom letzten Jahr nicht gelingen wollte, zeigte sich an der "fehlenden Resonanz", so Zierhofer-Kin in seiner Rücktrittserklärung. Tatsächlich blieb es auch heuer mehr bei den Ankündigungen des FESTES.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!