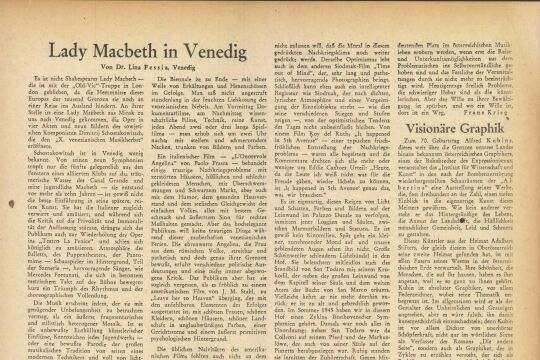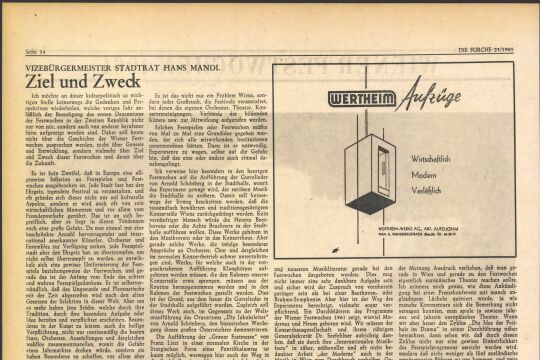Die Wiener Festwochen 2010 haben zwei Drittel ihrer Premieren hinter sich. Was lässt sich nach vier Wochen sagen? Was thematisieren die Festwochen und wie? Inhaltlich sind es Fragen der Identität, der zwischenmenschlichen Kommunikation, der Suche nach dem gelingenden Leben – formal dominieren Großprojekte.
Wer im Mai die meiste Zeit im Dunkel des Zuschauerraums sitzend verbracht hat, dem fiel das schlechte Wetter kaum auf, es sei denn der extreme Niederschlag hat selbst eine Theatervorstellung unterbrochen. Denn die Schauspieldirektorin Stefanie Carp verlangt dem Festwochenpublikum heuer einiges ab. Neben den inhaltlichen Schwerpunkten – den Fragen nach der Identität, dem Familienleben, der zwischenmenschlichen Kommunikation oder der Suche nach dem gelingenden Leben – dominieren formal betrachtet Großprojekte, außergewöhnliche, mehrstündige Theatermarathons, die so etwas wie einen Meditationscharakter aufweisen: achteinhalb Stunden „Lipsynch“, acht Stunden „Factory 2“, zwölf Stunden „I demoni“.
Längst vergangene Parallelwelten
Was steckt hinter dieser Tendenz? Robert Lepage und Peter Stein erzählen große Epen, erzeugen Welten, die eine Ganzheit beanspruchen und ein Bild schaffen, das aus verschiedenen Perspektiven einer Idee folgt oder führen in längst vergangene Parallelwelten, wie etwa der polnische Regisseur Krystian Lupa in Andy Warhols Factory mit ihrem vermeintlich glamourösen Lebensstil, wo der einstige Superstar der Popkunst sich von 1963 an den Nihilismus der Massengesellschaft zu eigen machte und das Gewöhnliche zur hohen Kunst transformierte. Wie Warhols Bilder – und noch deutlicher seine Filme – der Realität weder etwas hinzufügen noch ihr etwas wegnehmen, sondern sie passiv reproduzieren, verfährt Lupa in seiner als Reenactment bezeichneten Inszenierung. Er zeigt das seelenentblößende Treiben der bunten Schar exzentrischer Bohemiens in der Factory mit dem Gestus „so war es“ und verzichtet auf moralisches Urteilen. Damit ist er nah an Warhol, indem er das Theater nicht als Instrument der Repräsentation, der Weltdeutung oder gar als Ort für utopische Visionen versteht. Acht Stunden „Factory 2“ ist bloße Nachahmung, nicht Erfindung, sondern Wiederholung.
Zugleich haben diese Langproduktionen auch einen elitären Charakter, denn nur eingefleischte Gruppen von „Theateraficionados“ leisten es sich, gemeinsam einen ganzen Tag im Dunkel des Theaterraums zu verbringen, um in fremd(sprachig)e Welten einzutauchen – und es ist gut zu beobachten, wie der fast durchwegs frenetische Applaus des zwischenzeitlich erschöpften Publikums am Ende nicht ausschließlich der Produktion und ihren Darstellern, sondern stets auch sich selbst gilt.
Daneben konfrontiert das Programm der Festwochen die Zuschauer auch mit Lebenswelten, die das soziale Elend der Unterklassen zeigen, wie in Kornél Mundruczós wuchtiger, fast neorealistischer und überaus körperbetonter Inszenierung „A jég – Ljod. Das Eis“ oder in der künstlerisch und konzeptionell wenig überzeugenden Site-specific-Produktion „Hass“ von Volker Schmidt. Für diese Produktion, die vorgibt eine Adaption des gleichnamigen französischen Kultfilms aus den 1990er Jahren von Mathieu Kassovitz zu sein (mit dem Film und seiner aufregenden Montage aber tatsächlich wenig zu tun hat), wo das Schicksal entwurzelter, arbeits- und zukunftsloser Jugendlicher mit Migrationshintergrund in Szene gesetzt wird, wurden eigens neue, ungewöhnliche Orte erschlossen, um die Fragen der Festwochen mit Wiens Wirklichkeit zu verbinden. Die Idee, im heruntergekommenen Gelände des aufgelassenen Gaswerks in der Leopoldau die Pariser Banlieues zu behaupten, ist zwar grundsätzlich interessant, hat aber mit Wiens tatsächlichen Problemen kaum etwas zu tun. Die verwahrlosten Räume des Gaswerks mit ihren funktionsuntüchtigen Nassräumen haben den vergammelten Chic einer Bühne, die von Anna Viebrock stammen könnte. Lange schon hat das Theater den Zauber ehemaliger Fabrikshallen als Spielstätten entdeckt, und noch länger schon benutzt der Film solche Locations. Dieser Schachzug funktioniert immer wieder: Einerseits suggerieren sie Authentizität, andererseits wirkt der Kontrast, einstige Orte der Werktätigkeit in ihrer jetzigen Leere durch Kunst wieder mit Leben zu füllen. Doch wenn die binnendeutschen Schauspieler „Mensch, die Bullen kommen“ brüllen, als sie versuchen, ein Auto zu knacken, weiß man endgültig, dass Volker Schmidt hier nicht viel mehr als Klischees präsentiert.
Weitaus einfallsreicher geht die Koreanerin Young Jean Lee an die Frage nach der Hautfarbe und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Wirklichkeit in „The Shipment“ heran: Lee und ihre Company nehmen Erwartungshaltungen zynisch aufs Korn. Im brut ist eine Black box installiert, auf der ein schwarzer Entertainer sich als Comedian produziert. Er überhöht bitterböse an die Hautfarbe gekoppelte sexuelle Zuschreibungen und erzeugt jenes peinliche Schweigen der Empörung im Zuschauerraum, das tatsächliche Vorurteile entlarvt. Doch im Moment der Betroffenheit bricht Lee die Szene auf, lässt junge Schwarze rappen, mit Drogen dealen und comicartig schwarz-weiße Stereotypen auftreten. Am Ende spielen sie ihre Vorstellungen von langweiligen Parties weißer Mittelstandsbürger nach, die die schauspielerische Stärke des Ensembles unter Beweis stellen.
Wenn der Mensch zum Tier wird
Die Bedeutung der Hautfarbe ist auch Thema von „Othello, c’est qui?“. Während Othello als Paradeschwarzer der europäischen Literatur- und Kulturgeschichte gilt, ist er in Afrika mehr oder weniger unbekannt. Der von der Elfenbeinküste stammende Tänzer und Schauspieler Franck Edmond Yao hat mit der deutschen Schauspielerin Cornelia Dörr ein Duo gebildet, das Othellos Geschichte ins Heute tanzt.
Vitalität und radikale Lust am Spielen, Tanzen und Performen verbinden die Inhalte und die künstlerische Umsetzung von „more more more … future“ des kongolesischen Regisseurs Faustin Linyekula – während die Kanadierin Marie Brassard in ihrem Soloprojekt „Me talking to Myself in the Future“ mittels Stimmverfremdung die Grenzen ihres Ichs zu sprengen sucht.
Die Frage danach, was der Mensch ist, stellt die amerikanische Choreografin Meg Stuart in „Do Animals Cry“. In einer zweieinhalbstündigen pausenlosen Szenenfolge stellen sechs virtuose Performer ihres Ensembles Damaged Goods eine Familie dar und zeigen die tief im Seelenleben der Menschen schlummernde Ambivalenz der Emotionen. So schrammt Fürsorge bei Stuart stets knapp an Gleichgültigkeit vorbei, kann Liebe zugleich zärtlich und brutal sein, ist Nähe im nächsten Moment nur allzu schnell eine unüberbrückbare Ferne. In der Schicksalsgemeinschaft Familie, so die Botschaft, ist der Mensch offenbar ein Tier.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!