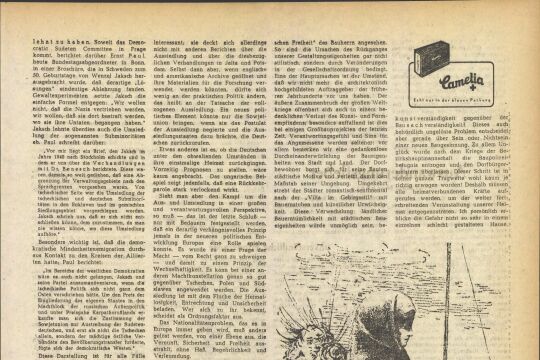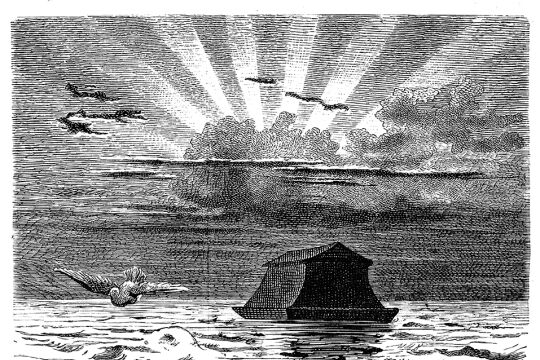Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise ist auch eine Krise des Theaters: Weil ihm die Darstellung einer völlig außer Rand und Band geratenen Wirklichkeit kaum mehr gelingen kann. Das Theater wird solcherart auf sich selbst zurückgeworfen.
Theater und Krise sind einander nicht fremd. Heiner Müller meinte sogar, das Theater könne nur als Krise und in der Krise funktionieren, sonst habe es überhaupt keinen Bezug zur Gesellschaft außerhalb seiner selbst.
Am häufigsten spricht man im Zusammenhang mit dem Theater dann von Krise, wenn es ums Geld geht. Nicht nur in Österreich, wie beispielsweise die Diskussion um die Subvention der Salzburger Festspiele zeigt, auch in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich wird gegenwärtig viel darüber gesprochen, wie es angesichts der knappen Haushalte mit den Theatern weitergehen soll. In Zeiten notorisch leerer Kassen sieht man in der Kultur am ehesten Einsparpotenziale, zumal sich der breiten Masse der Ruf des Theaters gut verkaufen lässt, es sei ein elitäres Kulturinstitut und seine Subventionierung daher Finanzierung des luxuriösen Vergnügens einer gebildeten Minderheit. Im gleichen Atemzug taucht dann immer wieder das Argument auf, in Krisenzeiten gebe es wichtigere Bereiche, für die das knappe Geld einzusetzen sei. Andere dagegen meinen, gerade in prekären Zeiten sei die Notwendigkeit gekommen, in die verbliebenen ideellen Ressourcen zu investieren, und sehen in den Stadttheatern, besonders jenen weitab der kulturellen Hochburgen, wichtige Bastionen, um der um sich greifenden Verödung der Städte entgegenzuwirken. So bleibt der Kampf zwischen scheinbar unausweichlichen ökonomischen Erfordernissen und kultureller Besitzstandwahrung zunächst unentschieden.
Kulturkampf anderer Art
Das Wort von der Krise taucht aber im Zusammenhang mit dem Theater auch häufig dann auf, wenn es um das Theater selbst geht. Damit ist aber hier nun weniger die ästhetische Krise in dem Sinne gemeint, in welchem dem Theater in regelmäßigen Abständen seinen angeblich anachronistischen Charakter vorhalten zu müssen geglaubt wird und ihm sein baldiges Ableben prophezeit wird. Hier ist ein Kulturkampf anderer Art gemeint, der gegenwärtig besonders heftig um das Theater tobt und ein für unsere Zeit symptomatisches Unbehagen offenbart. Nicht erst seit Daniel Kehlmanns Salzburger Rede 2009 beklagen verstörte Theaterbesucher wie auch so mancher Kritiker, was sie auf der Bühne geboten bekommen. Das zielt weniger auf die Gegenwartsdramatik und deren triste Zustandsgeschichten, den fundamentalen Geschichtspessimismus oder die nihilistischen Weltbetrachtungsweisen, als auf das, was junge Regisseure mit den vermeintlichen Klassikern machen.
Unterbrechung des Gewohnten
Mit gesteigerter Wut wird konstatiert, das ehrwürdige Theater sei in Händen einer Schar ich-süchtiger Regie-Berserker, frivoler Gotteslästerer, perverser Schmuddelbuben und geistloser Provokateure, denen es nicht um das Erzählen einer Geschichte gehe und die weder die Pflege der Tradition noch die Schönheit im Sinne hätten, sondern vielmehr allein den Exzess. Die Beschwerden darüber, dass auch anständige Stücke häufig unanständig inszeniert würden, wie ein berühmt gewordenes Bonmot des ehemaligen Bürgermeisters von Hamburg Klaus von Dohnanyi meinte, häufen sich. Der Vorwurf, dass Provokateure allein die Erregung als Maßstab für die Qualität einer Aufführung nehmen, mag ja von Fall zu Fall berechtigt sein, um die soll es hier aber nicht gehen. Wenn aber jenseits davon das Unbehagen gegenüber dem modernen Theater so heftig geäußert wird und Theater als Hort der Klassikerpflege so vehement eingefordert wird, handelt es sich da einerseits um ein Missverständnis, da auch den Klassikern keine ewige Wahrheit inhärent ist. Und wird hier nicht das Wesentliche von Theater gerade verfehlt und werden die ernst zu nehmenden Theaterregisseure nicht stellvertretend abgestraft, weil man den eigentlichen Grund des Missfallens nicht wahrhaben will? Nämlich die Realität, in der wir leben.
Denn es ist seit jeher die Aufgabe des Theaters gewesen, die Welt zu betrachten, die gesellschaftlichen Zustände und Prozesse abzubilden. Wie alle Kunst unterbricht es die Automatismen der Alltagswahrnehmung und macht die Wirklichkeit dadurch frag- und diskussionswürdig. Aber angesichts der undurchdringlichen Wirklichkeit, wie sie uns zuletzt durch die Finanzmarktkrise von Neuem offenbart wird, ist eine sinnstiftende Erzählung von Zusammenhängendem kaum mehr haltbar. Denn wie lassen sich der globale Kapitalismus und seine erodierenden moralischen Formen darstellen? Wie lässt sich der Marktfundamentalismus, in dessen Namen über Jahre gewachsene soziale Strukturen zugunsten kurzfristigen Gewinns planiert worden sind, mit einer Traumfabrik namens Börse, mit Fondsmanagern auf der einen Seite, die nicht nur auf steigende Gewinne der „virtuellen Ökonomie“ spekulierten, sondern auch immer neue, absurdere Finanzprodukte erfanden, die sie letztendlich selber nicht mehr beherrschen konnten, und auf der anderen Seite mit Anlegern und ihrer kurzzeitigen Hoffnung auf Wohlstand und mit Schuldnern und ihrem Leben auf Pump, auf die Bühne bringen? Wie kann dieses Diffus-Abstrakte, wo durch hochkomplexe Spekulationen und vernunftwidrige Wetten riesenhafte Pseudovermögen „vernichtet“ wurden, mit den Mitteln des Theaters noch abgebildet werden?
Krise ist überall
Sicher wird es mehr Stücke geben, die das Innenleben und die Antriebe der Manager, die Psychologie des Bereicherungstrips und vielleicht die Mikroebene der ökonomischen Weltanschauung zum Thema haben, aber es sind nicht einmal Verursacher von Opfern eindeutig zu trennen. Unsere Welt hält keinen Ausweg aus den Widersprüchen mehr offen. Gut und Böse hat sich in Unentscheidbarkeit aufgelöst. Und weil es kein klar verantwortliches Subjekt mehr gibt – denn keiner ist schuld, alle sind Opfer und Täter gleichermaßen –, verschwindet auch die Möglichkeit von Utopie. Damit wird auch die Wirklichkeit als veränderbare verabschiedet. Zu diesem Mangel an Utopie kommt das Fehlen von Modellen des solidarischen Sich-zur-Wehr-Setzens. Das ist auch der Grund dafür, dass es auf der Bühne kaum mehr Revolutionäre gibt. Sondern nur noch das Gegenteil davon: beschädigte Biografien, sozial Isolierte mit einem diffusen Unbehagen an den sinnentleerten Formen menschlichen Zusammen-Lebens, Sadisten, Depravierte, Amokläufer.
In diesem Sinne könnte man sagen, die Finanzmarktkrise ist auch eine des Theaters, weil ihm die Wirklichkeitsbeschreibung kaum mehr gelingen kann. Daher ist das Theater heute nicht selten damit beschäftigt, seine eigenen Mittel und Möglichkeiten zu erforschen. Anders gesagt heißt gegenwärtig die Welt abbilden deren Unübersichtlichkeit, Zerrissenheit und Abgründigkeit offenlegen. Und die schlägt durch bis in die Form. Krise ist überall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!