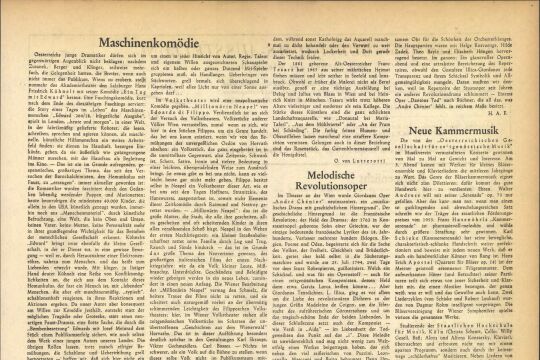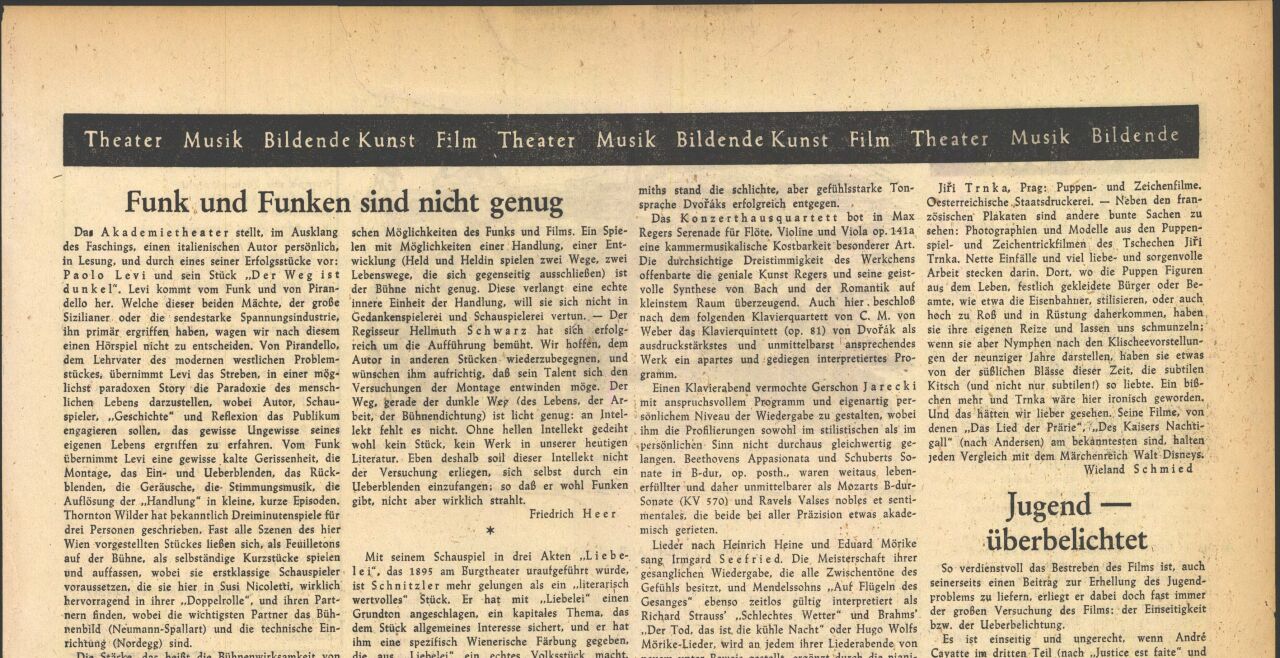
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Funk und Funken sind nicht genug
Dar Akademietheater stellt, im Ausklang des Faschings, einen italienischen Autor persönlich, in Lesung, und durch eines seiner Erfolgsstücke vor: Paolo Levi und sein Stück „Der Weg ist dunkel“. Levi kommt vom Funk und von Piran-dello her. Welche dieser beiden Mächte, der große Sizilianer oder die sendestarke Spannungsindustrie, ihn primär ergriffen haben, wagen wir nach diesem einen Hörspiel nicht zu entscheiden. Von Pirandello, dem Lehrvater des modernen westlichen Problemstückes, übernimmt Levi das Streben, in einer möglichst paradoxen Story die Paradoxie des menschlichen Lebens darzustellen, wobei Autor, Schauspieler, „Geschichte“ und Reflexion das Publikum engagieren sollen, das gewisse Ungewisse seines eigenen Lebens ergriffen zu erfahren. Vom Funk übernimmt Levi eine gewisse kalte Gerissenheit, die Montage, das Ein- und Ueberblenden, das Rückblenden, die Geräusche, die- Stimmungsmusik, die Auflösung der „Handlung“ in kleine, kurze Episoden. Thornton Wilder hat bekanntlich Dreiminutenspiele für drei Personen geschrieben. Fast alle Szenen des hier Wien vorgestellten Stückes ließen sich, als Feuilletons auf der Bühne, als selbständige Kurzstücke spielen und auffassen, wobei sie erstklassige Schauspieler voraussetzen, die sie hier in Susi Nicolet'ti, wirklich hervorragend in ihrer „Doppelrolle“, und ihren Partnern finden, wobei die wichtigsten Partner das Bühnenbild (Neumann-Spallart) und die technische Einrichtung (Nordegg) sind.
Die Stärke, das heißt die Bühnenwirksamkeit von „Der Weg ist dunkel“ liegt in seiner Funktechnik, die Schwäche, die Substanzschwäche, liegt darin, daß zumindest in diesem Stück der Autor seinem großen Vorbild, Pirandello, in keiner Weise gewachsen ist. Wenn man die Gags, das Verblüffende abzieht, den Zauber des Funks und die Funken, die Lichter und das Ein-, Ab- und Rückblenden, bleiben undichte Worte und eine Fehlkonstruktion. Der' Mensch löst sich nicht wie eine Zwiebel in die hier vorgestellten kalten Lichter, Täuschungen und Selbsttäuschungen auf: noch sein Trug und seine Selbsttäuschung sind tiefer, als es das Gerede und kalte Morden hier auf der Bühne wahrhaben wollen. Wobei die Fehlkonstruktion des Haupteffekts in diesem Stück die Fehlkonstruktion des Ganzen blitzhaft aufzeigt: Grazia, die „Heldin“, läßt durch ihren Mann ihren wohlhabenden Geliebten ermorden, um ihm seine Schecks, lautend auf drei Millionen, zu rauben. ie hat alles genau vorberechnet: ihr Freund Matteo wird in die tödliche Falle gelockt, da sie ihm vorgespielt hat, sie werde mit ihm ins Ausland fliehen. Freund kommt, Gatte schießt; Freund tot, Grazia nimmt die Schecks an sich, ruft Polizei an, um einen nächtlichen Einbruch vorzutäuschen; Gatte habe in NoMrthreHsndelt. Bei welcher iBank- wird sieanl nächsten Tage die vorn eben Ermordeten Unterzeichneten Schecks einlösen können ... ? Diese „kleine“ Fehlrechnung deutet die größere an: der Autor ließ sich, so scheint es, selbst blenden von den techni-
sehen Möglichkeiten des Funks und Films. Ein Spielen mit Möglichkeiten einer Handlung, einer Entwicklung (Held und Heldin spielen zwei Wege, zwei Lebenswege, die sich gegenseitig ausschließen) ist der Bühne nicht genug. Diese verlangt eine echte innere Einheit der Handlung, will sie sich nicht in Gedankenspielerei und Schauspielerei vertun. — Der Regisseur Hellmuth Schwarz hat si'ch erfolgreich um die Aufführung bemüht. Wir hoffen, dem Autor in anderen Stücken wiederzubegegnen, und wünschen ihm aufrichtig, daß sein Talent sich den Versuchungen der Montage entwinden möge. Der Weg, gerade der dunkle Weg (des Lebens, der Arbeit, der Bühnendichtung) ist licht genug: an Intellekt fehlt es nicht. Ohne hellen Intellekt gedeiht wohl kein Stück, kein Werk in unserer heutigen Literatur. Eben deshalb soll dieser Intellekt nicht der Versuchung erliegen, sich selbst durch ein Ueberblenden einzufangen; so daß er wohl Funken gibt, nicht aber wirklich strahlt.
Friedrich Heer
Mit seinem Schauspiel in drei Akten „Lieb e-let“, das 1895 am Burgtheater uraufgeführt wurde, ist Schnitzler mehr gelungen als ein „literarisch wertvolles“ Stück. Er hat mit „Liebelei“ einen Grundtcn angeschlagen, ein kapitales Thema, das dem Stück allgemeines Interesse sichert, und er hat ihm eine spezifisch Wienerische Färbung gegeben, die aus „Liebelei“ ein echtes Volksstück macht. Dieses Spiel in Geist und Stil bei der Aufführung völlig zu verfehlen, wäre fast tragisch. Beides ganz zu treffen und alles richtig zu machen, ist freilich recht schwierig, eine Frage des Taktes und des Fingerspitzengefühls. Das Ensemble des Volkstheaters spielt dieses Stück gegenwärtig in den Wiener Außenbezirken und hat hier ein dankbares und ergriffenes Publikum. An der Spielleitung Heinrich T r i m b u r s wüßten wir nichts auszusetzen. Die beiden „Helden“ sind zugleich die Passivsten, sie sind die Leidenden, die Opfer: Hans Weiring, Violinspieler am Josefstädter Theater, dem Karl Skraup die Züge einer toleranten Menschlichkeit und Resignation verleiht, und seine Tochter Christine, für ein kurzes, flüchtiges Glück und großes Leid prädestiniert. Maria Urban. gestaltet diese „Wissende“ logisch, eindringlich und ergreifend. Ihr Typ und ihr kultiviertes Wienerisch hätten dem Autor wahrscheinlich sehr gefallen. Elisabeth Hitzenberger (als Schlager-Mitzi) hat das Zeug zur Volksschauspielerin. Horst Fitzthun und Günther Bauer machen beste Figur und sind im übrigen „junge Leute“, wie Schnitzler sie charakterisiert, nicht mehr und nicht weniger. EJis.abeth Stiepl und Hans Frank sind gut in zwei Charakterrollen. Maxi Tscfiunko schuf ein an die verschiedenen Buhnenverhältnisse anpassungsfähiges Interieur, das Atmosphäre und Intimität ausstrahlt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!