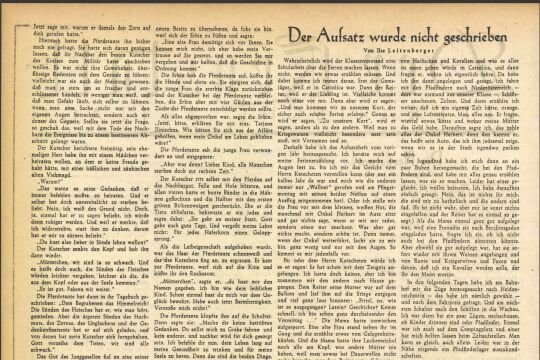Sie sang die Aninka, die weibliche Hauptrolle in Hans Krásas Kinderoper "Brundibár", das im böhmischen "Vorzeige"-KZ Theresienstadt 52-mal aufgeführt wurde. Danach kam Greta Klingsberg nach Auschwitz - und überlebte. Heute besucht sie auch Schulen in Österreich um über ihre Erlebnisse zu erzählen.
Die Furche: Kommen Sie gerne nach Wien, obwohl sie fliehen mussten?
Greta Klingsberg: Es konnte sich kaum ein Verhältnis zu Wien entwickeln, da ich achteinhalb war, als wir Wien verlassen haben. Zum ersten Mal bin ich 1959 zurückgekommen, um zu sehen, woher ich eigentlich komme. Aber ich habe kein Heimatgefühl zu Wien, ich fühlte mich nie als Österreicherin. Aber Wien ist eine wunderschöne Stadt und da ich Freunde hier habe, war es für mich nie ein Problem."
Die Furche: War es für Sie ein Problem, dass Österreich seine NS-Vergangenheit lange Zeit verleugnet hat?
Klinsberg: Das ist das Problem der Österreicher, ich habe genug Probleme mit meinem eigenen Land. Ich will nicht richten. Ich habe natürlich gemerkt, dass Deutschland sich stärker seiner Vergangenheit gestellt hat und stellt. Und in Österreich waren sie immer nur "angeschlossen" oder "überrannt". Aber die Tatsache, dass man mich nach Österreich einlädt, zeigt doch, dass sich einiges geändert hat.
Die Furche: Wie bringen Sie den Schülern in Österreich Ihre schrecklichen Erfahrungen der NS-Diktatur näher?
Klingsberg: Ich bin weder eine professionelle Rednerin noch Lehrerin oder Historikerin, das sage ich den Kindern und Jugendlichen auch. Ich kann erzählen, wie es war, als Kind abgesondert oder ausgestoßen zu sein. Oder dass ich in der 2. Schulklasse kein gutes Zeugnis bekommen konnte, weil ich Jüdin war. Ich versuche, diese willkürlichen Ungerechtigkeiten, die auch ich nicht verstand, zu schildern.
Als mich etwa Freunde nicht mehr grüßten, weil ich den gelben Stern trug. Oder ich erzähle von den Demütigungen und Schikanen, die ein neunjähriges Kind ertragen musste, das nicht auf dem Gehsteig gehen durfte, das kein Bonbon kaufen konnte, weil es in keinen Laden gehen durfte, oder sich nicht auf eine Parkbank setzen durfte, weil das für Juden verboten war. Mit diesen kleinen unmenschlichen Dingen können sich auch Kinder identifizieren. Die großen Gräueltaten kann man nachlesen.
Wenn die älteren Kinder etwas über Auschwitz wissen wollen, zitiere ich Primo Levi: Es ist nicht wichtig, wie lange man in Auschwitz war, sondern entscheidend ist die Begegnung: diese völlige Dämonisierung und versuchte Ausradierung des Menschlichen durch das Abrasieren aller Haare, auch der Schamhaare - völlig nackt unter Hunderten. Das ist unvorstellbar, kein Film kommt dem nah.
Die Furche: Wie wichtig war die Musik in dieser Zeit?
Klingsberg: Die Musik hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, sie ist so etwas Bereicherndes. Ich finde, Musik ist ein wunderbares Verständigungsmittel von Mensch zu Mensch ohne Sprache. Schon als Kind habe ich immer gerne gesungen. Und so habe ich auch in Theresienstadt bei vielem mitgesungen: Es hat uns allen viel bedeutet, wenn wir das "Libera me, domine" im Verdi-Requiem gesungen haben, uns wurden die Worte vorher erklärt. Bei der "Verkauften Braut" war ich im Chor und bei der "Zauberflöte" spielte ich den zweiten Knaben. So ist Raphael Schächter, der Dirigent, auf mich aufmerksam geworden und ich habe die Rolle der Aninka in der "Brundibár"-Oper bekommen. Sie wurde zur populärsten Oper, ich glaube es gab niemanden, der die Oper nicht gehört hat. Von den 52 Aufführungen habe ich 50 gesungen. Vor kurzem hat mir in Brünn eine gesagt: Einmal habe ich die Aninka gesungen, ich war sehr froh, dass du damals krank warst ... Aber nachdem eine Kommission des Roten Kreuzes in Theresienstadt war, wurden wir alle nach Auschwitz geschickt.
Die Furche: War diese Kinderoper eine Flucht in eine andere Welt?
Klingsberg: Ein Kind hat zum Glück sowieso eine Fantasiewelt - eine Art Schutzwand. Man sah natürlich seine Freunde an Typhus sterben. Aber wenn man diese Musik hörte oder spielte und plötzlich anfing, einen Bäcker, einen Milchmann, ein Eis, eine Katze oder einen Hund zu sehen, war man in einer anderen Welt. Und da war die Oper ein Abwehrmechanismus.
Die Furche: Gab es auch Momente, wo sie keine Hoffnung mehr hatten?
Klingsberg: Eigentlich nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eine positive Einstellung zum Leben habe. Ich habe mir einen Glauben an das Menschliche im Menschen behalten, und das hilft. Außerdem hatte ich immer gute Leute um mich, da ich ja keine Verwandten mehr hatte. Eine davon, Laura Schimko, wurde zu einer Art Pflegemutter. Leider ist sie gestorben, und ich konnte sie nicht in Prag besuchen, weil ich mit meinem israelischen Pass nicht einreisen durfte. Es ist die Politik, die überall reinpfuscht.
Die Furche: Welche Botschaft geben sie den Kindern mit?
Klingsberg: Ich versuche ihre Neugier zu wecken. In Schulen, wo verschiedene Kinder mit unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, sage ich ihnen: Schaut euch um, das ist doch viel interessanter, als wenn wir alle gleichgeschaltet wären. Es ist interessant zu wissen, warum trägt sie ein Kopftuch, warum isst er kein Schweinfleisch, warum fasten sie am Freitag. Diese Neugier zu erhalten ist wichtig, weil sich daraus eine Toleranz entwickelt: den anderen leben lassen und akzeptieren, dass nicht jeder so ist, wie ich. Das ist mein Glaube und das ist, was ich weitergeben kann. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich habe immer versucht, die Brücke zu den Menschen zu finden, gerade auch in meinem eigenen Land, wo ich sehr viele palästinensische Freunde habe. Ich lerne jetzt auch Arabisch.
Die Furche: Leben und leben lassen als Lösung im Nahostkonflikt?
Klingsberg: Gott sei Dank bin ich kein Politiker, aber eines Tages müsste man sprechen und nicht schießen. Mir ist egal, ob Ostjerusalem palästinensisch ist und Westjerusalem zu Israel gehört. Man soll nebeneinander leben können ohne Mauer dazwischen. Aber dazu braucht man einige Frauenhirne, denn die Politik wird immer noch von Männern betrieben. Und die Fronten werden verhärtet: Wenn die Palästinenser in den Flüchtlingslagern keine Aussicht haben, dann werden sie auch zu Extremisten. Das ist ein Bumerang. Zu einem Dialog braucht man aber beide Seiten. Die Palästinenser sind sicher kein einfacher Partner wegen der Korruption in der Regierung und wegen der Fanatiker. Aber man darf sich nie auf eine Position versteinern und muss überprüfen, ob in der Vergangenheit alles richtig gemacht wurde. Und falls mein Großvater nicht richtig gehandelt hat, vielleicht kann ich es ja besser.
Das Gespräch führte Philipp Kainz.
Aninka in Theresienstadt
Greta Klingsberg wurde am 11. September 1929 in Wien in eine jüdisch-assimilierte Familie geboren. Im Juni 1938 floh die Familie in die Tschechoslowakei. Die Eltern konnten noch im selben Jahr mit Hilfe eines illegalen Transports nach Palästina entkommen. Greta und ihre jüngere Schwester Trude blieben im Brünner Waisenhaus zurück und sollten später nachreisen. 1942 jedoch erfolgte die Deportation nach Theresienstadt. Im Lager, das den Nationalsozialisten auch zu Propagandazwecken diente, sang Greta Klingsberg die weibliche Hauptrolle der Aninka in der Kinderoper "Brundibár" von Hans Krása. Die politische Qualität des Stücks ist eindeutig, lautet doch die Botschaft, dass die siegen werden, die zusammenhalten. 1944 kommt sie nach Auschwitz, ihre Schwester wird im KZ ermordet. Nach der Befreiung besucht sie die englische Schule in Prag, 1946 geht sie nach Palästina und absolviert in Jerusalem eine Gesangsausbildung. Sie wird Mitglied prominenter israelischer Chöre und arbeitet auch in der Musikabteilung des israelischen Rundfunks.
Greta Klingsberg gilt als einzige weibliche Überlebende des Ensembles von "Brundibár". Auf Einladung des Orpheus Trust, der sich um aus Österreich vertriebene Musiker/innen annimmt (www.orpheustrust.at), kommt Klingsberg auch öfters nach Wien, wo sie unter anderem als Zeitzeugin in Schulen von der NS-Zeit erzählt. PK
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!