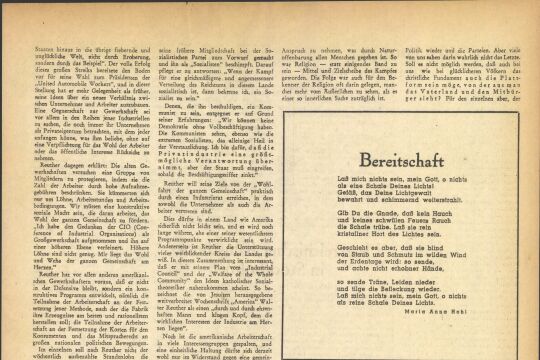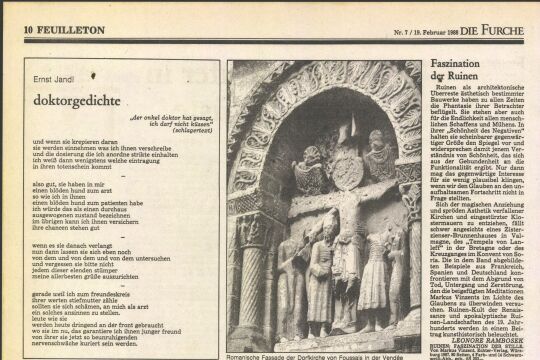DIE ABWEICHUNG, DIE EIGENART
LITERATUR BLICKT IN DIE WELT, INDEM SIE ERZÄHLT, WIE EINZELNE IN IHR VERSUCHEN, IHREN ALLTAG ZU MEISTERN.
LITERATUR BLICKT IN DIE WELT, INDEM SIE ERZÄHLT, WIE EINZELNE IN IHR VERSUCHEN, IHREN ALLTAG ZU MEISTERN.
Einmal verstand Terézia Mora die Welt nicht mehr. Ein Freund wünschte sich von ihr den Roman "Der Turm" des in der DDR aufgewachsenen Schriftstellers Uwe Tellkamp. Beim nächsten Anlass schenkte sie ihm das Buch, der Freund bedankte sich höflich und meinte, lesen wolle er es aber nicht. Tellkamp denke vermutlich anders als er, und dem wolle er sich nicht aussetzen. Wozu lesen wir dann überhaupt, fragt sich Mora. Doch nur, um andere Sichtweisen kennen zu lernen. Durch Lektüre sollen wir gerade nicht bestätigt werden in unseren Ansichten, wir sind gezwungen, unsere eigene Haltung zu überdenken und durch die Wahrnehmung von anderen zu korrigieren, zu schärfen oder zu ergänzen. In jedem Fall wird die Feinabstimmung zwischen dem Leser und dem, was er für die Wirklichkeit nimmt, in Nuancen verändert. Einer liest Tellkamp nicht, weil er fürchtet, in den Grundfesten seines Denkens erschüttert zu werden. Schlimm, aber ein Einzelfall ist er keineswegs.
Blick in die Individuen
Wenn man ausgewiesene Leser fragt, warum sie sich herumdrücken um die Literaturen aus Ländern des früheren Ostblocks, meinen sie, dass sie von der düsteren Weltsicht, die sie jenen Autorinnen und Autoren unterstellen, nicht behelligt werden wollen. Es stimmt, dass ein wesentlicher Teil der zeitgenössischen Literatur aus Russland, Polen und der Ukraine sich die jüngste Geschichte als Stoff holt. Das ist der Notwendigkeit geschuldet, sich Orientierung in einer sich rapide verändernden Welt zu verschaffen. Aber wie das Ljudmila Ulitzkaja, Olga Tokarczuk oder Jury Andruchowytsch machen, entfernt sich aufregend von der distanzierten Nachrichtenwelt. Wir sehen, wie Individuen reagieren auf soziale Stimmungen und gesellschaftliche Verstimmungen. Als Leser werden wir getroffen im Mark. Dabei wird der Unterschied deutlich, ob einer als Reisender und Journalist zurückkommt und nüchtern berichtet, was ihm an Ungeheuerlichkeiten untergekommen ist in der weiten Welt, oder ob einer, der unter prekären Lebensverhältnissen durchzukommen versucht, sich dem Schrecken stellt.
Hans-Christoph Buch, ein notorischer Afrika-Reisender, kommt regelmäßig mit erschreckenden Neuigkeiten von einem zerstörten und zerstörerischen Kontinent zurück und öffnet mit dem Blick des Aufklärers die Augen. Schonungslosigkeit gehört zu seinem ihm selbst auferlegten Auftrag, den Bürger der westlichen Welt aufzurütteln. Und so lesen wir, wie er fassungslos vor einem Lastwagen steht, auf dem vor kurzem noch aneinandergekettete Männer mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Mit Schockbildern bricht er die Lethargie auf und bestätigt damit das Bild, das wir aus dem Innersten Afrikas sowieso in uns tragen, das Bild von den ungeschlachten Kämpfern, die sich gegenseitig in Stammesfehden aufreiben.
Das ist nicht falsch, erklärt jedoch nicht, was in den Menschen, die nichts anderes als ihre Haut zu retten bestrebt sind, vorgeht.
Wie aber betreibt Christopher Mlalazi, Jahrgang 1970, sein Handwerk, wenn er von seinem Land Simbabwe schreibt? Im Roman "Wegrennen mit Mutter" holt er ins Erzählen herein, was es für Menschen bedeutet, von einer Stunde auf die andere vom Bürgerkrieg überrollt zu werden. Bald nachdem Simbabwe 1980 die Unabhängigkeit erlangt hatte, kam es zu einem blutigen Krieg, der schon damals Mugabe, den Liebling des Westens, als Tyrannen hätte entlarven können. Plötzlich war es ein Fehler, zum Stamm der Ndebele zu gehören, denn die sollten ausgerottet werden. Dennoch handelte es sich nicht um eine Stammesfehde, sondern Mugabe wollte sich einer Rebellengruppe entledigen, mit der er gerade noch gemeinsam die Freiheit erkämpft hatte. An die Macht gekommen, fürchtete Mugabe, dass ihm diese nun streitig gemacht werden könnte.
Für den Roman zählt der politische Hintergrund nicht viel, weil aus der Perspektive einer Vierzehnjährigen erzählt wird, die unter dem Eindruck der Gewalt mit ihrer Mutter ins Gebirge flieht. Sie versteht nicht, was vorgeht, sie kämpft ums Überleben: "Wir waren so still wie Beutetiere." Nicht politische Ideen und die Strategien der Macht stehen im Vordergrund, sondern wie sich Einzelne unter Widrigkeiten eine Form von Normalität und Alltag schaffen. Eine Bevölkerungsgruppe sieht sich im Stich gelassen, ja, sie hat nicht einmal die Chance herauszubekommen, warum sie gejagt wird. Davon hört man in Nachrichten nichts und wissen Reportagen nichts, deren Anspruch in der Analyse besteht. Es gibt einen Unterschied zwischen "Erster" und "Dritter" Welt in den Erfahrungen und Mentalitäten, den Konflikten und dem Zusammenhalt, der Organisation von Gesellschaft und dem Quertreiben des Individuums. Die Abweichung, die Eigenart, das Unkommensurable sind die Ingredienzien einer Literatur, die etwas anderes als die Universalien der menschlichen Spezies wichtig nimmt. Das lässt sich auch an einem anderen Beispiel nachweisen.
Groteske und Sarkasmus
Einen völlig anderen Zugang, die Verhältnisse in einem Land eben nicht beim Namen, sondern bei einem Decknamen zu nennen, wählt der Kroate Veljko Barbieri mit seinem Roman "Epitaph eines königlichen Feinschmeckers". Er rechnet hart ab mit einer Diktatur, wie sie der 1959 in Split geborene Autor unter Tito noch am eigenen Leib erfahren haben wird.
Er wählt die Groteske als probates Mittel, absonderlichen Verhältnissen von Willkür und Überwachung gerecht zu werden. Der Erzähler gerät in den Fokus der Behörden, weil er sich als Gourmet eines den Staat schädigenden Verhaltens schuldig macht. Er hat sich zu rechtfertigen dafür, dass "Sie Zeit und Geld für Beschäftigungen vergeudet haben, die ohne gesellschaftlichen Nutzen sind". Von da an hat er keine Chance mehr. Sarkastisch beobachtet Barbieri, wie einer kaputt gemacht wird, weil er "Ich" zu sagen wagt in einer Gesellschaft, wo er sich gefälligst auf das "Wir" einzuschwören hat. Die Leidenschaft des Kochens und Essens liefert nur eine auffallend schräge Metapher für Kunst und andere elementare Äußerungen des Lebens, die für Barbaren zum unmittelbaren Überleben tatsächlich nicht unbedingt notwendig sind. Das Unnotwendige, das als nutzlos Diffamierte, öffnet sich bei Barbieri zum Reich der Freiheit. Statt in der vorgeschriebenen Enge im Kreis zu gehen, beschreitet einer neue Denkwege ins Offene, seinen Rückhalt findet er bei Kumpanen in der Tradition. Ein in antiken Zeiten ebenso wie der Ich-Erzähler in Ungnade gefallener Verfasser eines Kochbuchs wird zum Verbündeten gegen die Zumutungen der Macht.
Epitaph eines königlichen Feinschmeckers
Roman von Veljko Barbieri, übers. von Barbara Antowiak
Wieser 2014 160 S., geb., € 9,95
Wegrennen mit Mutter
Roman von Christopher Mlalazi, übers. von Andreas Münzner
Horlemann 2014 180 S., geb., € 17,40
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!