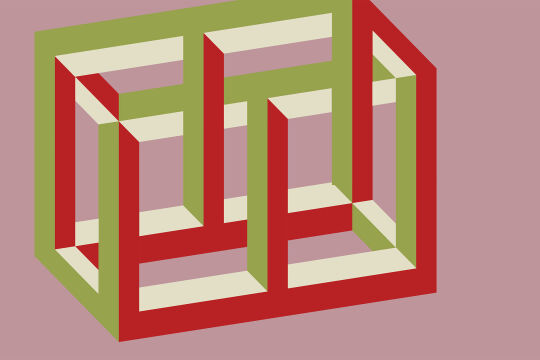Die in Lainz aufgedeckten Missstände wurden vielfach kommentiert. Im folgenden Gespräch beleuchtet eine Pflegeforscherin die Situation aus ihrer Warte.
Die Furche: Sind die Missstände, von denen so viel die Rede ist, die Folge mangelnder Ausbildung, mangelnder Motivation, mangelnder Mittel?
Elisabeth Seidl: Es fehlt überhaupt ein politisches Konzept zur Gestaltung der Gesundheitsversorgung. In Deutschland gibt es solche Ansätze und doppelt so viele Pflegepersonen pro Kopf wie in Österreich. Bei uns liegt das im Argen. Die Ausbildung der diplomierten Gesundheits- und Krankenschwestern ist gut. Die Pflegepersonen sind überwiegend hoch motiviert. Was fehlt, sind die akademischen Lehrer in den Schulen, weil wir erst jetzt begonnen haben, auf diesem Sektor akademisch auszubilden. In Skandinavien gibt es nur fachhochschul- und hochschulgebildete Pflegepersonen.
Die Furche: Liegt das Problem also stark an den Rahmenbedingungen?
Seidl: Die großen Altersheime jedenfalls sind eine Katastrophe. Die Menschen verbringen dort Jahre ihres Lebensabends in einem Zimmer mit acht Menschen, haben nur das Bett und den kleinen Platz daneben. Tag und Nacht keine Ruhe. Unzumutbar. Da kann der Mensch nicht denken, nicht entspannen, nicht schlafen. Ich war in der Kommission nach dem Lainzer Skandal. Da haben wir festgehalten, dass solche Konstellationen abgeschafft werden müssen. Ich verstehe nicht, dass es nicht gelingt, den Politikern das klar zu machen. Warum gibt es keine Lobby, die auf die Straßen geht, wenn alten Menschen so etwas zugemutet wird. Das ist eine Sache der Gerechtigkeit, für die man kämpfen muss - aus humanistischen Gründen, aber auch um für sich selber vorzusorgen.
Die Furche: Was ist überhaupt das Kennzeichen einer guten Pflege?
Seidl: Gute Pflege ist: die Situation des Patienten ganz zu erfassen, unter Berücksichtigung der geistigen, psychischen, emotionalen und sozialen Aspekte. Eine gute Pflege führt den Kranken so, wie er es braucht. Pflegen heißt eine gute Beziehung zum Patienten herzustellen und Tag für Tag körperlich und geistig zu arbeiten, bis er seine Möglichkeiten ausschöpfen kann. Bei Schwerkranken ist das eine sehr sensible Sache. Da ist die Pflegeperson ganz gefordert.
Die Furche: Wie geht man an eine so komplexe Aufgabe am besten heran?
Seidl: Seit 20 Jahren haben wir ein ausgezeichnetes Instrument entwickelt - die Pflegeplanung: Mit den Kranken wird schrittweise eruiert, was an Problemen da ist. Es werden Ziele formuliert. Beispiel: Ein Patient soll zum ersten Mal aufstehen. Dafür müssen am Morgen schon die Kräfte vorbereitet werden. Dann wird erstmals dieses Stück Weg zurückgelegt. Das kann wie ein großer Sieg sein. Der Kranke muss die Pflegeperson anerkennen, als jene, die wirklich helfen kann.
Die Furche: Ist die Pflegeperson nicht ohnedies Autorität?
Seidl: Sie wird es am besten durch ein gutes Erstgespräch. Sonst hat der Kranke den Eindruck, alles geschieht über seinen Kopf hinweg. Dann sind die Schmerzen größer, die Ängste schlimmer.Wer nicht weiß, worum es geht, dem fehlt die Einstellung zum Gesundwerden.
Die Furche: Erfordert ein solcher Einsatz nicht zu viel Zeit?
Seidl: Der Eindruck mag entstehen. Es wurde jedoch nachgewiesen, dass gute Beratung und professionelle Pflege die aufgewendete Zeit eher verkürzt. Der Kontakt wird intensiver, die Fragen werden gezielter, man bringt nicht dreimal die falschen Sachen. Krankenpflegerinnen, bei denen ich dieses System der Pflegeplanung eingeführt habe, sagen mir: Wir gewinnen Zeit. Im Augenblick, in dem die Kranken Vertrauen haben, läuten sie seltener, fragen sie weniger.
Die Furche: Wie viele Menschen arbeiten im Bereich der Pflege?
Seidl: In der gehobenen Gesundheits- und Krankenpflege sind es 47.000 in Österreich. Dazu kommen die Helferinnen.
Die Furche: Klingt so, als wären das sehr viele...
Seidl: Weil wir die höchste Anzahl von Spitalsbetten haben, wird das Personal von den Institutionen geschluckt. Nur sind Spitäler nicht immer das Beste für den Menschen. In Studien haben wir nachgewiesen, dass es für alte Menschen kontraproduktiv sein kann. Bei Befragungen wussten 50 Prozent nicht mehr, dass sie im Spital gewesen waren, 50 Prozent nicht, wo sie jetzt waren. Für die geistigen Fähigkeiten kann ein Spitals-Aufenthalt tödlich sein. Daher ist es wichtig, präventiv zu arbeiten.
Die Furche: Wie könnte das konkret funktionieren?
Seidl: Ein Beispiel aus Dänemark: Ein Arzt kam in eine neue Gemeinde. Zunächst besuchte er alle Leute, vor allem die älteren, um zu sagen: "Wenn Sie mich brauchen, bin ich da für sie. Jetzt weiß ich, wo sie wohnen, wie es mit Ihrer Familie ist." Daraufhin geschah etwas Bemerkenswertes: Im Jahr darauf gab es um 20 Prozent weniger Spitalseinweisungen, viel weniger Arztbesuche. Die Menschen brauchen das Vertrauen, dass eine kompetente Person bei Bedarf da ist. Ein anderes Beispiel: Wir haben ein Projekt "Alte sorgen für ganz Alte" durchgeführt. Da erfassten wir in einem Sprengel alle, die noch irgendwelche Kompetenzen hatten. Gleichzeitig haben wir die Bedürfnisse der ganz Alten erhoben: Sie brauchten vor allem Begleitung. Die erhobenen Fähigkeiten und Bedürfnisse ließen sich gut kombinieren. Und das hat dazu geführt, dass die alten Leute wieder aktiv geworden sind.
Die Furche: Es gibt aber viele Fälle, wo Gebrechen unbedingt eine Pflege erfordern. Wie hilft man den Angehörigen, damit zurecht zu kommen?
Seidl: Was sie brauchen, ist sehr unterschiedlich. Gäbe es jemanden, der mit ihnen ihre Probleme bespricht und erledigt, was sie selbst nicht bewältigen, wären sie viel sicherer. Sie würden seltener erkranken und nicht selbst wieder zum Pflegefall werden.
Die Furche: Wie gut werden professionelle Pflegepersonen begleitet?
Seidl: Pflegen ist ein unglaublich vielfältiger und aufreibender Job, der enorme Kompetenzen verlangt: organisatorische, administrative, pflegerische, medizinische und eine unglaubliche Kommunikationsfähigkeit, um mit den Ärzten so umzugehen, dass sie sich nicht beleidigt fühlen. Die Leute müssen ausgleichen, was der Arzt nicht leistet: an Information, an Anwesenheit, an Beratung. Die Pflegepersonen werden nicht zuletzt durch die ewigen Konflikte ausgepowert. Es geht einfach nicht, dass ein Teil des Gesundheitssystems, die Ärzte, sich wenig um das wirkliche Befinden von Kranken kümmert und nur um das Heilen von Krankheiten. Der andere Teil muss alles ausgleichen.
Die Furche: Gibt es entsprechende Hilfe zur Bewältigung dieser Aufgaben? Werden die Schwestern begleitet?
Seidl: Nach den Vorfällen in Lainz hat man versucht Supervision zu machen. Aber Leute, die von außen kommen, können sich das Maß an Belastung nicht vorstellen. Daher bringt das nicht viel. Wichtig sind gute Runden innerhalb des Teams. Die Pflegepersonen müssen vor allem auch von den Ärzten als echte Gesprächspartner anerkannt werden. Jetzt hört man immer noch: Was ihr Schwestern da macht, ist nicht so wichtig.
Die Furche: Erfordert das Pflegen einen besonderen Menschentyp?
Seidl: Man muss feststellen, ob jemand geeignet ist. Im Prinzip aber meine ich: Der Mensch hat, will er sich ausbilden, die Fähigkeit, im kommunikativen, empathischen Bereich zu lernen - und zwar ein Leben lang. Nur haben es die Frauen meist von Kindheit an gelernt, während sich die Männer da sehr schwer tun.
Das Gespräch führte Christof Gaspari. Dozentin Elisabeth Seidl leitet die Abteilung für Pflegeforschung in Wien des Instituts für Pflege- und Gesundheitssystemforschung der Uni Linz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



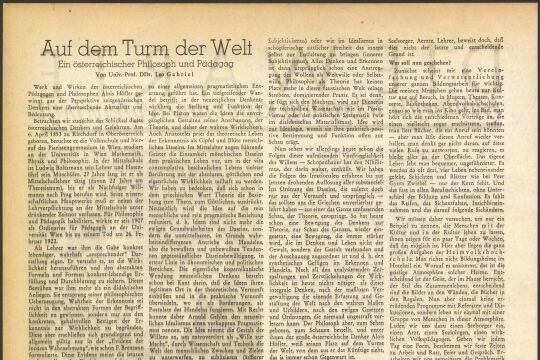



















































.png)

















.jpg)