Was bedeutet die Pflege für Betroffene und deren Angehörige? Einblicke in den Alltag der Pflege zwischen Abhängigkeit und Überforderung.
Eine Gruppe alter Menschen sitzt im Sesselkreis und unterhält sich über das Thema Ernte. Bald plaudern sie munter über köstliche Kartoffelgerichte und Entbehrungen während des Krieges. Die Gruppe befindet sich im Tageszentrum des Caritas Senioren- und Pflegehauses St. Barbara im 23. Wiener Bezirk, ihre Unterhaltung ist Teil des therapeutischen Angebots für Demenzerkrankte – eine Validationsrunde. Rund 23 ältere Menschen kommen täglich ins Tageszentrum, ein Großteil leidet unter Demenz. Für die Betroffenen bietet das Zentrum Therapie, Struktur und Unterhaltung, für ihre Angehörigen bedeutet diese Zeit heiß ersehnte Freizeit und Lebensqualität.
Unter den Gesprächsteilnehmern sind Stefanie Felder, 79, und Gunther Kieslich, 70, beide leiden unter Demenz. In der Runde plaudern sie munter. Als sie kurz zuvor neben ihren Angehörigen sitzen und diese über den harten Pflegealltag erzählen, ist Frau Felder still, Herr Kieslich großteils. Die Angehörigen – Herr Kieslichs Ehefrau Monika und Frau Felders Schwester Erika Tampir – haben aber einiges auf der Seele.
„Kann endlich wieder schwimmen gehen“
Zunehmend konnten sie ihre Angehörigen nicht mehr alleine lassen, auch nachts. „In den letzten Wochen hat sich sein Zustand verschlechtert“, erzählt Monika Kieslich, 65, über die Erkrankung ihres Mannes. Er sei weggelaufen, habe den Weg nicht mehr heimgefunden, sie konnte bald nicht mehr ohne ihn fortgehen. Seit Ende August ist Herr Kieslich daher tagsüber im Tageszentrum, für seine Ehefrau bedeutet das eine große Entlastung. Sie kann wieder schwimmen gehen, Dinge erledigen. Sie ist die einzige, die sich um ihren Mann kümmert, vom gemeinsamen Sohn erwartet sich Frau Kieslich keine Hilfe bei der Pflege. Am Wochenende ist sie mit ihrem Mann allein. Da möchte er etwas unternehmen, unter Leuten sein, Frau Kieslich muss immer an seiner Seite bleiben. Wenn er etwa in einem Restaurant aufs Klo geht, muss sie schauen, wo er hingeht und dass er wieder zurückfindet. Seit er das Tageszentrum besuche, gehe es wieder bergauf, sagt sie. Früher hatten sie und ihr Mann gemeinsam eine Wäscherei betrieben. Sie habe ihm immer alles abgenommen. Aber dennoch würde sie ihr Leben wieder so leben wollen.
Erika Tampir, 68, hat zuerst ihre Mutter gepflegt und ist nun, seit sieben Jahren, für ihre ältere Schwester da – sie und ihr Mann, sonst würde niemand bei der Pflege helfen. Beide Schwestern blieben ungewollt kinderlos, der Ehemann von Frau Felder braucht selbst Pflege, ist in einem Pflegeheim und hat keinen Kontakt mehr zu seiner Frau. Bei der Pflege der Mutter war Frau Tampir zudem noch berufstätig. Sie hatte ihrer Mutter am Sterbebett versprochen, dass sie auch ihre Schwester pflegt. Nun tut sie das.
Zwei pflegende Frauen im Pensionsalter – typisch für die Pflegelandschaft hierzulande. 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zuhause von ihren Angehörigen umsorgt, der Großteil sind Frauen. Dass die Frauen fast alleine für ihre Angehörigen sorgen, sei ebenso typisch, sagt die Leiterin des Seniorenhauses St. Barbara, Brigitta Letitzki. Das sei der Trend. Viele Frauen seien heute berufstätig, Großfamilien seien nicht mehr gegeben. Nach einer Studie des österreichischen Instituts für Gesundheitswesen aus dem Jahr 2005 leiden mehr als zwei Drittel der pflegenden Angehörigen unter körperlichen und psychischen Belastungen.
Frau Tampir machte anfänglich die Aggression ihrer Schwester zu schaffen, heute beruhigt sie sich selbst: „Das ist die Krankheit. Demenzkranke haben eine panische Angst vor dem Abgeschobenwerden.“
Hier im Tageszentrum konnten die Betroffenen wieder Fähigkeiten lernen, die sie vorher schon verloren hatte. Nach Krankenhausbesuchen sei es oft umgekehrt, da verschlechtere sich der Zustand, sagen die pflegenden Angehörigen. Trotz der wiedergewonnenen Freizeit sind beide Frauen dennoch auch „zeitweise sehr verzagt“. Was Frau Tampir bekümmert: Manchmal habe ihre Schwester noch „helle Momente“, dann merke sie, was sie alles nicht mehr könne, und sei sehr verzweifelt. Zuhause wolle ihre Schwester meist nur schlafen, hier im Tageszentrum blühe sie auf. Das beobachtet die Leiterin des Tageszentrums, Luba Porubiska, oft: „Zuhause machen die Angehörigen meist alles, es ist auch nicht mehr so viel Zeit, dass die Pflegebedürftigen die Dinge selbst machen. Wir haben Geduld und arbeiten daran, die Selbstständigkeit zu erhalten.“ Etwa durch die Gesprächsrunden nach dem Prinzip der Validation. Dabei soll das Selbstwertgefühl der Demenzkranken gehoben werden, sagt Elisabeth Kuk, Expertin für Validation im Haus St. Barbara. Es werde versucht, kleine Dinge zu erhalten. „Die Menschen hier wissen, dass dies ihr letzter Lebensabschnitt ist. Sie beschäftigen sich mit dem Tod und spüren, dass sie nun vieles verkehrt machen und eine Last sind.“ Auf einer tiefen Ebene wisse ein Erkrankter auch, dass etwa die Mutter bereits gestorben ist, die er trotzdem erwartet. Wenn man sagen würde: „Ja, die Mutter wird kommen“, spürt der Mensch, dass das nicht stimmen könne. Daher würde man sagen: „Es ist schön, wenn die Mutter kommt.“ Oder: „Ich weiß nicht, ob die Mutter kommt.“ Auch das Singen von fröhlichen oder tröstenden Liedern sei in der Arbeit mit Demenzkranken sehr wichtig, so Kuk.
Caritas-Appell: „Pflege betrifft uns alle“
Besonders Demenzkranke stehen im Zentrum der aktuellen Kampagne der Caritas unter dem Motto „Pflege geht uns alle an“. Die Zahl von Betroffenen wird sich nach Prognosen bis zum Jahr 2050 verdreifachen. Zurzeit leiden rund 100.000 Menschen hierzulande an der Erkrankung. Die Caritas hat bei der Präsentation der neuen Kampagne Mitte September erneut ein „einheitliches Gesamtkonzept“ für die Pflege gefordert. Vor allem müsste der im Regierungsprogramm fixierte Pflegefonds geschaffen werden. Weiters müssten bundesweit Lücken im Pflege- und Betreuungsangebot geschlossen werden – etwa durch mehr Tageszentren.
Frau Kieslich und Frau Tampir sind erleichtert, dass es ein solches gibt. Wenn es nicht mehr anders geht, sollten die Angehörigen in der Pflegestation in St. Barbara untergebracht werden. Ob sie noch weitere Hilfe bräuchten? Beide verneinen – was sie leisten, scheint für sie selbstverständlich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


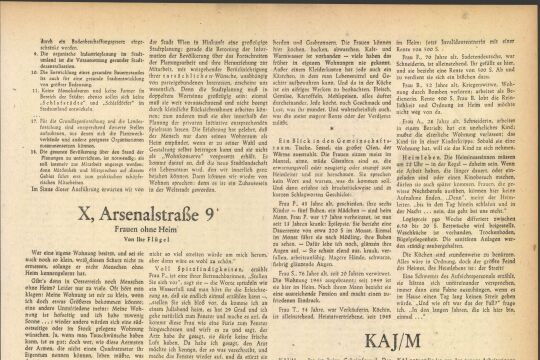













































































.jpg)











