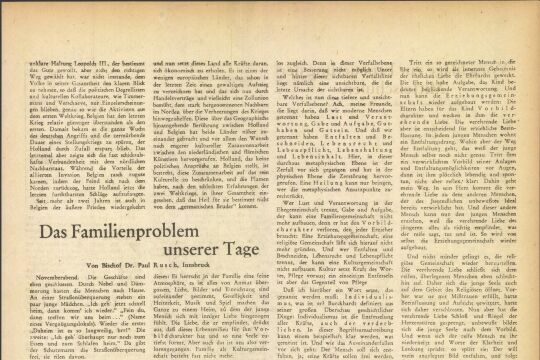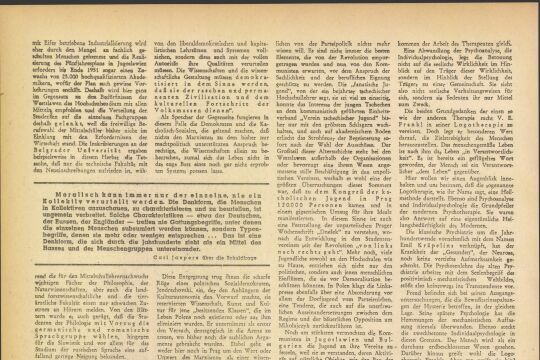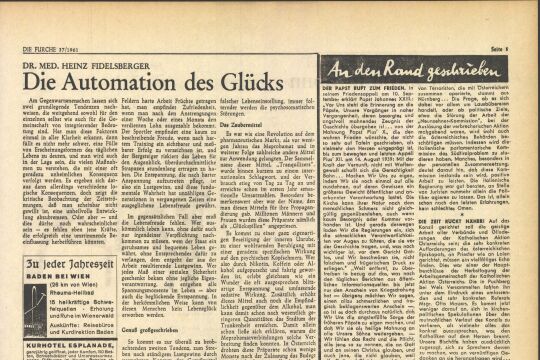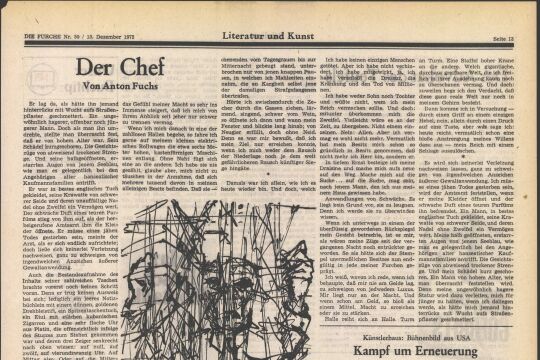Warum ich es (fast) wissen will
Die langwierige und teure Psychoanalyse scheint vielen in Zeiten von Selbstoptimierung und Effizienzzwang anachronistisch. Dennoch lassen sich manche auf dieses Abenteuer ein. Eine Selbsterklärung.
Die langwierige und teure Psychoanalyse scheint vielen in Zeiten von Selbstoptimierung und Effizienzzwang anachronistisch. Dennoch lassen sich manche auf dieses Abenteuer ein. Eine Selbsterklärung.
Seit zwei Jahren gehe ich zwei Mal pro Woche zur Psychoanalyse. Ich habe unzählige Stunden in einem karg möblierten Therapieraum verbracht, und der finanzielle Aufwand entspricht mittlerweile wohl dem Gegenwert eines (gebrauchten) Kleinwagens. Kein Wunder also, wenn Menschen mich fragen: Zahlt sich das wirklich aus? Und: Willst du das alles so genau wissen? Die Antworten lauten: ja -und nein. Denn natürlich will ein Teil von mir "es" nicht so genau wissen. Deshalb bin ich schließlich in Analyse
Wobei die Geschichte meiner psychoanalytischen Therapie eigentlich mit meiner Ausbildung zum Lebens-und Sozialberater begann. Psychoanalyse stand dort nicht sehr hoch im Kurs. Mit ihren exzessiven Ansprüchen an Zeit, Geld und Commitment schien sie den meisten Vortragenden so anachronistisch wie die Begriffe "Penisneid" oder "Kastrationsangst". Das Verhältnis von Analytiker und Analysand erregte zudem den Verdacht, überkommene, autoritäre Haltungen zu konservieren. Ich erfuhr dagegen viel über aktuelle Ansätze, in denen Klienten als "Kunden" adressiert werden, die vor allem eines suchen: schnelle und effiziente Intervention zur maßgeschneiderten Verhaltensänderung.
"Gleichschwebende Aufmerksamkeit"
Freud hatte ich während des Philosophiestudiums gelesen. Gemessen an seiner theoretischen Strenge schienen mir viele der hippen Angebote auf dem gegenwärtigen Markt psychosozialer Dienstleistung nur wenig überzeugend. Ich beschloss also, das vom Lehrplan verordnete Stundenkontingent an "Selbsterfahrung" bei einem Psychoanalytiker zu absolvieren.
Meine erste Sitzung begann, wie zwei Jahre lang alle weiteren Sitzungen beginnen würden: Der Analytiker, ein sympathischer Mann mittleren Alters, nahm mir gegenüber Platz. Er trug braune Waldviertler und einen Dreitagebart. In seiner Praxis gab es keine Duftlampe. Nachdem wir einander begrüßt hatten, lächelte er mich an und schwieg beharrlich. Dass ich auch heute nicht viel mehr über ihn zu sagen weiß, hat mit der analytischen Methode zu tun. Der Therapeut bietet sich seinem Klienten als Spiegel an, der alle auf ihn gerichteten Ängste, Wünsche und Gefühle in den Prozess zurückreflektiert. Dazu verbleibt er meist in einer Haltung, die im Fachjargon charmant "freundlich-gleichschwebende Aufmerksamkeit" heißt.
Wie sich herausstellen sollte, blieb das Schweigen nicht meine letzte Begegnung mit gängigen Klischees. Nur die Couch fehlte - sie ist jenen "echten" Analysanden vorbehalten, die sich vier Mal wöchentlich einer klassischen Analyse unterziehen. Wir hingegen sprachen von Beginn an im Sitzen. Mir wurde eröffnet, der analytische Prozess bemesse sich weniger in Stunden als vielmehr in Jahren. In diesen Zyklen -"Analysejahre" genannt - hätte ich Anspruch auf insgesamt je zwei Wochen "Urlaub".
Ich war irritiert. Angesichts des Anteils der Honorare an meinen monatlichen Fixkosten glich das eher einem Feudalverhältnis als einem fairen Angebot. Und bedeutete eine Vereinbarung auf unbestimmte Zeit nicht den Schritt in ein kaum kontrollierbares Abhängigkeitsverhältnis? Zudem empfand ich die konsequente Weigerung des Analytikers, auf mein gewohntes Repertoire an Rollen und Geschichten einzugehen, schon nach wenigen Wochen als frustrierend. Die fortdauernde Subversion meines Selbstbildes hatte mich zusehends verunsichert und ich lief Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein vorzeitiges Ende meiner "Selbsterfahrung" stand im Raum.
Doch ich war auch neugierig geworden. Weiter konnte man sich von einem Wellnessangebot nicht mehr entfernen. Ich begann, den existenziellen Ernst und die Tragweite meiner Entscheidung zu ahnen, als ich mich zum Weitermachen entschloss. Denn hinter der bröckelnden Fassade meiner Schutzhaltungen zeichneten sich die Umrisse eines Menschen ab, von dem ich scheinbar erschreckend wenig zu wissen schien. Mit ihm in Kontakt zu kommen, verlangte den Mut, sich mir selbst in einem Gegenüber zu zeigen. Mit anderen Worten: sich tatsächlich auf eine Therapie einzulassen.
In gelungenen Sitzungen begann ich nun manchmal auch anzukommen: bei einem verlegten Gefühl, einem verbotenen Wunsch oder schlicht bei mir selbst. Wo ich für mich nur Schuldzuweisungen und strenge Urteile fand, erfuhr ich im geschützten Raum der Therapie Wohlwollen und unaufgeregte Akzeptanz. Ich gewann neue Perspektiven.
Das Vertrauen, das zu solchem Gelingen nötig ist, wächst allerdings langsam. In der Praxis gibt es neben aufwühlenden und fordernden Einheiten auch langweilige Stunden, in denen ich "maulfaul" bin; und selbst einem Psychoanalytiker fällt nicht jederzeit termingerecht nur außerordentlich Gescheites ein. Kathartische Dramen, wie ich sie etwa in diversen Familienaufstellungen erlebt habe, ereignen sich dagegen kaum. Neue Freiheitsgrade wachsen eher still und organisch ins alltägliche Leben. Sie sind das Ergebnis der Bereitschaft, sich bis zu einem gewissen Grade auszuliefern: an den Therapieplan, den Analytiker und letztlich an mich selbst. Denn das Eingeständnis der narzisstischen Kränkung, nicht uneingeschränkt Herr im eigenen Hause zu sein, bedeutet auch anzuerkennen, in Fragen der Selbsterkenntnis auf die Hilfe anderer angewiesen zu bleiben.
Rigides Zeitregime als Chance
In diesem partiellen Verzicht auf persönliche Souveränität liegt vielleicht der eigentliche Anachronismus einer analytischen Therapie. Formen heilsamen Selbstzwanges erscheinen einer Zeit suspekt, die ihr Ideal im entscheidungsstarken Individuum mit unbedingter Steuerungskompetenz gefunden hat. Man vermutet dahinter rasch Abhängigkeiten und hierarchische Verhältnisse.
Ich habe dagegen Regeln wie das rigide Zeitregime mittlerweile schätzen gelernt. Sie verhelfen den Stunden, die ich an zwei Tagen der Woche für mich aufwende, zu ihrer Priorität und verteidigen sie gegen die Versuchung, eine Sitzung leichtfertig abzusagen. Den zeitlichen und finanziellen Aufwand schulde ich nicht dem Analytiker -er ist letztlich Ausdruck der Wertschätzung für mich selbst.
Bin ich nun also durch die Analyse glücklicher geworden? Bestimmt nicht. Aber wie Freud schon im "Unbehagen in der Kultur" launig bemerkte: "Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten." Demnach muss ich mich wohl mit kleineren Fortschritten zufrieden geben -zumindest, bis die Analyse zu Ende ist
Der Autor ist im Verlagswesen tätig sowie Lebens-und Sozialberater in Ausbildung
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!