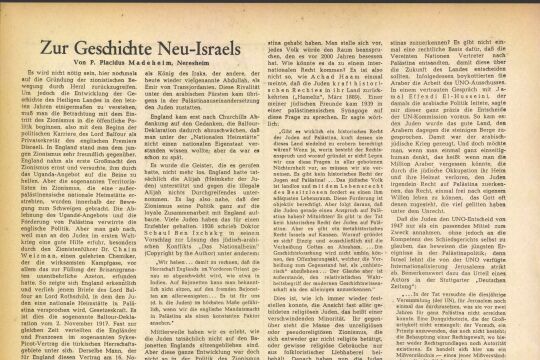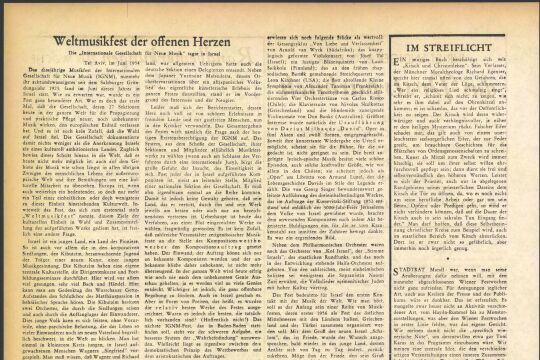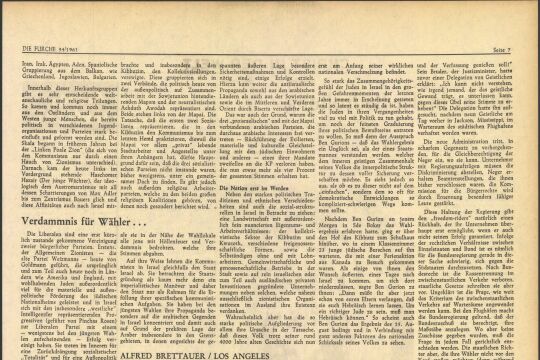Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Neuling im Kibbuz
UM ES NICHT BEI HOCHFLIEGENDEN Phantastereien bewenden zu lassen, die der Romantitel „Exodus“ mit sich bringt, wollte ich — NichtJude — aus der Anschauung des Unvoreingenommenen die Wiege kennenlernen, der dieser Zauber entspringt.
Von diesem Gedanken beseelt, ging ich in Haifa an Land, beehrte bis Tel Aviv einen Taxichauffeur und enterte dort den Wüstenautobus, um nach zweistündiger Fahrt im Kibbuz Dvir zu landen. In liebevoller Weise nahm sich sogleich der „Empfangschef“ meiner an, um mir, dem „Greenhorn“ in Sachen Kibbuz, die ersten Gehversuche beizubringen beziehungsweise das Reglement des Kibbuzpoker aufzudecken.
Im Jahre 1909 errichteten Mitglieder der Zionistischen Bewegung, die Europa verlassen und Palästina als neue Heimat erkoren hatten, den ersten Kibbuz, Degania. Heute zählt man 80.000 Kibbuznik (Kibbuz-bewohner) und 240 Kibbuzim. Es sind nun die zwei großen Parteien Israels — MAP AM und MAPAI —, die der Kibbuzbewegung das Gepräge geben. Das differenzierte innerpolitische Kibbuzleben ändert aber nichts an der Tatsache, daß die Bewegung von einer Grundidee getragen wird: nämlich das Land, das ja noch zu zwei Drittel brachliegt, urbar zu machen. Daß zirka die Hälfte aller Regierungsmitglieder Kibbuznik sind, gibt dieser Bewegung den Anstrich höchster Wertschätzung.
WAS DEN KIBBUZ VOR ALLEM VOM Dorf unterscheidet, ist die totale finanzielle Abhängigkeit des einzelnen von der Gemeinschaft. Alle Mitglieder besitzen die gleichen Rechte, essen die gleiche Nahrung und tragen Hemden gleicher Farbe (und gleicher Größe); entweder haben alle Radios oder keiner; wenn einer ins Kino geht, müssen alle ins. Kino gehen. Ein Kibbuznik hat keine Großmutter mit Familienschmuck, keine Bank, die ihm ein Darlehen gewährt, und keine Firmenkasse, die er plündern könnte.
Dies ist gleichsam die Formel, der Träger jeglicher Gemeinschaft, die die unbedingte Einordnung jedes einzelnen nach sich zieht. Und daß es sogar für einen Ministerpräsidenten keine verrückbaren Grenzen gibt, mag folgende Begebenheit illustrieren: Als Ben Gurion vor einigen Jahren demissionierte und sich in den Kibbuz Sde Boker zurückzog, brachte er das ganze Kollektiv ins Wanken, weil er jede Bevorzugung ablehnte, sogar die ihm vom Arzt vorgeschriebene Diät. Er wollte genauso verköstigt werden wie alle anderen Mitglieder des Kibbuz. Infolgedessen mußten sich also alle auf eine salzlose, proteinarme Kost umstellen. Etwas später wurden für alle Kibbuzmitglieder zwangsweise Griechischkurse eingeführt, weil der Expremier, der bekanntlich ein großer Plato-Ver-ehrer ist, die Lehren dieses klassischen Denkers nicht allein auf sich nehmen wollte...
ENTSCHEIDUNGEN, WIE BERUFSWAHL ODER Ausbildung des einzelnen, werden durch den Rat der Ältesten gefällt. Wer von der Gemeinschaft als begabt befunden worden ist, dem steht jede berufliche Möglichkeit offen: Der Kibbuz kommt dafür auf; sei es für ein Hochschulstudium, sei es für einen Ausbildungsaufenthalt in Europa. Der Kibbuzbewohner“, hat also bei entsprechendem Wissen alle Chancen, sich von der manuellen Arbeit, der Landwirtschaft etwa, loszulösen und der Gemeinschaft seinen Geist zur Verfügung zu stellen. Da die Kibbuzbewegung auf Freiwilligen basiert, steht es jedem frei, wieder in die Stadt zu ziehen. Doch kommt dies selten vor. Denn das Verlockendste ist doch die Sicherheit, im Alter zwar unabhängig von der eigenen Familie, versorgt und doch nicht einsam zu sein. Immerhin besteht die Tendenz der Rückkehr zum Familienleben in den älteren Kibbuzim. Aus dieser Erwägung heraus wurde eine Tochtersiedlung gegründet, genannt „Moschaw Schitun“, die den Wohnsitz als privates Eigentum jeder Familie deklariert.
Solcherart mit spezifisch israelischen Neuigkeiten versorgt, wurde mir sodann ein Wohnraum in einem kleinen Holzhaus zugewiesen. Da die Saison schon vorbei war, befanden sich nur noch zwei Holländerinnen als Besuchsarbeiter auf dem Kibbuz. Die beiden waren aber mit der Unfreundlichkeit des „Fliegenden Holländers“ gesegnet und störten so die traute Touristendreisam-keit durch ihre Antipathie gegen das Naturleben. Vielleicht war dies aber nur der Widerhall, die gespeicherte Depression zweier Arbeitswochen, in denen beide im Hühnerstall ängstlich und mutlos der gackernden Gefahr gegenüberstanden. Ich war also heilfroh, nicht dem eierlegenden Heer der 6000 zugeteilt zu werden, sondern dem Kuhstall.
90 KÜHE ERFORDERN EINE MENGE ARBEIT, speziell dann, wenn sie nicht auf die Weide geführt werden können. Dies aus zwei Gründen: einerseits wegen der geringen Entfernung zur jordanischen Grenze und anderseits wegen der recht spärlichen Bewässerung des nördlichen Negev-Gebietes. So ist es wirklich erstaunlich, daß die Tagesdurchschnittsproduktion einer Kuh 38 Liter Milch beträgt! Da der Kibbuzrat beschloß, die Äpfelernte zu beschleunigen, wurden alle verfügbaren Kräfte ins „Paradies“ beordert, und ich war meinen ruhigen Posten los. Auch eine Mädchenmaturaklasse aus Tel Aviv, in deren Lehrplan ein zweiwöchiger Kibbuz-aufenthalt vorgeschrieben war, wurde dorthin kommandiert. Die jungen Mädchen waren sich aber keineswegs ihrer Funktion als äpfelpflückende Evas bewußt und schienen den paradiesischen Sündenfall mit bequemster Ruhestellung koordinieren zu wollen. Von diesem einschläfernden Ehrgeiz aufgestachelt, turnte ich mit umgehängtem Kübel wie ein Rheumatismuskranker auf den Obstbäumen herum und hatte es wahrscheinlich nur der guten Menschenkenntnis des Pflük-kerhäuptlings zu verdanken, daß ich kurz darauf — und zwar für die restlichen vier Wochen meines Kibbuzaufenthaltes —, wieder ins milchspendende „Cowboyareal“ verwiesen wurde.
Nach siebenstündiger Arbeitszeit und einem Plauderstündchen in der Gemeinschaftsdusche — nur für Herren, natürlich! — ward ich dann stiller Genießer der ruhigen und beschaulichen Kibbuzherrlichkedt. Recht schwierig allerdings gestaltete sich die Kontaktnahme mit den Israelis außerhalb der Arbeitszeit. Weniger aus politischen Erwägungen (gibt es doch Kibbuzim, die Deutschen keine Aufenthaltsgenehmigung erteilen) als aus der Idee heraus, sich gegen jegliche Umwelt-beeinflussung abzukapseln, die den israelischen Wehrbauern eigen ist. Sogar für einen eingewanderten Juden kann es zum Problem werden, wirklich und hundertprozentig in der Kibbuzgemeinschaft Fuß zu fassen. Jose beispielsweise hatte zu Beginn der Castro-Diktatur Kuba verlassen. Er war in Havanna Eigentümer zweier Friseursalons gewesen und spielte nun als Dreißigjähriger in der Kibbuzküche wohl oder übel den Handlanger. In den drei Jahren seines Kibbuzaufent-haltes war es ihm unmöglich gewesen, einen guten Freund zu finden. *
DIE ZU NEUEM LEBEN ERWECKTE OFFIZIELLE Landessprache, das Hebräische, ist da eine Untermauerung des Solidaritätsgedankens. Es gibt nun Kibbuzim — meistens sind es die älteren —, in denen im sogenannten ..Ulpan“ sechsmonatige Hebräischkurse abgehalten werden, die auch Nicht Juden besuchen dürfen. Trotzdem gibt es Neueinwanderer, die nach drei, vier Jahren einen Straßenpassanten in fließendem Hebräisch ansprechen: „Bitte, sagen Sie mir, wie spät es ist, aber womöglich auf Englisch.“
Es ist erstaunlich, mit welch bewundernswerter Energie und Zielstrebigkeit sich Israel — trotz der arabischen „Faust im Nacken“ — weiterentwickelt. In Tel Aviv und Haifa (Jerusalem liegt ja selbst an der Grenze) blickt man also sorgenvoll zu den Grenzkibbuzim, die sich bei einer etwaigen arabischen Großoffensive keiner leichten Aufgabe gegenübersähen. Stacheldraht,
Minen und Bunker sind daher kaum wegzudenken, und bewaffnete Wachtposten, die nachts patrouillieren, gemahnen stets an die unmittelbar drohende Gefahr.
Dessenungeachtet versuchen die Araber die eigene — niedrige — Milchproduktion zu steigern, indem sie in nächtlicher Stunde die Grenzkibbuzim um einige Kühe erleichtern. Daß man aber gerade einen jordanischen Meisterdieb nach dem Kibbuz Dvir entsandte, spricht für die dort herrschende gute Tierhaltung. Es geschah also eines Nachts, daß besagter Kuhdieb plötzlich vor dem Wachtposten erschien und ihn mit bewundernswerter Frechheit, fragte, wer er sei. Der Posten — im Glauben, der andere sei ein Kibbuz-nik — antwortete treuherzig: „Ich? Ich bin der Wächter!“ Der jordanische Kuhdieb schien seine Überraschung über so viel Offenheit rasch überwunden zu haben, denn er reagierte blitzschnell, schoß den Mann in den Oberschenkel und flüchtete eilends — freilich ohne Kühe.
Daß es aber nicht immer so burlesk zugehen muß, zeigt etwa -die Bombardierung des Kibbuz Dan in jüngster Vergangenheit. Überhaupt sind arabische Attacken gang und gebe. Doch werden kleine Geplänkel gar nicht erst bekanntgegeben, sondern einer „internen Behandlung“ zugeführt. Ein „heißes Pflaster“ ist noch immer der Gazastreifen. Dort hat jeder Kibbuznik beim Badengehen seinen Leibwächter, der den Schwimmenden mit entsichertem Gewehr vor Überraschungsangriffen der Ägypter schützt. Geradezu an Selbstmord grenzt es aber, im Jordan zu baden und sich von als biedere Zeltbewohner getarnten Arabern ans jenseitige Ufer locken zu lassen. Damaskus wäre das Ziel!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!