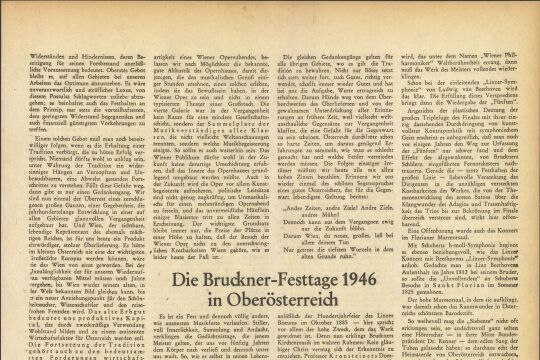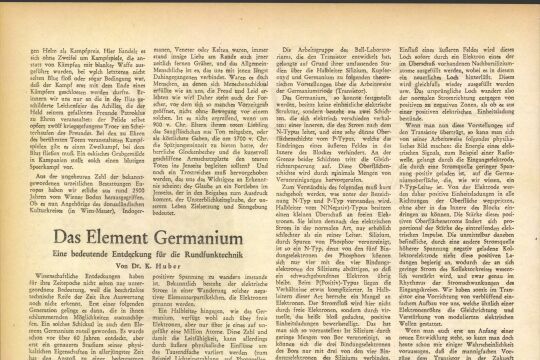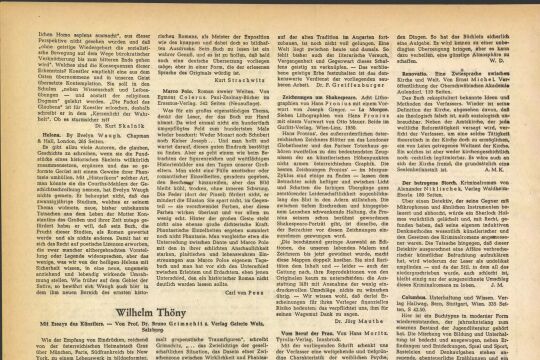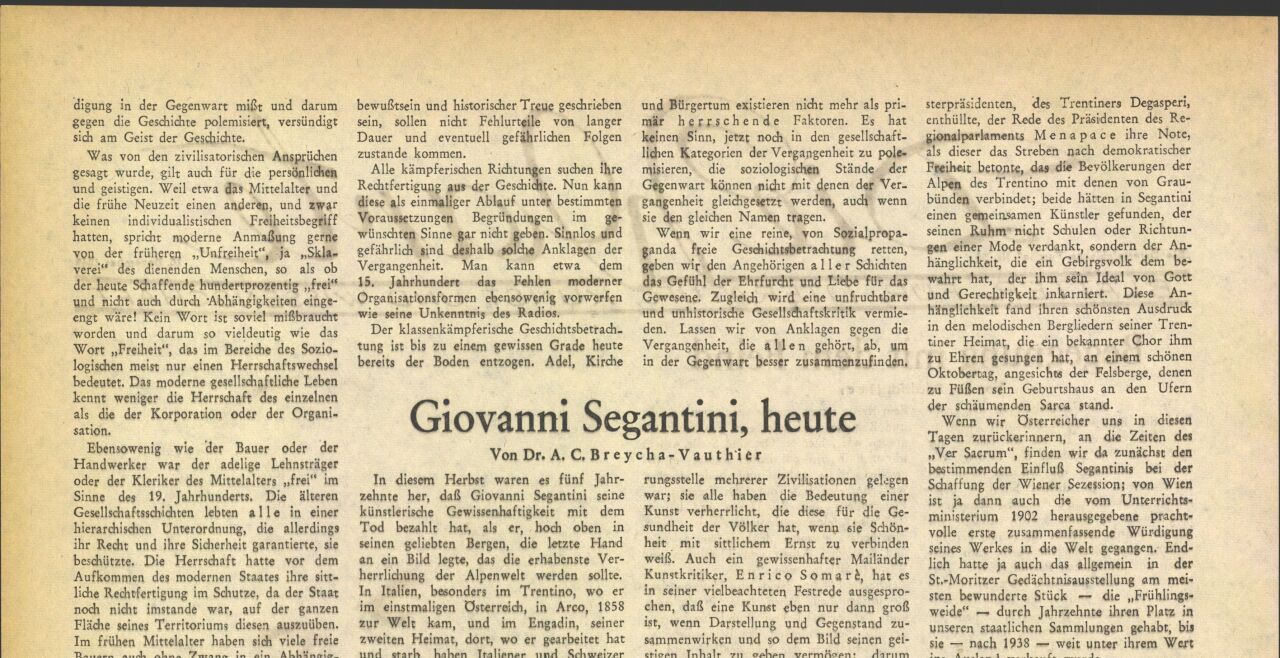
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Giovanni Segantini, heute
In diesem Herbst waren es fünf Jahrzehnte her, daß Giovanni Segantini seine künstlerische Gewissenhaftigkeit mit dem Tod bezahlt hat, als er, hoch oben in seinen geliebten Bergen, die letzte Hand an ein Bild legte, das die erhabenste Verherrlichung der Alpenwelt werden sollte. In Italien, besonders im Trentino, wo er im einstmaligen Österreich, in Arco, 1858 zur Welt kam, und im Engadin, seiner zweiten Heimat, dort, wo er gearbeitet hat und starb, haben Italiener und Schweizer ein Ausstellungen und verschiedenen Veranstaltungen seiner gedacht.
Was man in diesen Wochen sah und hörte, war oft recht verschieden von den üblichen Jubiläumsfeiern. Zunächst fiel die große Beteiligung des Volkes auf, dessen Arbeitstag Segantini zum Symbolwert gestaltet hatte. Diese stille Anhänglichkeit seiner Landsleute — tragend wie ein Volkslied, denn ein Gesang der Arbeit, wie ihn manche da heraushören wollten, wäre eine zu sentimentale Auffassung des harten Menschen der Berge — war im Engadin wie im Trentino das Sichtbarste; ging sie doch weit über den Kreis hinaus, der sich für gewöhnlich mit Dingen der Kunst befaßte. Das wechselvolle Schicksal des Waisenknaben, das in dieser abenteuerlichen, harten Schule sich nicht verloren hatte, sondern zum Maler der Natur und der Berge heranreifte, dieses Schicksal seiner Wanderschaft, das vielen bereits aus einigen Geschichten ihrer Lesebücher in der Erinnerung geblieben sein mochte, verbunden mit der auf immer tieferer Naturbeobachtung gegründeten Wahrhaftigkeit des Künstlers, hatten rasch den Kontakt hergestellt; „p r ä z i s“ war das Wort, in dem wortkarge Bauern, die man vor seinen Bildern sich drängen sah, zumeist ihre Anerkennung, ihren Beifall zusammenfaßten. Das Geheimnis seiner Größe hat uns — weniger lakonisch — wohl am treffendsten sein Sohn G ot- ta r d o, Schüler und Biograph des Vaters, vermittelt, wenn er kürzlich schrieb: „Das Menschliche und das Landschaftliche, in Verbindung mit den Tieren, wird in eine rhythmische Harmonie gefaßt, in der die Massen, die Linien und die Farben den
Rahmen bilden für Empfindungen, die über das Malwerk hinaus nachsinnen lassen.“
Dieses Verständnis der einfachen Menschen hat Gottardo Segantini auch recht gegeben, als er einleitend zur großen Ausstellung der Schöpfungen seines Vaters, die im Rahmen der Berge, in St. Moritz, vereinigt worden waren, feststellte, daß es sich heute im Hinblick auf manche neuen Entwicklungen in der Malerei notwendig erweisen werde zurückzukehren, zu einer Auffassung der Kunst, die auch für den normalen Menschen noch verständlich bleibt. Dieser Ruf einer Rückkehr zu Segantini, im Dienst einer „normalitä“, die una sana intelligenza umana, hat auch über die Grenzen hinaus sein Echo gefunden, in' den offiziellen Reden, als Schweizer und italienische Regierungsmitglieder gemeinsam den Künstler feierten, dessen Ursprung an der Berüh rungsstelle mehrerer Zivilisationen gelegen war; sie alle haben die Bedeutung einer Kunst verherrlicht, die diese für die Gesundheit der Völker hat, wenn sie Schönheit mit sittlichem Ernst zu verbinden weiß. Auch ein gewissenhafter Mailänder Kunstkritiker, Enrico Soma rl, hat es in seiner vielbeachteten Festrede ausgesprochen, daß eine Kunst eben nur dann groß ist, wenn Darstellung und Gegenstand Zusammenwirken und so dem Bild seinen geistigen Inhalt zu geben vermögen; darum die großen Möglichkeiten gerade auch des geistlichen Kunstwerkes. Diese von den verschiedensten Seiten zum Ausdruck gebrachte Aktualität Segantinis war das zweite Charakteristische an diesem Jubiläum.
Segantini gehört ganz dem Menschenschlag der südlichen Alpen an — ein Mon- tanaro, Sohn einer Bergrasse, die von Friaul bis in das Piemontesische hin den Menschen prägt. So war es denn auch nur natürlich, daß in diesen Feiern die stille Solidarität der Gebirgsvölker ihren schönen Ausdruck fand. Sie klang aus der amtlichen Botschaft, die durch eine Stafette aus dem italienischen Chiavenna in die Schweiz gebracht wurde und die von einer kommenden Zeit sprach, in der die Großen einander Mitbürger in einer gemeinsamen Welt sein werden. Sie gab auch, als man in Arco den Segantini-Brunnen unter großer Teilnahme einer ganzen Bevölkerung und unter dem Patronat des italienischen Mini sterpräsidenten, des Trentiners Degasperi, enthüllte, der Rede des Präsidenten des Regionalparlaments Menapace ihre Note, als dieser das Streben nach demokratischer Freiheit betonte, das die Bevölkerungen der Alpen des Trentino mit denen von Graubünden verbindet; beide hätten in Segantini einen gemeinsamen Künstler gefunden, der seinen Ruhm nicht Schulen oder Richtungen einer Mode verdankt, sondern der Anhänglichkeit, die ein Gebirgsvolk dem bewahrt hat, der ihm sein Ideal von Gott und Gerechtigkeit inkarniert. Diese Anhänglichkeit fand ihren schönsten Ausdruck in den melodischen Bergliedern seiner Tren- tiner Heimat, die ein bekannter Chor ihm zu Ehren gesungen hat, an einem schönen Oktobertag, angesichts der Felsberge, denen zu Füßen sein Geburtshaus an den Ufern der schäumenden Sarca stand.
Wenn wir Österreicher uns in diesen Tagen zurückerinnern, an die Zeiten des „Ver Sacrum“, finden wir da zunächst den bestimmenden Einfluß Segantinis bei der Schaffung der Wiener Sezession; von Wien ist ja dann auch die vom Unterrichtsministerium 1902 herausgegebene prachtvolle erste zusammenfassende Würdigung seines Werkes in die Welt gegangen. Endlich hatte ja auch das allgemein in der St.-Moritzer Gedächtnisausstellung am meisten bewunderte Stück — die „Frühlingsweide“ — durch Jahrzehnte ihren Platz in unseren staatlichen Sammlungen gehabt, bis sie — nach 1938 — weit unter ihrem Wert ins Ausland verkauft wurde.
Wer während dieser letzten fünfzig schicksalsschweren Jahren so lebendig geblieben ist, hat gute Aussicht, auch kommenden Generationen mehr als eine bloße Episode zu bedeuten. Als Schöpfer einer Malweise, die ihn berühmt gemacht hat — des Divisionismus — ist dieser große Einzelgänger, der so außerhalb jeder Tradition und außerhalb aller Entwicklungsstufen der modernen Kunst gestanden war, vielen erschienen. Sie sahen und bewunderten wohl den Maler; den Künstler, den Menschen und Denker, dessen Schriften in ihrer elementaren Gelassenheit seinen Gemälden gleichen, hatten sie jedoch bei- seitegelassen. Gerade die jüngsten Gedenktage haben es uns aber gezeigt, daß wir vielleicht erst jetzt genügend Distanz gewonnen haben, um die ganze Bedeutung des Werkes zu begreifen, das dieser unermüdliche Arbeiter im Weinberg des Herrn geschaffen hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!