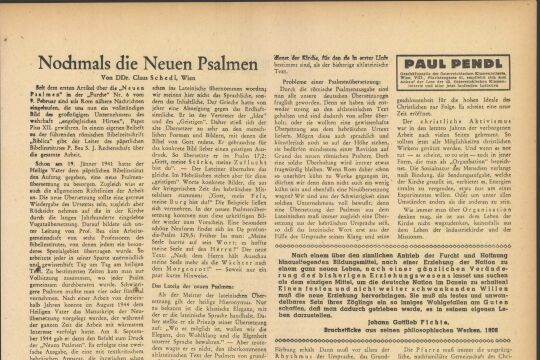Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Christus in Matzleinsdorf
An schönen Frühlingstagen rasen sonn- und feiertags tausende Mobile an der mitten in der Wiedner Hauptstraße stehenden Matzleinsdorfer Kirche vorbei und kehren in den Abend- und Nachtstunden in schier endlosen Kolonnen von der Südbahnstrecke heim. Kaum ein Fahrer, kaum ein menschlicher Inhalt dieser Wagen weiß etwas von dem schönen, schweren, nothaften Leben der Menschen, die zu dieser Kirche „gehören“. Etwa 80 Prozent von ihnen stehen dem kirchlichen Leben fern und besuchen keinen Gottesdienst mehr. Da sie nicht in die Kirche kommen, hat sich die Kirche aufgemacht, um sie zu suchen und zu besuchen. In einem Arbeitsjahr hat ihr Pfarrer an rund 3000 Türen geklopft, 1000 Hausbesuche kamen zustande, so oft also wurde ihm aufgetan; und sei es auch nur, manchmal, für ein Wort der Abweisung.
Theodor Blieweis hat bereits vor 20 Jahren als Junger Kaplan Hausseelsorge dieser Art betrieben, darüber auch in einem Buch berichtet, das erst nach 1945 herauskommen konnte. Schwer wiegt seine Erfahrung, seine Überzeugung: „Die zwanzig Jahre haben die Menschen noch mehr dem religiösen und kirchlichen Glauben entfremdet.“ Dafür finden wir in den knappen Berichten über tausend Hausbesuche Teiche, manchmal erschütternde Belege. Was auffällt, ist nicht ein offener, brennender Haß, ein Schrei der Erbitterung — auch ganz kirchenfremde, außerchristlich und areligiös lebende Menschen begegnen dem an der Tür stehenden Pfarrer meist recht höflich. Es ist ein anderes, schwierigeres: eine trockene, harte Art der Ablehnung, der inneren Verwehrung. Das alles, was die Kirche, Pfarrer. Christentum verkünden und lehren, geht viele dieser unserer Zeitgenossen offensichtlich gar nichts an, und sie sagen das auch, so ruhig, wie man in einem Schuhgeschäft es ablehnt, ein vom Verkäufer angebotenes Paar Schuhe zu kaufen. Diese Ware, die der Mann da in der Türe anbietet, wird nicht gefragt.
Das ist ein Leitmotiv, eine Erfahrung, die der Pfarrer dieser Wiener Großstadtpfarre bei Menschen jeden Alters und jeden Standes machen kann: bei Kleinbürgern, Universitätsprofessoren, Beamten und Arbeitern, bei einer jungen, hübschen und gepflegten Frau, erbitterten Alten, die mehr als 80 Jahre alt sind, bei jungen Mädchen und Männern ün „besten Alter“. Bei Christen und Christen: ja, wir verlesen uns nicht. Ein Kapitel trägt eben diesen Sammeltitel: „Christen und Christen.“ Es gibt unter uns, vielleicht manchmal mitten in uns, ein Menschentum, das sich ganz selbstverständlich für christlich hält und von den Rudimenten christlichen Lebens, christlicher Lebensgestaltung tausend Meilen und mehr entfernt ist. Neben trockener, harter Verwehrung begegnet dem Wiener Pfarrer viel mehr als man erwarten würde, nackte Not. Leibliche Not, seelische Not; Krankheit, Einsamkeit, Verbitterung. „Hinter den Kulissen der Ehen“: wie viele Höllen haben sich da Menschen bereitet. Zerrüttete Ehen, Konkubinate aller Art, „Verhältnisse“, verworren in Elend und Ausweglosigkeit, bilden wohl die breiteste Grundlage für religiös und innermenschlich gescheiterte Lebensformen. Daneben sind es Krankheit, sind es nicht vernarbte Schicksalswunden und so viele Grenzfälle, in denen, im Lebensweg eines einzigen Menschen, alles zusammenzustoßen scheint, was Schuld und Schicksal zu brauen vermögen.
Der Wiener Großstadtpfarrer Theodor Blieweis dramatisiert nicht: er läßt die „Fälle“ selbst sprechen. Er sieht die Not, sieht die Menschen, weiß und sagt es auch, daß er oft nicht „helfen“ kann: er kapituliert aber auch nicht. Das scheint uns das wichtigste Element dieses gewiß nicht „erbaulichen“, aber aufbauenden Berichtes zu sein: hier wird der
Mensch, wie er heute lebt, wohnt, gesehen, wie er ist, und hier wird ohne Illusionen, ohne falsche, vorschnelle Hoffnung, aber auch ohne jede Hysterie, Torschlußpanik, Untergangsangst dieser Mensch gesucht, angenommen, akzeptiert: nüchtern, klar, ruhig kommt hier die Kirche zu unseren Zeitgenossen. Die drei letzten Skizzen gelten einem abgefallenen Ehepaar, einem 63jährigen Kommunisten („In seiner Weise sicher ein wertvoller Mensch, der für eine große Idee wirklich viele Opfer brachte...
Ein aufrechter, gerader Charakter, aber ohne eine Spur von religiösem Glauben. Möge Gott seiner Seele einmal gnädig sein!“) und, ganz zuletzt ein „totaler Unglaube“, eines alten, krebskranken Mannes. Dieser schleudert dem Pfarrer die Worte ins Gesicht: „Sie glauben ja selber nicht an das, was Sie mir sagen.“ — Das, kurz, im letzten Kapitel. Kein falscher Trost also, hier, im Schluß des Berichtes. Dennoch legt man dieses Buch in der Karwoche nicht ungetröstet aus der Hand. Dies der merk-würdige Gesamteindruck: So viele „trostlose“ Verhältnisse, neben einigen Lichtblicken, erwecken keinen trostlosen Eindruck, denn im Bericht selbst wird, ganz schlicht, eben dies sichtbar: ein starker Glaube. Die Kirche ist auf dem Wege zum Menschen. Zu eben den Menschen, an denen wir tagtäglich vorbeifahren, vorbeisehen. Menschen, die sich um Gott, um uns nicht viel kümmern. Und die doch Türen haben, die sich öffnen, wenn sie gesucht werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!