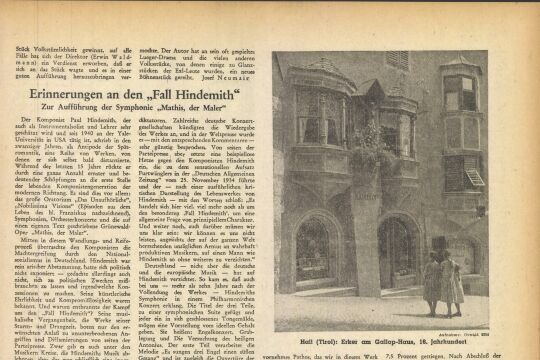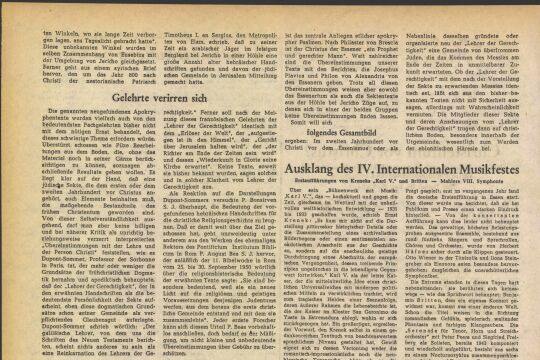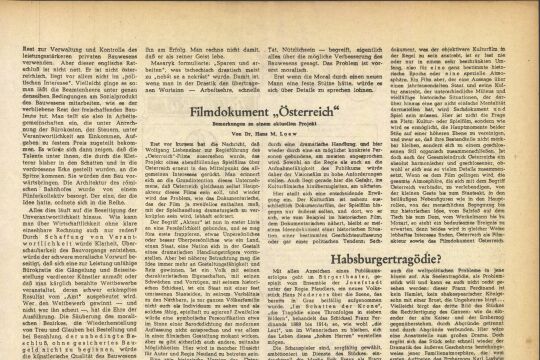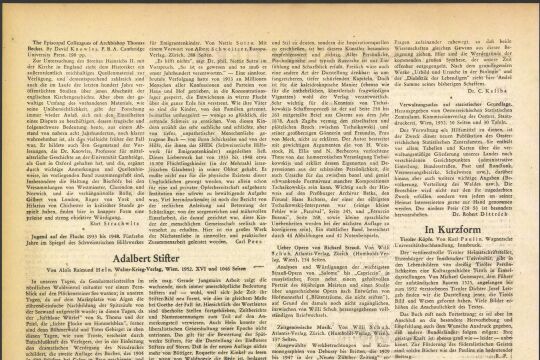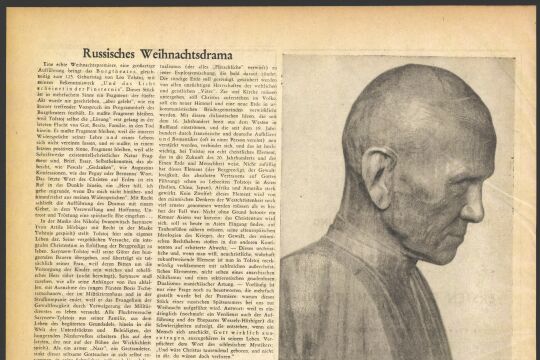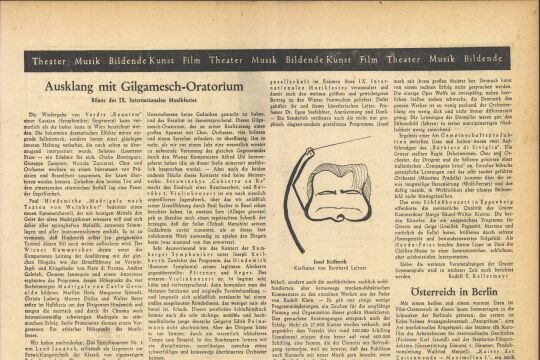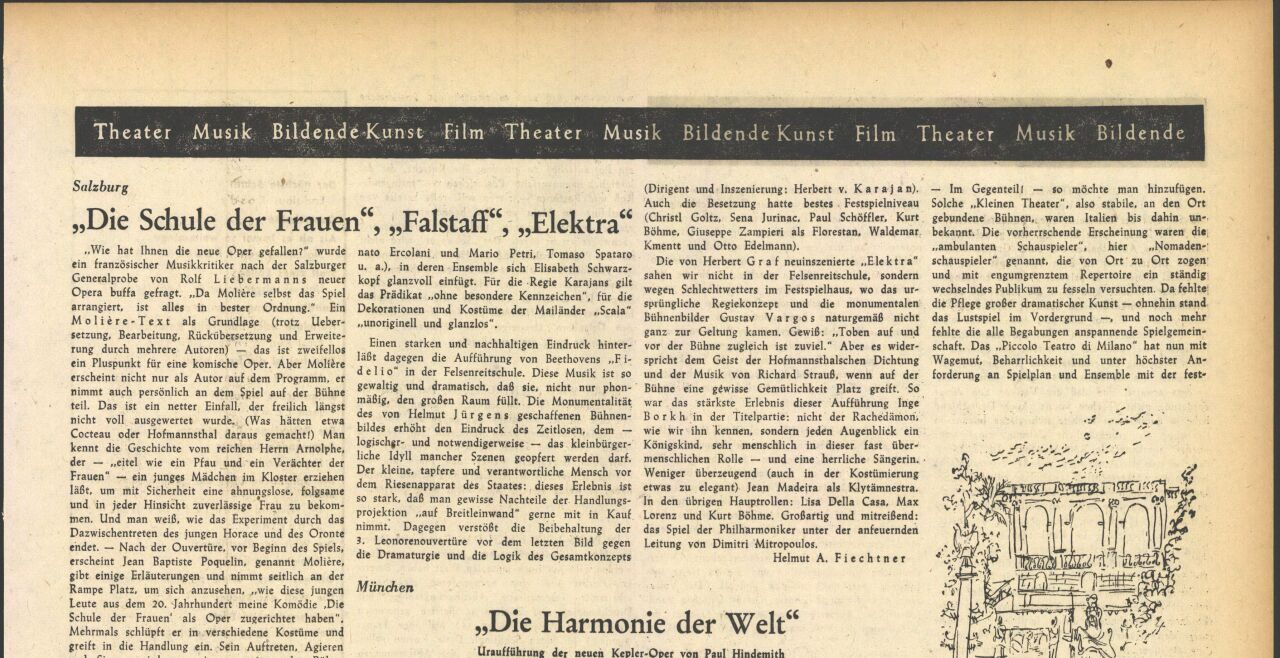
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Die Harmonie der Welt”
Rund fünfundzwanzig Jahre liegen zwischen Hindemiths Meisteroper „Mathis, der Maler” und seinem vorläufig letzten musikdramatischen Werk „Die Harmonie der Welt”, mit dem die heurigen Festspiele der Bayerischen Staatsoper eröffnet wurden. Seit Kriegsende hat es Wohl kaum ein Ereignis gegeben, bei dem die musikalische Fachwelt und Prominenz so vollständig versammelt gewesen wäre. Ein neues Werk des führenden deutschen Komponisten, der vielversprechende und schwierige Stoff, mit dem sich, wie man wußte, Hindemith seit vielen Jahren beschäftigte und dessen Konzept im Laufe der Zeit verschiedene Modifikationen erfahren haben ihag, die lange Pause zwischen „Mathis” und der neuen Oper — dies alles schuf eine Stimmung hochgespannter, zum Teil’ auch’ etwas ängstlicher Erwartung. Mit diesem Gefühl betraten vor allem jene den Zuschauerraum, die den 70 Seiten umfassenden, vom Komponisten selbst geschriebenen Text des Werkes und den dicken Klavierauszug studiert hatten. Wie würden sich die vielen Szenen und Bilder (mehr als ein Dutzend) zum Ganzen fügen? Wie wird dem Komponisten ‘diiį Bewältigung, dieses philosophisch und kulturgeschichtlich schwer belasteten Textes gelingen? Wie wird auf der Bühne die vor fünf Jahren aus der Orchestersuite bekannte Musica Instrumentalis, die Musica mundana’ und die Musica humana illustriert? Wie, schließlich, werden Regisseur und Bühnenbildner die simultanen Schauplätze, die Visionen und vor allem die Schlußapotheose gestalten, in der sich die Hauptdarsteller in Sternbilder verwandeln und, gemeinsam mit dem Chor, in zwölfstimmigem Gesang zusammenklingen?
Was Hindemith hier, mit einem kühnen Griff nach den Sternen, versuchte, konnte keine Oper im herkömmlichen Sinne werden. Aber es entstand auch kein religiös-philosophisch-wissenschaftlich-histöri- sches Traktat. Davor bewahrten ihn so lebendige, interessante, phantastisch-hintergründige und wahrhaft dramatische Gestalten wie Wallenstein und der kaiserliche Mathematiker Johannes Kepler, Kaiser Rudolf II. und der eifernde Pfarrer Hizler aus Linz,. Keplers Mutter, die zauberisch-lunatische Züge, trägt, schließlich der Tansur (wohl ein Anagramm von „Saturn ) und die rührende Menschlichkeit der Susanna-, Keplers späterer Frau.
Dieses, Pandämonium dramatisch zu gestalten — dazu freilich hätte es eines Dichters bedurft, und wir wissen unter den Lebenden kaum einen Namen zu nennen, der diesem Stoff und seinen Anforderungen hätte gerecht werden können. Vor etwa zwei Jahren äußerte sich einmal Hindemith: „Wenn es einen Dramatiker vom Range Gottfried Benns gäbe (der ihm seinerzeit den Text zu dem Oratorium „Das Unaufhörliche” schrieb), dann müsse er nicht seine Zeit statt mit Komponieren mit mühevollem „Dichten” verbringen. — So kommt es, daß der Text epische Längen aufweist, deren auch der Musiker Hindemith nicht Herr werden konnte. So kommt es, daß trotz verschiedenartigster Formen, die angewendet, werden (Lied, Marsch, Passacaglia, Variation, Gespräch = Rezitativ u. a.), eine gewisse Gleichförmigkeit herrscht, die durch einen etwas lehrhaften Kontrapunkt, durch ständiges Variieren, Fugieren und Imitieren unterstrichen wird. Große Variabilität zeigen dagegen die Chöre: des Volkes von Prag, Linz und Güglingen in Württemberg, der Studenten, - Offi? ziere und Kurfürsten, der Stimmen des Mondes, der Erde und der Planeten. „Möge uns doch auch die Schau in Fernen, die uns voll frommen Wohlklangs umgebqn,.-,.4nig Trauma? AhnWc gläubigen Gebet üb£g Adas geringe SelJįstffierhebėnrerecrj-šingpn: Cfcor und Soli in der Schlußapotheose zum Kreisen der Gestirne. — Die persönlichsten und ergreifendsten Töne findet Hindemith im Lyrischen: bei der Schilderung des Kindes und der Frau Susanna und im Ausdruck der an Palestrina und Hans Sachs erinnernden Stimmung elegischer Resignation („Vergeblich — das wichtigste Wort am End, das man als Wahrheit tiefinnerst erkennt”).
Die szenische Realisierung dieses anspruchsvollen und in jeder Hinsicht schwierigen Werkes war Rudolf Hartmann (als Spielleiter) und Helmut Jürgens (als Bühnenbildner) anvertraut. Nach der Münchener Uraufführung, die vom Komponisten geleitet wurde, hatte man nicht den Eindruck, daß alles Optische optime gelöst war. Die einzelnen Bilder zeigten allzu verschiedene Stile, die Erscheinungen wirkten zu realistisch und das vom Komponisten geforderte prunkvolle Bild eines barocken Himmelsgemäldes mit den tänzend-kreisenden Planeten wirkte etwas dürftig. Hervorragend waren die Leistungen des Chors und des Orchesters, befriedigend bis gut — aber niemals faszinierend — die der Hauptdarsteller Josef Metternich, Richard Holm, Marcel Cordes, Kurt Wehofschitz, Liselotte Fölser und Hertha Töpper, die als Keplers Mutter die stärkste Leistung bot.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!