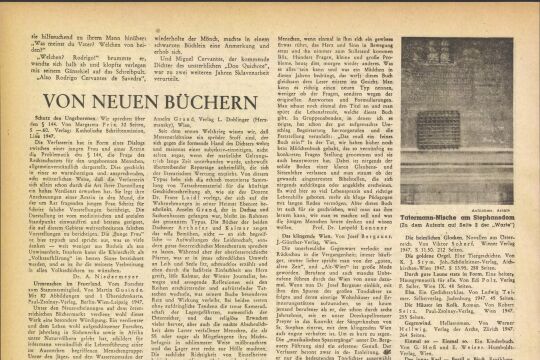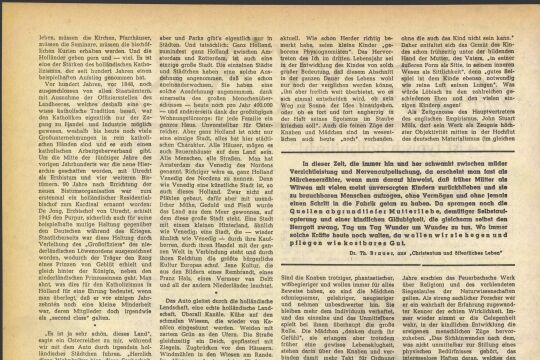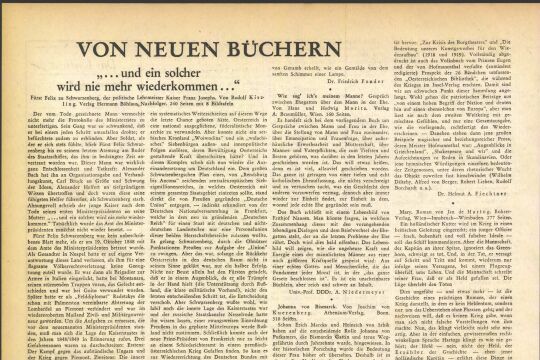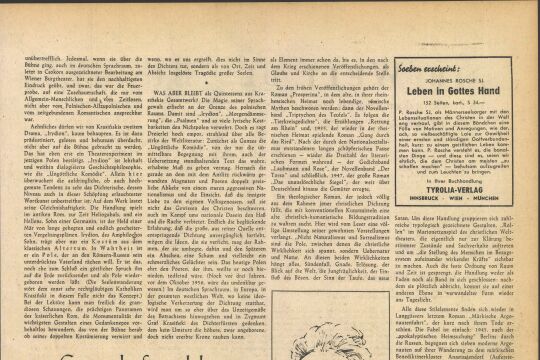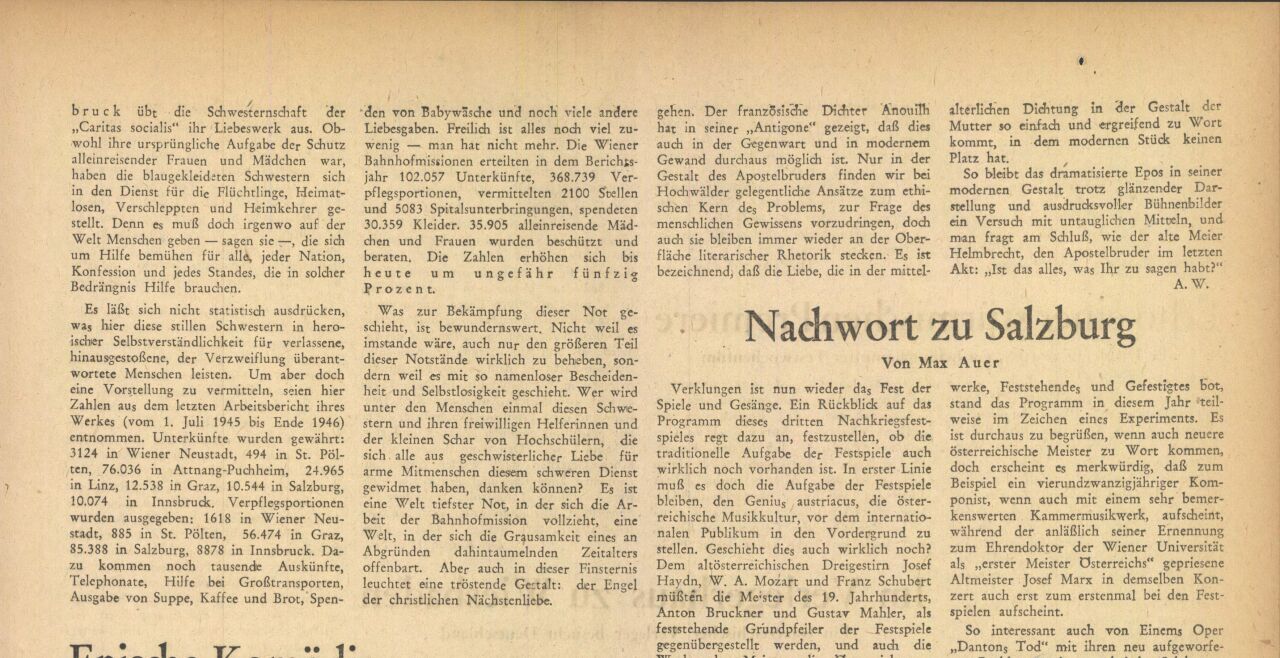
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Epische Komödie und dramatisiertes Epos
Der breitangelegte epische Charakter, der einen großen Teil der Literatur Amerikas und daneben auch die künstlerisch wertvollsten Schöpfungen seiner Filmproduktion auszeidinet, ist wohl aus der landschaftlichen Gestalt des ungeheuren Kontinents, aus den „weiten, offenen Räumen“ erwachsen, und dieses weitgespannte epische Lebensgefühl der jungen amerikanischen Literatur finden wir auch in dem Stück des bedeutendsten zeitgenössischen Dramatikers der Neuen Welt, in Eugene O'Neills ,Ah, Wilderness“, mit dem das Volkstheater die Saison eröffnet. Felix Braun hat kürzlich in einem Vortrag über Stifter darauf hingewiesen, daß die großen epischen Werk von „Ilias und Odyssee“ bis zu „Hermann und Dorothea“ und zum „Nachsommer“ ohne Problem auskommen, und die Problemlosigkeit epischer Dichtung erweist sich auch an dieser episdien Komödie. Mit viel Liebe wird hier das Leben einer amerikanischen Mittelstandsfamilie gesdiildert und von der kleinen Unruhe erzählt, die in diese geordnete Welt kommt, da sich der heranwachsende Sohn, der seine Liebe verschmäht glaubt, am Abend des Unabhängigkeitstages sinnlos betrinkt. Diese bald behobene Unordnung — der deutsdie Titel „Verwirrung der Jugend“ ist viel zu kraß und „problematisch“, während der amerikanische „Oh, Wildnis!“ bezeichnenderweise von einem Zitat aus dem Rubaiyat des Omar Khayyam genommen ist — bedeutet wirklich kein Problem. So liegt der Reiz der Komödie einmal in der zarten, behutsamen Schilderung der Seelenzuständie heranwachsender Jugend, zum anderen in dem humorvoll gezeichneten Bild des amerikanischen Familienlebens, wo in der familiären Gewaltenteilung die Jugend die gesetzgebende und die Mutter die richterliche Gewalt ausübt, während sich der Vater mit der Exekutive begnügen muß. Noch bevor die amerikanische Soziologie durch eingehende Untersuchungen dargetan hatte, daß im amerikanischen Familienleben — bedingt durch die Situation innerhalb der Einwandererfamilien sowie durch die rasch wechselnden Lebensverhältnisse — nicht die jüngere Generation das Beispiel der älteren nachahmt, sondern umgekehrt die Eltern von den Kindern lernen, hat O'Neill diesen Vater gezeichnet, erweitert seine geistige Welt durch die Lektüre der Büdner seines Sohnes. Er erhält von der Mutter den Auftrag, die Kinder zu bestrafen und bricht schließlich im letzten Akt den verspäteten Aufklärungsversuch mit der rührend-hilflosen Bemerkung ab, daß die Jungen das alles ohnedies viel besser wissen als er. Diese Szene war vor etwa zehn Jahren am Broadway ein Glanzstück eines berühmten Charakterdarstellers, und es ist schade, daß die Regie im Volkstheater gerade diese Besonderheit des amerikanischen Familienlebens nicht stark genug herausarbeitet. Doch genießt man zu einer Zeit, da der Theaterbesudier von der Bühne aus so häufig mit einem Bündel ungelöster Probleme bombardiert wird, doppelt die problemlose Sauberkeit, die Frische und
Zartheit der Zeichnung des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern.
Das fällt besonders auf, wenn man diese epische Komödie mit dem neuen Stück der Josefstadt, dem dramatisierten Epos „M e. i e r Helmbrecht“ vergleicht, in dem audi das Verhältnis zwischen Vater und Sohn im Mittelpunkt der Handlung steht. Das mittelalterlidie Vorbild, die epi sdie Dichtung Wernher des Gärtners, erzählt von Hochmut und Fall des Bauernsohnes, dem sein Stand zu gering war, der ein Ritter werden wollte und doch nur ein Räuber wurde, und den sddießlich das von seinem Vater längst prophezeite Geschick ereilt. Es ist das Bild der festgefügten mittelalterlichen Ordnung in starker, dichterischer Gestaltung. Welch wunderbare Symbolkraft besitzt doch allein die an den berühmten Schild des Achilles in der Ilias gemahnende Beschreibung der Haube des jungen Helmbrecht! Es ist das Bild einer stabilen, festgefügten Gesellschaft, in der jeder Stand seinen bestimmten Platz hat und der Sohn von Anfang an in die Fußtapfen seines Vaters treten soll, in gewisser Hinsicht das genaue Gegenteil zu der von O'Neill gezeigten dynamischen Gesellschaft des modernen Amerikas, in der jeder Junge von der Möglichkeit träumt, einmal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Doch ist beiden Gesellschaftsordnungen die Anerkennung bestimmter fester Wertmaßstäbe und Moralbegriffe — die in beiden Fällen letztlidi aus der religiösen Sphäre stammen — gemeinsam.
Die Störung der gottgewollten Ordnung und ihre schließliche Wiederherstellung durch die harte Strafe, die den Friedensbrecher trifft, ist das große Thema der mittelalterlichen Dichtung. Neben dieses, den Gang der Handlung auch in der modernen Fassung bestimmende Thema, hat nun Fritz Hochwälder, getreu seiner schon im „Heiligen Experiment“ gezeigten Vorliebe für aktuelle politische Diskussion in historischer Gewandung, die dick aufgetragene Gegenwartsproblematik der Kollektivsdiuld, der Schuld durch Duldung und des Mitläufer-tums unter Konzentrierung auf die Gestalt des Vaters gepreßt und dadurch die einheitliche thematische Linienführung zerbrochen. Dadurch werden die Gestalten zu schablonenhaften Allegorien und personifizierten Schlagworten. An die Stelle des menschlich-allgemeingültigen Gehalts der mittelhochdeutschen Diditung, tritt die abgegriffene Phraseologie eines modernen Zeitungsartikels, neben der gelegentliche Anklänge an ein altertümelndes Hans-Sachs-Deutsch nur noch peinlicher wirken.
Wer das von den großen Dramatikern der Weltliteratur behandelte Problem der Schuld erneut in Angriff nehmen will — und es darf keineswegs übersehen werden, daß hier gewiß ein edites, entscheidendes und gerade heute besonders brennendes Problem vorliegt —, der muß doch wohl mit tieferem sittlichen Ernst und Verantwortungsbewußtsein an diese Aufgabe herangehen. Der französische Dichter Änouilh hat in seiner „Antigene“ gezeigt, daß dies auch in der Gegenwart und in modernem Gewand durdiaus möglich ist. Nur in der Gestalt des Apostelbruders finden wir bei Hodiwälder gelegentlidie Ansätze zum ethischen Kern des Problems, zur Frage des menschlichen Gewissens vorzudringen, doch auch sie bleiben immer wieder an der Oberfläche literarischer Rhetorik stecken. Es ist bezeichnend, daß die Liebe, die in der mittelalterlichen Dichtung in der Gestalt der Mutter so einfach und ergreifend zu Wort kommt, in dem modernen Stück keinen Platz hat. /
So bleibt das dramatisierte Epos in seiner modernen Gestalt trotz glänzender Darstellung und ausdrucksvoller Bühnenbilder ein Versuch mit untauglichen Mitteln, und man fragt am Sdiluß, wie der alte Meier Helmbrecht, den Apostelbruder im letzten Akt: „Ist das alles, was Ihr zu sagen habt?“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!