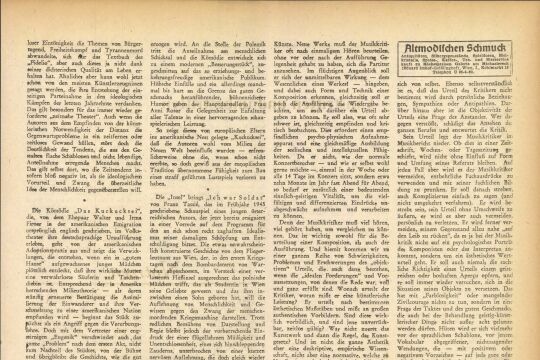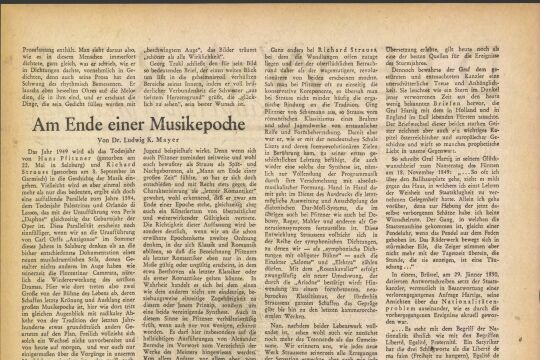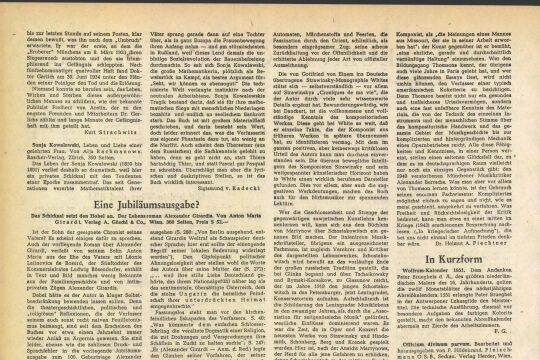Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Grenzen der Kritik
I
Seit Hanslicks Zeiten ist es um die Sachlichkeit und den Ton der Kritik in der Weltmetropole der Musik nicht eben gut bestellt. Wie man weiß, war Hanslick ein Verehrer der Brahmsschen Musik und ein enra- gierter Gegner Wagneirs, also Partei. Seine Fehlurteile über die meisten Meisterwerke seiner Zeit sind so bekannt, daß es sich erübrigt, sie hier zu wiederholen. Heute, da hier und dort versucht wird, Hanslick auf Grund seiner ästhetischen Schriften zu rehabilitieren, muß an ein Wort von Brahms erinnert werden, der zu Richard Specht einmal gesagt hat, Hanslick habe zu seiner — Brahmsens — Musik nie ein wirkliches Verhältnis gehabt. Und an Clara Schumann schrieb Brahms: „Sein Buch ,Vom Musikalisch Schönen“ wollte ich lesen, fand aber gleich beim Durchschauen so viel Dummes, daß dch’s ließ.“ Als Beamter im Unterrichtsministerium und Inhaber einer speziell für ihn errichteten Lehrkanzel für Geschichte und Ästhetik der Musik an der Universität Wien hatte er rund 40 Jahre lang eine einzigartige Machtposition inne und übte das Amit eines Musikdiktators nicht nur mit unnachsichtiger Strenge gegen alles Neutönerische, sondern war in seinem Urteil, leider, auch sehr oft durch persönliche Sympathien und Antipathien bestimmt.
Dieser Typus des Kritikers ist in Wien Tradition geworden, und die Nachfolger Hanslicks berufen sich ganz offen auf ihn. Sein unmittelbarer Nachfolger in der „Neuen Freien Presse“ war Julius Komgoid, der Vater des Komponisten Erich Wolfgang Korngold. Auch er war gelernter Jurist, aber ein wesentlich schlechterer Stilist. Den Antimoder- nismus, der sich vor allem gegen Richard Strauss wandte, hat recht eigentlich er begründet. Seiner Spur folgte als Kritiker Joseph Marx (1882—1965), der — ebenso wie Hanslick und Korngold — auch noch heutzutage gern als Autorität zitiert wird.
Aus anderem Holz war Max Graf (1873—1958), der in einem Wiener Montagsblatt seine Tätigkeit als Kritiker mit drei Artikeln begann, die gegen Hanslick und Max Kalbeck polemisierten und deren letzter eine Glorifizierung von Saint-Beuve war. Max Graf trat für Bruckner, Mahler, Hugo Wolf, Schönberg, Alban Berg, Debussy, Ravel und Strawinsky ein. Er warb aber auch für Bartök und Hindemith, Gottfried von Einem und Theodor Berger.
II
Der heutige Musikpotentat sieht anders aus. Er ist es weder auf Grund seiner sozialen Stellung noch dank seiner überragenden fachlichen Qualifikation geworden, sondern infolge seiner Geschäftstüchtigkeit und seines Ehrgeizes. Schreibt er etwa für ein Massenblatt und hat er überdies die Möglichkeit, sein Urteil noch durch den Rundfunk und das Fernsehen zu verbreiten, so vermag er die öffentliche Meinung in einem Maß zu manipulieren, das kunstfeindlich und undemokratisch ist.
Die gegenwärtig in Wien tätigen Musikkritiker — es gibt deren rund 40, die für Tageszeitungen, Wochen- und Monatsschriften arbeiten — sind keineswegs als reaktionär zu bezeichnen. Sie sind auch nicht ä tout prix für das Allerneueste. Die Schwierigkeiten liegen auf einem anderen Gebiet. Zwar haben nur zwölf eine abgeschlossene musikalische Ausbildung aufzuweisen, doch kann man auch den übrigen, die früher oder später auf Umwegen zur Musik und zur Zeitung gekommen sind, ein beträchtliches Fachwissen und damit weitreichende Kompetenz nicht absprechen. Von der „Richtung“ der Zeitung, für welche die verschiedenen Kritiker schreiben, sind sie fast gänzlich unbeeinflußt, also theoretisch und praktisch „frei“. Dagegen kommen manche mit dem oft ins Maßlose gesteigerten Interpretenkult dem Geschmack des Publikums — ob zwangsläufig oder freiwillig ist schwer zu entscheiden — weitgehend entgegen. Das Interesse für das Schöpferische, das Neue und Kreative, ist, damit verglichen, hierorts viel geringer.
III
Dam Rang der Musikstadt Wien entsprechend nimmt die Musik auf den sogenannten Kulturseiten der Tageszeitungen den weitaus größten Raum ein, so daß sich besonders die Literaten und die Bildenden Künstler mit Recht wegen Vernachlässigung beklagen. Aber der meiste Platz wipd nicht etwa von echten Musikkritiken, sogenannten Musikreferaten, eingenommen, sondern vori Nachrichten aus dem Musikleben und allerlei Kulissentratsch, vornehmlich aus dem Bereich der Oper. Hier hat sich ein kaum mehr zu durchbrechender Teufelskreis gebildet: das lesende Publikum wurde durch solcherlei Neuigkeiten, Indiskretionen und Polemiken gewissermaßen „süchtig“ gemacht, und nun kann sich vor allem die Boulevardpresse mit gutem — oder besser: mit sehr dubiosem — Recht darauf berufen, daß die Leser diese Reportagen und Kolportagen verlangen.
Dem Ansehen der Musikkritik haben diese Tratschereien jedenfalls sehr geschadet. Es wiederzugewinnen, wird nicht leicht sein. Vielleicht sollte sich die Vereinigung der Musikreferenten darum kümmern. Eine solche existiert nämlich seit 1946, und 18 maßgebliche Wiener Musikkritiker gehören ihr an. Sie setzt die Tradition des bereits zu Beginn der ü oißiger Jahre begründeten Vereins der Theater- und Musikkritiker fort, der 1938 aufgelöst wurde. Die Aufgabe dieser Vereinigung besteht vor allem in der Wahrnehmung der Standesinteressen. Doch sollte man auch die Auswüchse und Mißbräuche des kritischen Amtes kritisch beobachten. Die unfaire und erbarmungslose Hetze gegen den vor kurzem verstorbenen Staatsopemdirektor ist ein Exempel dafür, was nicht möglich und nicht gestattet sein sollte. (Siehe hierzu den auf unserer Kunstreferatseite veröffentlichten Aufruf „Trauer und Protest“.)
IV
Während eines dreitägigen Kriti- kersymposiions in Graz, an dem namhafte Musikologen und Musikkritiker aus sämtlichen Nachbarländern Österreichs tedlnähmen, waren sich alle darüber einig, daß eine verantwortungsvolle und standesbewußte Musikkritik die Vermengung des sachlich-fachlichen Musikreferates mit Nachrichten aus dem Privatleben der Künstler sowie jederlei Kolportage entschieden ablehnen müsse.
Ebenso war man sich darüber einig, daß für den Kritiker nur zu gelten hat, was sich zwischen halb acht und zehn Uhr abends auf dem Konzertpodium oder auf der Opernbühne abspielt (bei Wagner ist dieser Zeitraum um zwei Stunden zu verlängern ...). Es hat den Kritiker also nicht zu interessieren, ob für ein bestimmtes Konzert nur zwei Proben (oder gar nur eine) zur Verfügung standen, ob die junge Sängerin Liebeskummer hat und daher nicht in Form ist oder ob sich ein Komponist in einer momentanen Krise befindet. Damit soll — zumal in einer Stadt, wo dem Menschlichen ein so hoher Rang, ja eine gewisse Priorität zuerkannt wird —. nicht einer herzlosen Beckmesserei das Wort geredet werden. Aber man bedenke: der Kritiker kann nicht alles wissen, und da er nur ab und zu von den näheren Umständen und Schwierigkeiten einer Aufführung etwas erfährt, sind jene Darbietungen, über deren schwieriges Zustandekommen er nicht informiert ist, im Nachteil. Es ist also nicht nur bequemer, sondern auch gerechter und besser, von dem Drum und Dran nichts zu wissen, und sich ausschließlich an das zu halten, was am Abend geboten wird. — Daß er sich persönlicher Diffamierung enthält, sollte ebenso selbstverständlich sein wie daß die private Sphäre tabu ist.
Die wichtigste Frage aber, die an den Kritiker gestellt wird und die ihn immer wieder in Gedanken beschäftigt, lautet: Für wen schreibt er? Für das Publikum? Für die Künstler? Für die Veranstalter? Er weiß, daß er von allen zur Kenntnis genommen und seinerseits kritisiert wird. Trotzdem sollte er sich nicht abhalten lassen und es niemals aufgeben, im Interesse der Kunst zu schreiben. Das mag oft undankbar sein und ihm Feinde machen. Aber nur wenn er sich an diese Maxime hält, kann er die Macht des öffentlich ausgesprochenen Wortes und seiner Wirkung auch voll verantworten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!