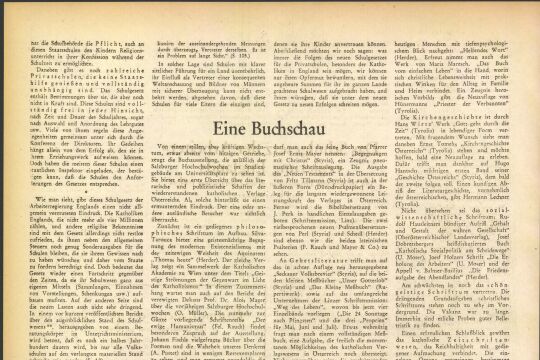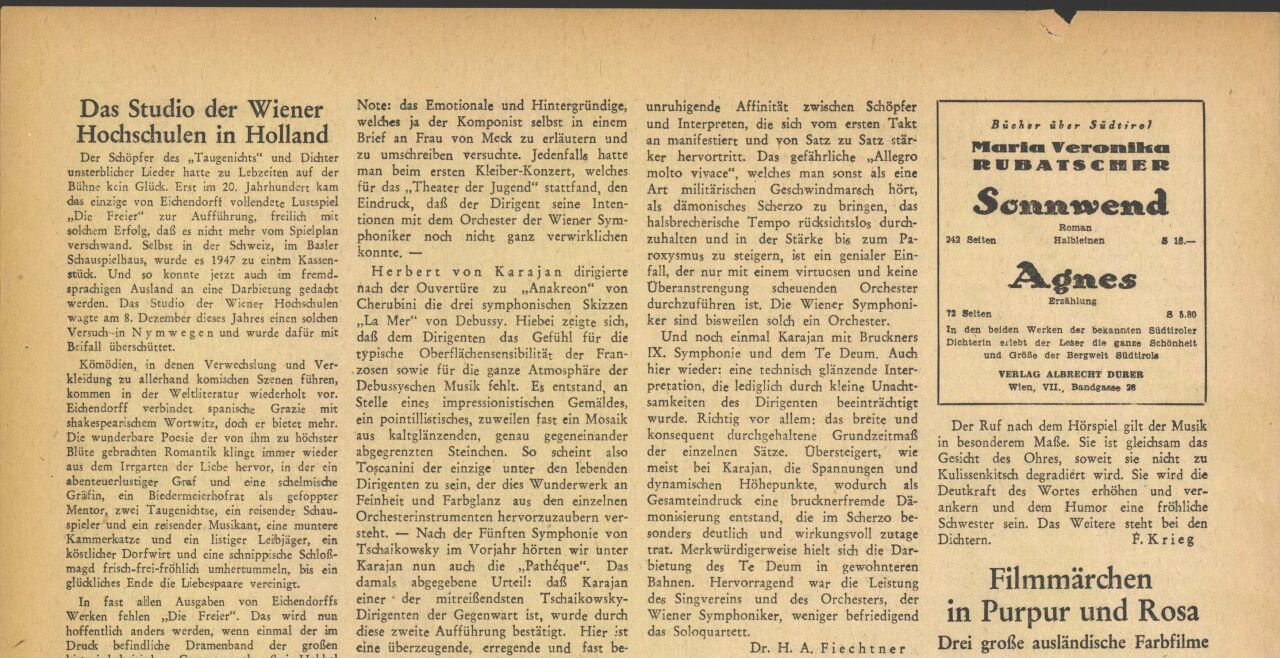
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sender und Hörer
Unter diesem Namen läuft eine literarische Sendefolge mit den Reihen „Klassiker im Rundfunk”, „Lustspiel des Monats” und anderen sowie einzelnen Stücken heimischer und fremder Produktion; daneben bringt die „Kleine Radiobühne”, eine Art Studio, kürzere, zumeist einaktige Spiele. Im weiteren Sinne gehört natürlich auch die Sendung von Opern und Operetten der Radiobühne an. Das eigentliche Hörspiel, an das man zunächst denkt, ist so gut wie gar nicht vorhanden. In der Erkenntnis, daß es, für die Aufnahme durch das Ohr allein geschrieben, nach allmählicher Überwindung der gewohnten Schaubühnentechnik neue Züge, vielleicht sogar eine neue Kunstform entwickeln könnte, ist sein Fehlen sehr zu bedauern, zumal es im Grunde doch eine halbe Sache und keineswegs letzter Sinn der Radiobühne bleibt, durch „Funkbearbeitung”, so geschickt sie zuweilen sein mag, Schau spiele in H ö r spiele zu verwandeln. Sie behält immer ein wenig vom Bilder-Hören- oder Musik-Sehenwollen. Natürlich wird nicht leicht ein Dichter bereit sein, für eine einzige Aufführung und den folgenden unbezahlten Archivstaub sich besonders anzustrengen. Dagegen vermöchte eine Zusammenarbeit aller großen Sender wirklich guten Hörspielen wohl eine lohnende Aufführungsbasis zu schaffen. Zugegeben, es wäre vorerst eine Ära des Experimentierens zu überwinden; immer noch besser als das Dauerexperiment der „Bearbeitung für den Rundfunk”, wobei gewiß nichts gegen die Bearbeiter und ihre meist recht undankbare Aufgabe, aus Nieten Erfolge zu machen, gesagt sein soll.
Die Gewohnheit läßt uns den Mangel des eigentlichen Hörspiels freilich weniger empfinden als den nach Theaterstücken überhaupt, die mit dem Verlust des „Bildes” nicht ihr Bestes einbüßen. Je wirksamer ein Stück auf der Bühne nämlich ist, desto schwieriger gestaltet sich seine Sendung. So vieles kultivierte Stimmen durch konzentrierten Ausdruck zu leisten vermögen — und daran fehlt es nicht: in der bunten Qualitätsskala gibt es erstaunliche Höhen —, die Bewegung, motorischer Affekt der Schaubühne, entzieht sich bis auf rudimentäre Andeutungen von Geräuschen dem Hörspiel zur Gänze. Die Folge ist, daß man Stücke wählen muß, die der Phantasie des Hörers entgegenkommen und ihm durch Beschränkung der handelnden Personen das Auseinanderhalten der Stimmen ermöglichen. Überalterte Stimmen stören den Hörer erheblich mehr als den Zuschauer. Das Ohr hört ohne die Unterstützung des Auges feiner. Es ist an dem Charakter einer Stimme interessiert, nicht an ihrem Besitzer, selbst wenn dieser ein Star ist, in Klang und Ausdruck aber der dargestellten Person nicht entspricht. Maria Stuart muß auch stimmlich mit dreißig Jahren aufs Schafott, mag sie als Mutter Kabanowa auch hundert alt werden.
Ein flüchtiger Blick auf den Spielplan des letzten Halbjahres überzeugt von seiner universellen Erstellung im Rahmen des Gegebenen. Mit Czokors „3. November 1918”, Anouilhs „Mädchen Therese” und Sutton Vanes „Überfahrt” seien nur drei bedeutende Sendungen der zeitgenössischen Bühne genannt. Von den klassischen Stücken erfuhr besonders Molares „Tartuffe” eine hervorragende Wiedergabe. Dennoch sehen wir die Aufgabe der Radiobühne nicht im Nachspielen aktuellen oder vergessenen Theaters erfüllt, sondern erwarten das ihr allein Gemäße, das Hörspiel, das die ewigen Menschheitsprobleme in der Sprache unserer Zeit und ihrer Besonderheit zum Gegenstand hat und mit dem Glauben, der Verzweiflung und dem Humor ihrer Kinder behandelt. Das Wort, auf sich selbst gestellt, ist ein Ruf, und es soll ein Ruf in die Welt sein, nicht eine Nachrede oder eine Konversation. Wie weitgehend die künstlerische Leitung der Radiobühne in dieser Hinsicht anregend und fördernd wirken kann, ist natürlich schwer festzustellen; daß ihre vornehmste Aufgabe darin besteht, unterliegt keinem Zweifel. Dann wird auch die den Sprechstücken beigegebene, zumeist recht entbehrliche Musik einer künstlerischen Forderung und nicht mehr einer Kulissenmalerei entsprechen.
Wie die Sendungen von Opern und Operetten beweisen, lieget; die Dinge bei der musikalischen Hörbühne nicht weniger problematisch, obgleich die Musik als „Kunst des Hörens” des Visuellen entraten kann. Doch das gesungene Wort ist schwerer verständlich (viel zu oft gänzlich unverständlich) und erschwert die Erfassung der Handlung, macht vorausgehende Inhaltsangaben notwendig, die wieder die Spannung des Hörers beeinträchtigen. Auch die Darstellungskraft der Musik erfordert einen Wegweiser: Wort oder Bild oder beides. Das musikalische Theater ist eben gleicherweise eine Schaubühne und muß oft recht mühevoll, gelegentlich sogar krampfhaft für die Sendung zurechtgebogen werden. Die einzige Erleichterung besteht in der größeren Bekanntheit der gängigen Opern gegen die weit zahlreicheren Werke der Sprechbühne. Das aber macht den Hörer gegen Qualitätsmangel empfindlicher und erhöht seine Forderungen. Bei erstrangiger Leistung allerdings kommt die musikalische Hörbühne dem idealen Hörspiel am nächsten, wie die großartige Sendung der „Walküre” trotz ihrer aktweisen Teilung bewies. Aber das sind Ausnahmen, von denen kein Spielplan leben kann. Im Durchschnittsfall knarrt der technische Apparat der Höroper meist bedenklich, zumal durch die unzulänglichen Chöre. Das Unechte, Unkünstlerische der Komparserie wird, dem Auge entzogen, dem Ohre um so deutlicher.
Der Ruf nach dem Hörspiel gilt der Musik in besonderem Maße. Sie ist gleichsam das Gesicht des Ohres, soweit sie nicht zu Kulissenkitsch degradiert wird. Sie wird die Deutkraft des Wortes erhöhen und verankern und dem Humor eine fröhliche Schwester sein. Das Weitere steht bei den Dichtern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!