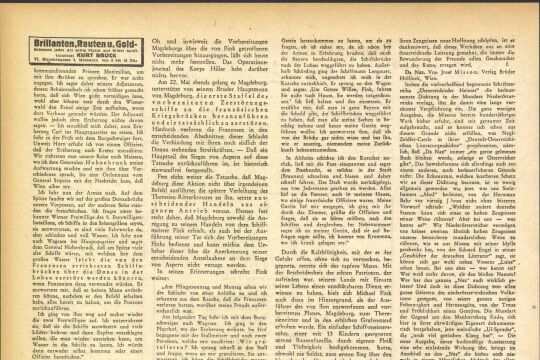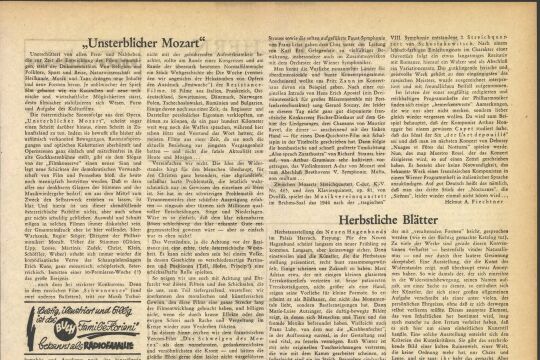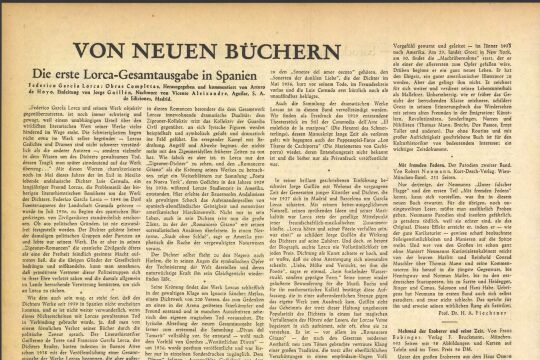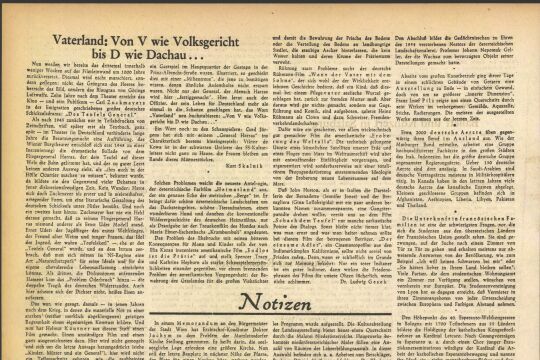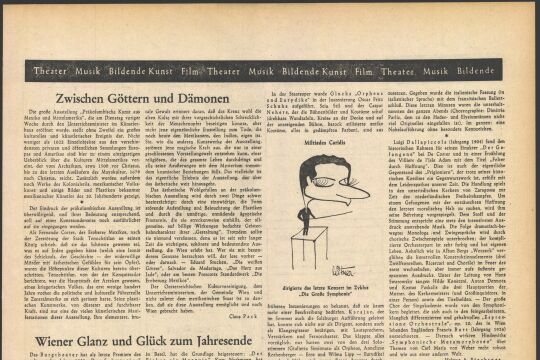Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Madchen und Giganten
Also hat doch Walt Disneys „Wunder der Prärie“ das Rennen gemacht, und das bei stärkerer „Nennung“, als die Weihnachtsprogramme der letzten Jahre brachten.
Oesterreich lief ehrenvoll auf Platz ein. Wenn hier Kurt Steinwendners Kurzfilmchen „Gigant und M ä d 4 h e n“ an erster Stelle genannt wird, dann nicht, weil er der „beste“ war, sondern weil an dieser Stelle immer wieder dem Experiment vor der Routine, dem Dokumentarfilm vor dem Küßmichkäthchen-Spielfilm die Palme gereicht worden ist. Steinwendner ist der Eigenbrötler im heimischen Film, dem bisher mehr mißlungen ist als seinem brüderlichen Gefährten Quendler (trotzdem hat Oesterreich in ihnen beiden seine Cocteaus und Clairs). In diesen Spalten wurde schon weidlich, aber fair mit ihm gerauft und gerechtet. Auch der „Gigant“ ist kein Gigant. Aber selbt vor diesem ungenügenden Versuch, das gigantische Thema: Mensch — Materie, Mensch — Technik, Mensch — morgen, einmal optisch-musikalisch-choreographisch zu fassen, und seinen Schöpfern zieht jeder Anständige den Hut.
Noch etwas respektvoller grüßen wir Hartls farbigen „M o z a r t“-Film, seinen musikalischen „Takt“ und Geschmack, die schönen Stimmen, die profilierten Hauptdarsteller Oskar Werner und Johanna Matz und die „Bomben“-Episode Erich Kunz' als Schi-kaneder bzw. Papageno. Ein Film, der nicht nur vor dem internationalen, sondern auch dem (kritischeren!) heimischen Publikum besteht. Die „schreckliche Vereinfachung“ der kompliziert-naiven Persönlichkeit Mozarts auf einen permanenten Seitenspringer (sozusagen: Gigant und Mädchen . .. !) geht zu Lasten des Drehbuches (Hartl-Tassie). Sie ist die traditionelle Konzession an den sagenhaften Publikumsgeschmack, verweist aber damit den Film in den 1. Rang, obwohl er eigentlich ins Parkett gehörte.
Rätsel über Rätsel gibt das neue Paula-Wessely-Lustspiel „Die Wirtin zur goldenen Krone“ auf. Daß das Buch schwächer als die Darstellerin ist, ist handgreiflich. Auch hier war noch aus dem Doppelgängertum von Landesfürstin und Wirtin einiges zu holen: Witziges aus stärkerem Geflecht des Buches, Pointierteres aus eleganterem Dialogschliff, Effektvolleres aus mehr Begegnungen der Doppelgängerinnen, Anzüglicheres aus politischer Aktualität. Hiei abei versagten Regie (Theo Lingen) und Dialogregie auf allen Linien. Verzweifelt stemmt sich die .eminente Charakterisierungskunst Paula Wesselys dagegen. Umsonst. Es wird nur sauberer, netter Durchschnitt. Und das ist uns halt viel zu wenig für einen Wessely-Film. Diese „Wirtin“ ist, was „König Pausole“ im Schaffen Jannings' war. Auch ihm folgte noch Großes und Schönes. Hoffen wir. Wünschen wir.
Ein österreichisches Märchen ist „Sissi“. Ernst Marischka ist mit ihm eine vollgültige Reprise des großen Bühneninszenierungserfolges seines Bruders gelungen. Es geriet damit zudem der liebenswürdigste Film der Festtage und in seiner hintergründigen Heiterkeit (hintergründig, weil hinter diesen Mädcheniahren einer Kaiserin eine Folgezeit von grenzenloser Einsamkeit, hinter dem „Alleluja“ der Traü-ungsszene ein bitter-menschliches Leben und Sterben aufsteht) der österreichischeste. Romy Schneider, gar nicht im Schatten der großen Bühnenbesetzung, ist eine bezaubernde Sissi, Karlheinz Böhm ein galanter, scharmanter junger Franz Joseph. Das musikalische Arrangement fällt gegenüber den „Kreisleriana“ von ehedem ab.
Von Sacha Guitrys „Napoleon“ erwartete man, daß er aus allen Rohren oft erprobter Causerie schieße. Gebt Feuer — ach, wie schießt ihr schlecht. Ich weiß schon, woran es Hegt. Ein Heldenporträt, eine heroische Legende ist nie lustig. Pathos kommt eben von „leiden“. Und dieser Film ist pathetisch und zudem nationalistisch, ja stellenweise richtig chauvinistisch. Sacha Guitry ist regelrecht verliebt in seinen Helden und seine Eroica und eskamotiert fast brutal alle Schatten, Häßlichkeiten — und Niederlagen weg. Besonders schlecht kommen wir Oesterreicher weg; man erwürgt unseren Asperner Löwen und tröstet uns mit einem pfauchenden Marie-Louise-Kätzchen — wohl die unmöglichste Szene des Films. Großartig Sacha Guitrys Talleyrand und die beiden Napoleons Daniel Gelin und Raymond Pellegrin, großartig die Schlacht bei Waterloo. (Der Film „Napoleon“ ist Sacha Guitrys Waterloo.').
Amerika präsentierte mit „Die 5 6 0 0 Finger des Dr. T.“ ein surrealistisches Märchen von berückender Leuchtkraft. Filmisch in allen Poren, witzig und gescheit erzählt es den Traum des Buben, der das Klavierspielen nicht lernen wollte und seinen machtberauschten Lehrer und Hexenmeister in die Luft sprengt, mit Atomkraft, versteht sich. Ballett? Illusionskunst? Expressionismus? Ach, ein wunderbarer Film. Wir werden nimmer seinesgleichen sehen.
Halt, da ist er schon Beinahe. „Der gläserne Pantoffe 1“. ein modernes, rationalistisches Aschenbrödel. Der erste Teil zieht sich, im zweiten Teil aber ist tänzerischer Schwung und Duft des ewigen Märchens.
Amerika ist auch sonst im Programm immer da. An „Eine Braut für sieben Brüder“ kann man die Vorzüge der modernen Musicals vor dem blechernen Zeitalter der Wiener Operette ablesen. Im Abenteuergenre ist dem „S e e f u c h s“ und „G r ü-n e s Feuer“ der Vorzug vor „Kampf am roten Fluß“ zu geben. Eine elegante Kriminalkomödie Hitchcocks „lieber den Dächern von Nizza“ und ein Schicksal aus der Boxerlaufbahn, „Ein Mann aus Stahl“, bilden den Schluß.
Richtig winkerlstehen muß Deutschland diesmal mit dem anspruchslosen Lustspielchen „Drei Tage M i 11 e I a r r e s t“. Es wäre ungerecht, es als nationale Repräsentanz anzusehen. Trotzdem steht deutlich die permanente Filmkrise unseres nördlichen Nachbarn hinter diesem harmlosen Mädchen des Giganten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!