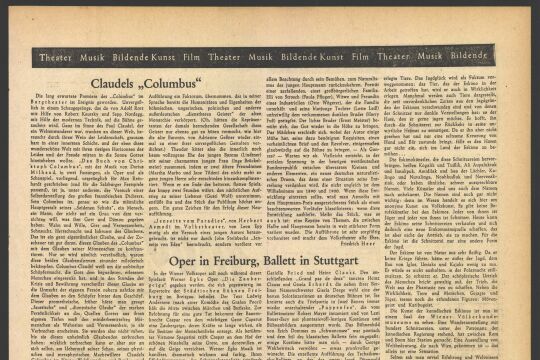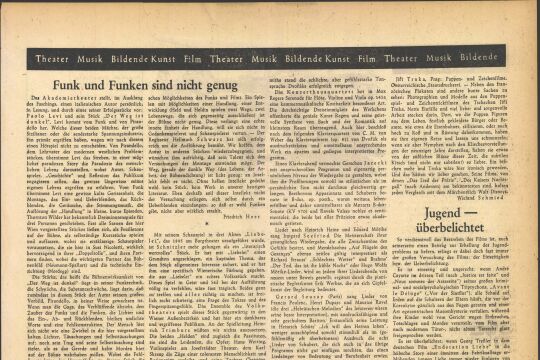Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Botschaft der Treue
Shakespeares „Cymbeline” ist eines seiner ganz selten gespielten Werke; in Wien war es zuletzt vor gerade 110 Jahren zu sehen, und auch vorher nur in entstellenden Übersetzungen und Bearbeitungen. Seiner späten Schaffenszeit entstammend, dem „Wintermärchen” und dem „Sturm” benachbart, stellt es eine tollkühne Mischung geschichtlicher Elemente dar. Das erste Jahrhundert n. Chr. und Cäsar sind hier verschwistert mit der Renaissance Boccaccios; römische Lehensherrschaft über Britannien mischt sich mit der englischen Gegenwart von 1610. Unter souveräner Mißachtung aller klassischen Forderungen und Grundsätze des Theaters erzählt Shakespeare — mehr episch als dramatisch — die Geschichte von der schönen Imogen und ihrem Gatten Leonatus, der ihre Treue auf die Probe stellen will. Ein Nichtswürdiger verschafft ihm das Zeichen ihrer angeblichen Untreue, worauf der vor Eifersucht Rasende befiehlt, sie zu ermorden. Da sich aber der treue Diener diesem ungeheuerlichen Ansinnen heimlich widersetzt, kann der reuige Gatte am Ende die Totgeglaubte wieder in die Arme schließen.
Uraltes Sagengut wurde in dieser märchenhaften Romanze vom zufälligen und schuldhaften Sichverlieren der Menschen und ihrem glücklichen Wiederfinden lebendig. Um dieses Hauptgeschehen ranken sich zahlreiche, fast kolportage- hafte und für die Schaulust von damals charakteristische „Motive”. Das ganze Stück ist ein Grenzfall, wo Schwächen neben unvergleichlichen Schönheiten, Unbeseeltes, Stimmungsloses neben Zartheit und Kraft, wie sie nur Shakespeare eigen waren, stehen, und dürfte gewiß nicht zur Gänze von ihm stammen. Doch ist ihm hier, in Imogen, wohl zuerst die Vereinigung seines tragischen mit seinem Lustspielton zu einem ganz neuen Klang gelungen. Die zweite Gestalt, die Shakespeares volle Lebensfarbe empfängt, ist Prinz Cloten, der Sohn der bösen Königin aus erster Ehe. Halb verrückt vor Hochmut und nicht gerade geistesstark, kindisch und tierisch, komisch launenhaft und zugleich sehr gefährlich, konnte dieses Märchenungeheuer nur Shakespeares Phantasie entspringen.
Um es vorwegzunehmen: Die Uraufführung der Neuübertragung von „König Cymbelin” in der Inszenierung und Bühnenfassung von Dietrich Haugk, nach der sehr beachtenswerten Übertragung von Theodor von Zeynek im Theater in der Josef Stadt, ist nur halb gelungen. Der Traum, die Vision des Dichters, rührte zuwenig, verzauberte nicht, dazu waren Inszenierung und Bühnenbild von Dietrich Haugk (Shakespeare-Galeriebühne) zu nüchtern, die Kostüme und Auf-
machung zuwenig bunt und zeitlos. Die Schauspieler boten güte bis treffliche Leistungen. Unter ihnen Erik Frey als König Cymbelin etwas zu pathetisch, Sigrid Marquardt als Königin nur erstarrt in ihrer Bosheit, Franz Meßner als Cloten rüpel- und tölpelhaft, doch zuwenig dämonisch, Johanna von Koczian als Imogen inniger als sonst, doch wünschte man ihr mehr von dem freien und heiteren Geist ihrer holden Schwestern von Shakespeares Gnaden. Michael Heltau war ein überaus sympathischer, leidenschaftlich bewegter Leonatus Posthumus, und Kurt Heintel beeindruckte als böser Römer Jachimo. Doch nur ein einziges Mal in einer kurzen Episodenrolle kam Shakespeares grimmiger Witz, sein Witz auf Leben und Tod voll zur Geltung: in der Szene des Kerkermeisters, gespielt von Theo Lingen. Der lebhafte Beifall des Publikums galt den Schauspielern; aber auch als Dank, einem so gut wie unbekannten Shakespeare auf der Bühne zu begegnen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!