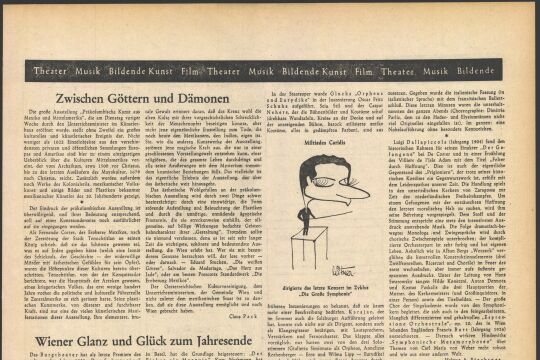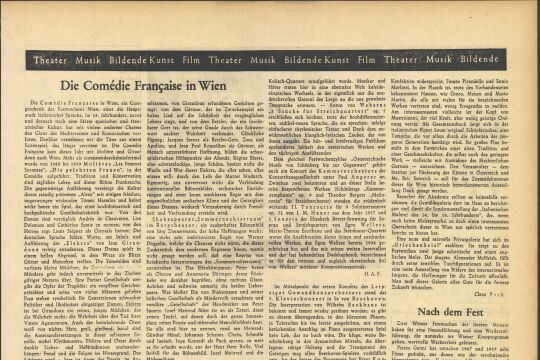Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Raimunds naive Märchenwelt
Zweimal Raimund in einer Woche, das fordert förmlich zu einem Vergleich heraus, in welchem Stil das Raimundsche Zaubertheater in seiner Mischung aus kindlicher Einfalt und schlichter Weisheit, aus witziger Allegorie und humorvoller Realität uns Heutigen vergegenwärtigt werden kann. Zum 70jährigen Jubiläum des Wiener Raimundtheaters gastierte das Salzburger Landestheater mit dem Zauberspiel „Der Diamant des Geisterkönigs“ in der Inszenierung des aus Wien kommenden Intendanten Doktor Helmuth Matiasek. Auch dieses Stück stellt, wie so oft bei Raimund, eine ins Bildliche, Märchenhafte übersetzte sittliche Läuterung dar. Mit besonders viel Zaubereien, feenhafter Ausstattung und Erscheinungen aus der Erde und aus der Luft versehen, widerstrebt ihm nichts mehr als intellektuelle Tüfteleien und ironische Parodie. In der Salzburger Aufführung allerdings beherrschten diese sowohl das Reich des nicht gerade verstandesstarken, gutmütigen, schlampig regierenden und amtshandelnden Geisterkönigs wie die Gegenseite, die Bewohner des „Landes der Wahrheit“. Zwischendurch sorgten reichlich eingelegte Ballett-
szenen für Bewegung, wenn das Tempo der Aufführung zu schleppen drohte. Dabei gemahnten die vier Balletteusen im Trikot, die als „Pferdchen“ die Reisekutsche ins Geisterreich ziehen, weit eher an die sonderbare Erotik eines Jean Genêt (Generalsszene im „Balkon“) als an, die Naivjtät Raimupds. Dies bloß zur' Illustkatlöri eines merkwürdig modernen und doch wohl nicht ganz vorbildlichen Raimund-Stils.
Gespielt wurde in den eine üppige kunstgewerbliche Phantasie offenbarenden Dekorationen und Kostümen von Monika von Zollinger. Herbert Fux als König Longimanus beherrschte die Szene, wenn er sich auch etwas zu leger gibt. Kurt Weinzierl in der Paraderolle Raimunds als Florian Waschblau und Felicitas Ruhm als Köchin Marindel wirken nett und sympathisch, doch fehlt beiden der nötige Schuß ausstrahlender Komödiantik und auch eine etwas tragfähigere Singstimme. Dem Liebespaar, Peter Kollek als Eduard und Cornelia Froboess als Amine mangelt es doch noch an Bühnenerfahrung. Von den zahlreich Mitwirkenden seien noch genannt: Cornelia Oberkogler als Hoffnung, Jürg Holl als rabiater Beherrscher der Insel und Hans Gral als genienhafter Springinkerl. Die von Robert Leukauf bearbeitete Originalmusik von Josef Drechsler blieb angenehm unauffällig. Es gab viel Beifall für eine bemühte Aufführung.
Schöpften die Salzburger aus einem eher begrenzten Schauspielerreservoir, so wirkte in der Burgtheaterneuinszenierung des Originalzaubermärchens „Der Verschwender“ im Theater an der Wien unter der Regie Kurt Meiseis alles mit, was gut und teuer ist. In Raimunds volkstümlichstem Werk feiert das Theater als Zauber- und Feen werk sich selber. Es hat nichts von der Dämonie des „Rappelkopf“, aber in keinem seiner Stücke fügen sich Feenwelt und Irdisches so fugenlos ineinander wie hier. Nur eine Gefahr droht: daß der übermäßige Einsatz technischer Finessen die romantisch- biedermeierliche Atmosphäre stört, daß am Ende das Schaugepränge das von einer edlen Naivität lebende Gemüthafte verdeckt. Davon kann man auch die letzte Inszenierung nicht lossprechen. Es gab eine Reihe hinreißender Soloszenen, aber keine Hand, die sie zu einem Ganzen gerafft hätte.
Ein Kabinettstückchen erzkomödiantischer Schauspielkunst bot Josef Meinrad als kreuzbraver, munterer, aber auch besinnlicher Valentin. Das „Hobellied“ geriet ihm unnachahmlich. Sehr gut Inge Konradi als resches Kammermädchen Rosl, wobei ihr die lustigen Szenen bes ser gerieten als die der redlichen Tischlersfrau „20 Jahre später“. (Die Familienszene in der Tischlerwerkstatt spielte doch etwas zu freigebig die Kindersentimentalität aus.) Walter Heyer gab den unbedenklich verschwenderischen Herrn von Flottwell; als an der Welt gereifter Heimkehrer wirkte er etwas blaß,, Wolfgang Gasser war als Azur und ernst-eindringlicher Bettlergeist sein Gegenspieler. In der Märchenszene mit erzieherischem Endzweck verlieh Christiane Hörbiger der guten Fee Cheristane den Ton der Romantik. Während Heinz Moog als Kammerdiener Wolf alle üblichen Register des verschlagenen Erzbösewichtes zog, brillierten Boy Gobert als Chevalier Dumont voller Bewunderung für „der Natur“, auch der weiblichen, und Adrianne Geßner als humorvolles altes Holzweiberl. Fred Hennings als moralisierender Präsident von Klugheim und Loni Friedl als seine Tochter blieben eher konventionell. Witzig Hans Obonya als ein richtiger Filou von Baumeister. Die hübschen Kostüme stammten von Erni Kniepert, die viel zu pompösen Bühnenbilder von Kurt Hallegger, wozu allerdings dann auch die durch Paul Angerer stark „aufgeopferte“ Musik von Conradin Kreutzer wohl paßte. Es war eine Aufführung mit viel Sehens- und Hörenswertem, aber im ganzen ohne eigentlichen Glanz und selige Verzauberung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!