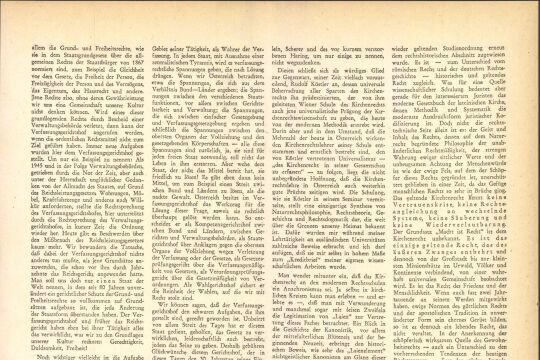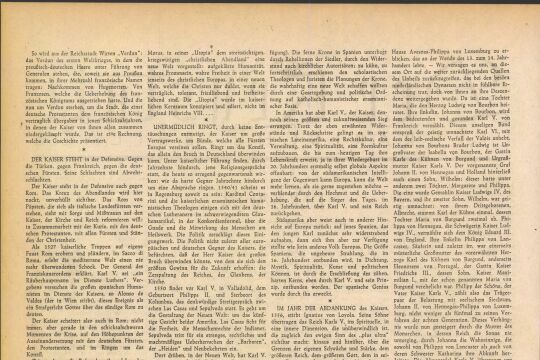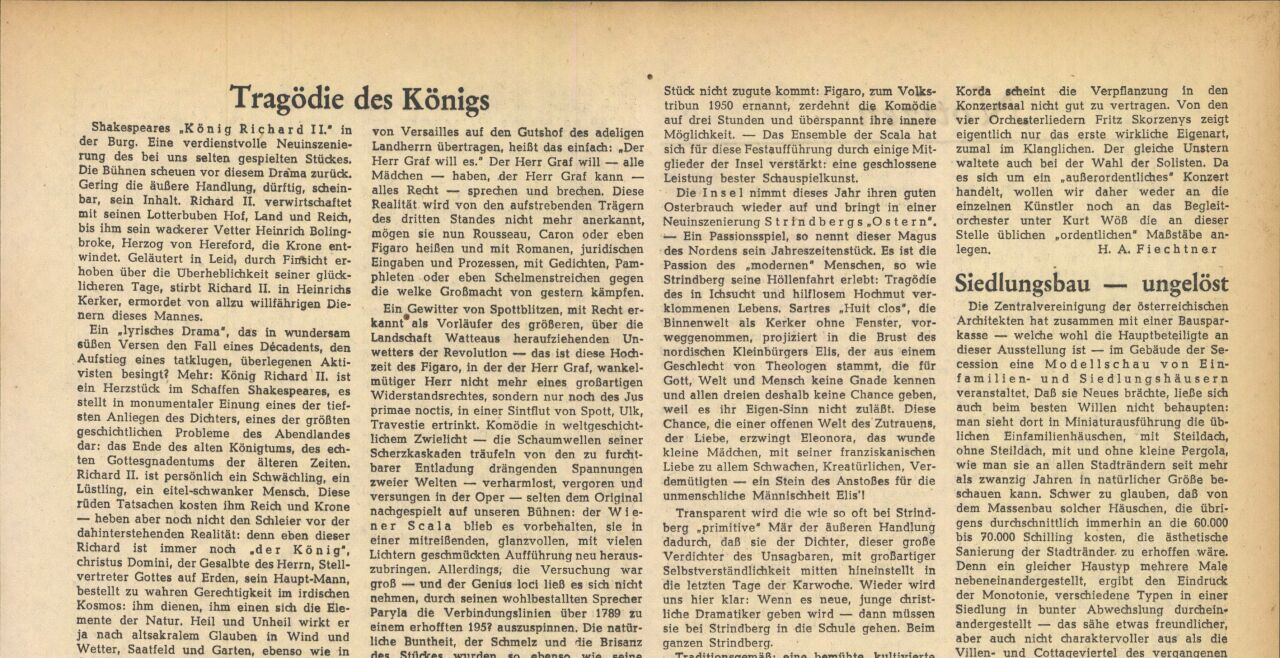
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tragödie des Königs
Shakespeares „König Richard IL in der Burg. Eine verdienstvolle Neuinszenierung des bei uns selten gespielten Stückes. Die Bühnen scheuen vor diesem Drama zurück. Gering die äußere Handlung, dürftig, scheinbar, sein Inhalt. Richard II. verwirtschaftet mit seinen Lotterbuben Hof, Land und Reich, bis ihm sein wackerer Vetter Heinrich Boling-broke, Herzog von Hereford, die Krone entwindet. Geläutert in Leid, durch Firfsicht erhoben über die Überheblichkeit seiner glücklicheren Tage, stirbt Richard II. in Heinrichs Kerker, ermordet von allzu willfährigen Dienern dieses Mannes.
Ein „lyrisches Drama“, das in wundersam süßen Versen den Fall eines Decadents, den Aufstieg eines tatklugen, überlegenen Aktivisten besingt? Mehr: König Richard II. ist ein Herzstück im Schaffen Shakespeares, es stellt in monumentaler Einung eines der tiefsten Anliegen des Dichters, eines der größten geschichtlichen Probleme des Abendlandes dar: das Ende des alten Königtums, des echten Gottesgnadentums der älteren Zeiten. Richard II. ist persönlich ein Schwächling, ein Lüstling, ein eitel-schwanker Mensch. Diese rüden Tatsachen kosten ihm Reich und Krone — heben aber noch nicht den Schleier vor der dahinterstehenden Realität: denn eben dieser Richard ist immer noch „der König“, Christus Domini, der Gesalbte des Herrn, Stellvertreter Gottes auf Erden, sein Haupt-Mann, bestellt zu wahren Gerechtigkeit im irdischen Kosmos: ihm dienen, ihm einen sich die Elemente der Natur. Heil und Unheil wirkt er ja nach altsakralem Glauben in Wind und Wetter, Saatfeld und Garten, ebenso wie in der Civitas humana, der wohlgestuften Gesellschaft der Menschen. Sein Leben ist deshalb — und mag er es noch so sehr austun ins menschlich Hinfällige — Nachfolge Christi, sein Leidensweg ist imitatio der Passion dei Herrn (mit Recht trägt also Skoda die Christusmaske im Martyrium der Abdankung und des Unterganges). Sein Tod ist Gottesmord.
Mit dem gewaltsamen Tod der Könige, der Abbilder der göttlichen Majestät, in den Bürgerkriegen und Revolutionen des neueren Europa beginnt das große Sterben des Vater-Gottes, des Erlebnisses Gottes als Vater und königliche Majestät, die Auflösung der alt-auropäischen Gesellschaft als einer „Familie von Bluts- und Geistverwandten. Nietzsche kann sein berühmtes „Gott ist tot“ — ein historischer Vermerk, der das Sterben dieses alten Gottesbegriffes anzeigt, was selten erkannt wird — erst sagen nach dem Tode dieser Könige und ihrer Erben, der alten „Väter“ patriarchalisch gebundener feudaler und bäuerlicher Sippenkulturen. Der Tod dieser Könige — sakrales Siegel des Zer-brechens der got.tweltlichen Einheit — gibt die geballten Kräfte frei für die neue Welt der Heinriche: „Realisten“, „Realpolitiker“ reinsten Wassers, die sich mit ihren Staatsschiffen auf die Weltmeere neuer ungeheurer Spannungen und Gefahren einer entgötterten Welt begeben.
Bolingbrokes Versprechen einer Bußfahrt ins Heilige Land nach dem Tode des Königs ist nur Girlande, die Phrase der Ungläubigen — der neue König weiß, In was für einer Welt er lebt.
Eine Aufführung in bestem Burgtheaterstil.
Vorosterliches Theater
Der geheime politische Agent der Bour-bonen in Wien, Pierre Augustin Caron, Uhrmacher und Geschäftsmann, Harfenlehrer und Reeder, Herausgeber Voltaires und Verfasser vieler Denkschriften, ging ein in die Weltgeschichte nicht durch seine glücklichen Geschäfte mit dem Ancien Regime und seine unglücklichen mit der Republik, sondern schlicht und einfach — unter dem angenommenen Namen seiner Frau — als de Beaumarchais mit einem „Barbier von Sevilla“ und zumal mit „Figaros Hochzeit“. „Ein toller Tag“, so lautet der Nebentitel — 1781 ist es der tolle Tag der letzten Amüsements jener dekadenten adeligen Gesellschaft Frankreich, die entnervt und charakterlich zerbrochen war im Strudel der Vergnügungen und Koruptio-nen, im Hofdienst eines absoluten Herrschers, der seinen Glanz und seine Geltung höhen zu müssen glaubte im Spiegel von abertausend jasagenden Gesichtern. „Dieu le veult“, der alte Schlachtruf der französischen Ritter, hat sich nun gewandelt zu „Der König will es“ — von Versailles auf den Gutshof des adeligen Landherrn übertragen, heißt das einfach: „Der Herr Graf will es.“ Der Herr Graf will — alle Mädchen — haben, der Herr Graf kann — alles Recht — sprechen und brechen. Diese Realität wird von den aufstrebenden Trägern des dritten Standes nicht mehr anerkannt, mögen sie nun Rousseau, Caron oder eben Figaro heißen und mit Romanen, juridischen Eingaben und Prozessen, mit Gedichten, Pamphleten oder eben Schelmenstreichen gegen die welke Großmacht von gestern kämpfen.
EinJ3ewitter von Spottblitzen, mit Recht erkannt als Vorläufer des größeren, über die Landschaft Watteaus heraufziehenden Unwetters der Revolution — das ist diese Hochzeit des Figaro, in der der Herr Graf, wankelmütiger Herr nicht mehr eines großartigen Widerstandsrechtes, sondern nur noch des Jus primae noctis, in einer Sintflut von Spott, Ulk, Travestie ertrinkt. Komödie in weltgeschichtlichem Zwielicht — die Schaumwellen seiner Scherzkaskaden träufeln von den zu furchtbarer Entladung drängenden Spannungen zweier Welten — verharmlost, vergoren und versungen in der Oper — selten dem Original nachgespielt auf unseren Bühnen: der Wiener S c a 1 a blieb es vorbehalten, sie In einer mitreißenden, glanzvollen, mit vielen Lichtern geschmückten Aufführung neu herauszubringen. Allerdings, die Versuchung war groß — und der Genius loci ließ es sich nicht nehmen, durch seinen wohlbestallten Sprecher Paryla die Verbindungslinien über 1789 zu einem erhofften 195? auszuspannen. Die natürliche Buntheit, der Schmelz und die Brisanz des Stückes wurden so ebenso wie seine Trikolore in etwa von einer gewissen Monotonie und Einfarbigkeit überschattet. Was dem Stück nicht zugute kommt: Figaro, zum Volkstribun 1950 ernannt, zerdehnt die Komödie auf drei Stunden und überspannt ihre innere Möglichkeit. — Das Ensemble der Scala hat sich für diese Festaufführung durch einige Mitglieder der Insel verstärkt: eine geschlossene Leistung bester Schauspielkunst.
Die Insel nimmt dieses Jahr ihren guten Osterbrauch wieder auf und bringt in einer Neuinszenierung Strindbergs „Ostern“. — Ein Passionsspiel, so nennt dieser Magus des Nordens sein Jahreszeitenstück. Es ist die Passion des „modernen“ Menschen, so wie Strindberg seine Höllenfahrt erlebt: Tragödie des in Ichsucht und hilflosem Hochmut ver-klommenen Lebens. Sartres „Huit clos“, die Binnenwelt als Kerker ohne Fenster, vorweggenommen, projiziert in die Brust des nordischen Kleinbürgers Elis, der aus einem Geschlecht von Theologen stammt, die für Gott, Welt und Mensch keine Gnade kennen und allen dreien deshalb keine Chance geben, weil es ihr Eigen-Sinn nicht zuläßt. Diese Chance, die einer offenen Welt des Zutrauens, der Liebe, erzwingt Eleonora, das wunde kleine Mädchen, mit seiner franziskanischen Liebe zu allem Schwachen, Kreatürlichen, Verdemütigten — ein Stein des Anstoßes für die unmenschliche Männischheit Elis'l
Transparent wird die wie so oft bei Strindberg „primitive“ Mär der äußeren Handlung dadurch, daß sie der Dichter, dieser große Verdichter des Unsagbaren, mit großartiger Selbstverständlichkeit mitten hineinstellt in die letzten Tage der Karwoche. Wieder wird uns hier klar: Wenn es neue, junge christliche Dramatiker geben wird — dann müssen sie bei Strindberg in die Schule gehen. Beim ganzen Strindberg.
Traditionsgemäß: eine bemühte, kultivierte Aufführung der Insel.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!