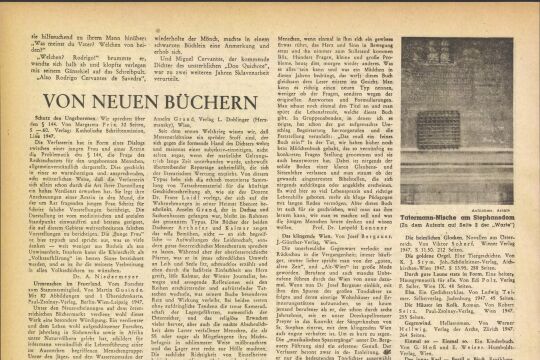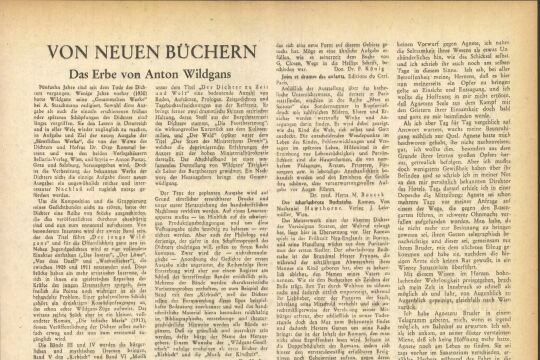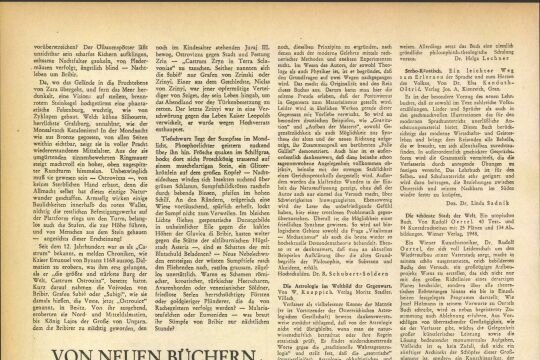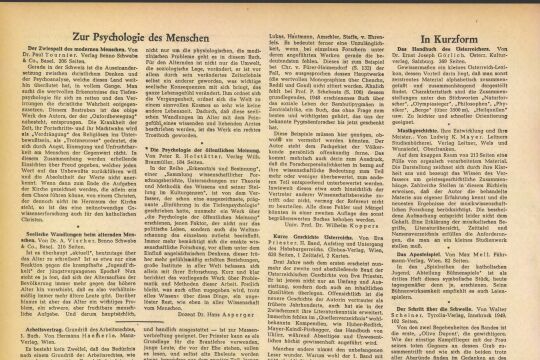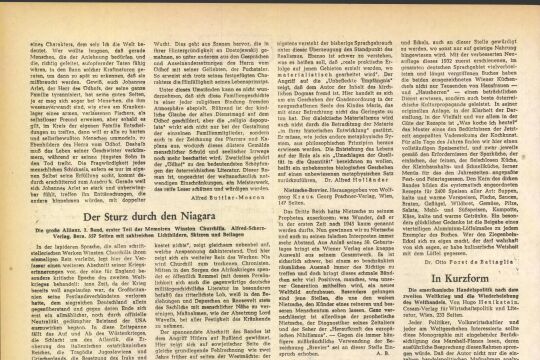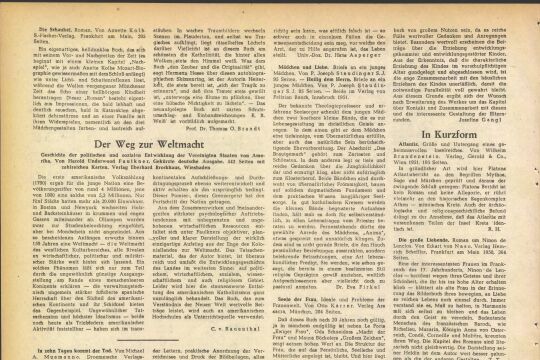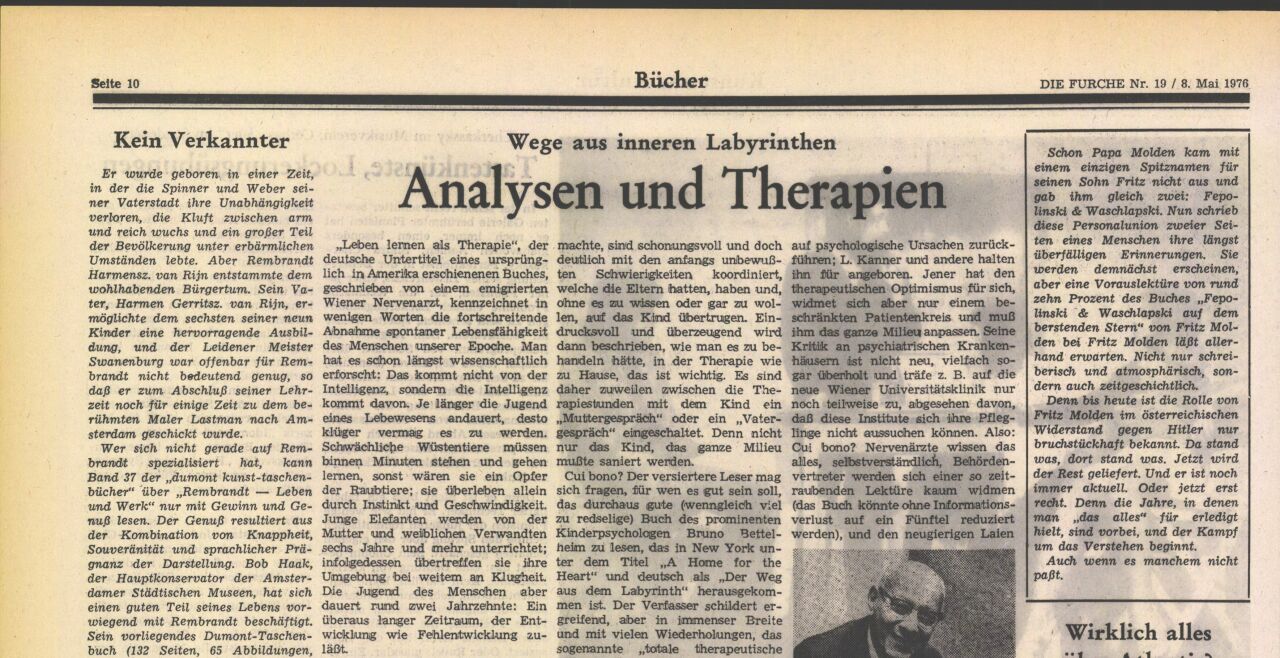
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Analysen und Therapien
„Leben lernen als Therapie“, der deutsche Untertitel eines ursprünglich in Amerika erschienenen Buches, geschrieben von einem emigrierten Wiener Nervenarzt, kennzeichnet in wenigen Worten die fortschreitende Abnahme spontaner Lebensfähigkeit des Menschen unserer Epoche. Man hat es schon längst wissenschaftlich erforscht: Das kommt nicht von der Intelligenz, sondern die Intelligenz kommt davon Je länger die Jugend eines Lebewesens andauert, desto klüger vermag es zu werden. Schwächliche Wüstentiere müssen binnen Minuten stehen und gehen lernen, sonst wären sie ein Opfer der Raubtiere; sie überleben allein durch Instinkt und Geschwindigkeit. Junge Elefanten werden von der Mutter und weiblichen Verwandten sechs Jahre und mehr unterrichtet; infolgedessen übertreffen sie ihre Umgebung bei weitem an Klugheit. Die Jugend des Menschen aber dauert rund zwei Jahrzehnte: Ein überaus langer Zeitraum, der Entwicklung wie Fehlentwicklung zuläßt
Chancengleicheit innerhalb einer Art gilbt es nicht einmal im Tierreich. Je höher sich der Glückspilz entwickeln kann, um so weiter bleibt der Unglücksrabe zurück. Im afrikanischen Busch genügen selbstverständlich die Eltern als Erzieher; im Großstadtdsohungel entsprechen sie leider oft genug nicht, es bedarf erfahrenster Pädagogen, und in schwierigeren Fällen heutzutage immer häufiger spezieller Therapeuten. Die einschlägige Fachliteratur füllt ganze Bibliotheken und macht die Orientierung nicht eben leicht Hier drei sehr verschiedenartige Beispiele.
Das erste enthält die indirekte Beschuldigung eines später berühmt gewordenen Psychologen. „C. G. Jungs Medium“ von Stefanie Zumstein-Preiswerk referiert „Die Geschichte der Helly Preiswerk“. Eine Nichte beschreibt die Lebenstragödie ihrer Tante, gemäß einem Familien-Ondit möglicherweise ausgelöst durch Experimente, die deren junger Cousin C. G. Jung mit ihr angestellt hatte. 1902 erschien seine Dissertation „Zur Psychologie und Pathologie sogenannter ocoulter Phänomene“, Auswertung seiner Beobachtungen an „Fräulein S. W.“. Gemeint war seine Verwandte Helly Preiswerk, die schon als 14jährige in Trance zni versetzen war und dabei mit Geistern in Verbindung zu treten schien. Der Medizinstudent Jung soll Initiator dieser Seancen gewesen sein, was er jedoch in seinen .^Erinnerungen“ verschweigt. Das Medium wußte nicht, daß es Objekt eines Experimentes war. Die Schlüsselfigur wurde aber nach der Publikation erkannt, und spater soll der Verlobte Hellys nach Lektüre der Dissertation die Verbindung gelöst haben. Sie ist mit 30 Jahren an Tbc gestorben, die Familie meint, „an gebrochenem Herzen“. Eine Episode, wert, von dem reifen C. G. Jung analysiert zu werden — das hat er aber nicht gewagt.
In aller Kürze als unigewöhnlich lehrreich erweist sich „Betty“ von Anneliese Ude, „Protokoll einer Kinderpsychotherapie“. Dieser glänzende Leitfaden fordert zum Vergleich heraus mit dem uimfanglichen Kompendium „Der Fall Richard“ (Kindler-Verlag, 1975) von der berühmten Kinderanalytikerin Melanie Klein, der „Das vollständige Protokoll einer Kinderanalyse“ bietet: Unterweisung allenfalls für Therapeuten der genau gleichen radikalen Richtung (die z. B. von Anna Freud abgelehnt wird). Literarisch haben beide Autorinnen gleich gearbeitet: Die Büdher basieren auf den Notizen, die nach jeder Therapiestunde gemacht wurden. Nur bat Melanie Klein die viermonatige Behandlung des zehnjährigen Richard komplett geschildert, Anneliese Ude hingegen hat aus der zweijährigen Arbeit mit der zunächst erst sechsjährigen Betty nur typisohe und erfolgsentscheidende Phasen berichtet. Das Werk ist daher nicht nur für Fachleute interessant, sondern auch für interessierte Nichtanalytiker wichtig. Die Schwierigkeiten, die das Kind
machte, sind schonungsvoll und doch deutlich mit den anfangs unbewußten Schwierigkeiten koordiniert, welche die Eltern hatten, haben und, ohne es zu wissen oder gar zu wollen, auf das Kind übertrugen. Eindrucksvoll und überzeugend wird dann beschrieben, wie man es zu behandeln hätte, in der Therapie wie zu Hause, das ist wichtig Es sind daher zsuweiden zwischen die The-rapiestiunden mit dem Kind ein „Muttergespräch“ oder ein „Vatergespräch“ eingeschaltet. Denn nicht nur das Kind, das ganze Milieu mußte saniert werden.
Cui bono? Der versiertere Leser mag sich fragen, für wen es gut sein soll, das durchaus gute (wenngleich viel zu redselige) Buch des prominenten Kinderpsychologen Bruno Bettelheim zu lesen, das in New York unter dem Titel „A Home for the Heart“ und deutsch als „Der Weg aus dem Labyrinth“ herausgekommen ist. Der Verfasser schildert ergreifend, aber in immenser Breite und mit vielen Wiederholungen, das sogenannte „totale therapeutische Milieu“ der „Orthogenic School“, einer psychiatrischen Anstalt, die der Universität Chicago angegliedert ist Dieses Therapieheim existiert schon lange; 1944 hatte Bettelheim die Direktion übernommen, modernisierte es entscheidend und leitete es bis zu seiner Pensionierung 1973. Er wurde in Wien psychoanalytisch ausgebildet und hat seine Planung „den Einsichten der Psychoanalyse entnommen“, dennoch ist sie „nicht die Behandlungsmethode“, welche seine Patienten brauchen. Man hat sich nämlich, von einschlägigen Erfolgen angeeifert, auf die Behandlung jener schweren Störungen spezialisiert, welche „auitistische Kinder, jugendliche Rauschgiftsüchtige und Selbstmordgefährdete'' aufweisen. Es ist eine „offene“ Anstalt, jeder hält sich freiwillig dort auf, gerichtliche Einweisungen werden nicht übernommen Ebenso sorgfältig wie die Patienten werden auch die Betreuer ausgewählt, und das vom Koch oder Hausmeister angefangen (Es scheint dort keine Personalprobleme zu geben.) Nun, Bettelheim ist der angesehene Wortführer derer, die kindlichen Autismus
auf psychologische Ursachen zurückführen; L. Kanner und andere halten ihn für angeboren. Jener hat den therapeutischen Optimismus für sich, widmet sich aber nur einem beschränkten Patientenkreis und muß ihm das ganze Milieu] anpassen. Seine Kritik an psychiatrischen Krankenhäusern ist nicht neu, vielfach sogar überholt und träfe z. B. auf die neue Wiener Universitätsklinik nur noch teilweise zu, abgesehen davon, daß diese Institute sich ihre Pfleglinge nioht aussuchen können. Also: Cui bono? Nervenärzte wissen das alles, selbstverständlich, Behördenvertreter werden sich einer so zeitraubenden Lektüre kaum widmen (das Buch könnte ohne Inf ormations-verlust auf ein Fünftel reduziert werden), und den neugierigen Laien
könnte es erschrecken. Er kann sein autistisches Kind nicht nach Chicago schicken und wird, erschüttert von solcher Kritik, der Psychiatrie nur noch ablehnender gegenüberstehen, als es hierzulande sowieso üblich ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!