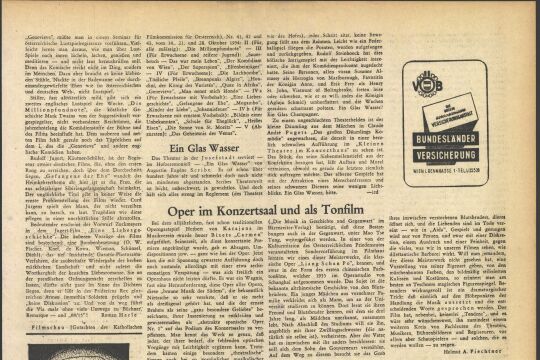Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Musiker aus Mähren
Leoš Janáček, der bereits 1928 im Alter von 74 Jahren starb, 1st bei uns noch zu entdecken. Er wurde 1834 in Nordmähren geboren, lernte und lehrte in Brünn — und blieb lange Zeit für Prag ein Außenseiter, eine provinzielle Erscheinung. Zwölf Jahre hat es gedauert, bis die Meisteroper „Jenufa" den Weg auf die Bühne des Nationaltheaters in Prag fand. 1916 spielte man „Jenufa“ auch an der Wiener Hofoper, aber erst die mustergültige Berliner Premiere zehn Jahre später hat dem Werk den Welterfolg gebracht. So kam für Janáček, diesen eigenwilligen und originellen Musiker, alles ein wenig spät. Aber er trug es mit Gelassenheit.
Leoš Janáček, der bereits 1928 im Alter von 74 Jahren starb, 1st bei uns noch zu entdecken. Er wurde 1834 in Nordmähren geboren, lernte und lehrte in Brünn — und blieb lange Zeit für Prag ein Außenseiter, eine provinzielle Erscheinung. Zwölf Jahre hat es gedauert, bis die Meisteroper „Jenufa" den Weg auf die Bühne des Nationaltheaters in Prag fand. 1916 spielte man „Jenufa“ auch an der Wiener Hofoper, aber erst die mustergültige Berliner Premiere zehn Jahre später hat dem Werk den Welterfolg gebracht. So kam für Janáček, diesen eigenwilligen und originellen Musiker, alles ein wenig spät. Aber er trug es mit Gelassenheit.
Insgesamt neun Opern hat Janáček geschrieben, von denen sechs als Meisterwerke angesprochen werden können. In der Wahl seiner Sujets zeigte sich Janáček unsicher, schwankend, von augenblicklichen Impulsen geleitet. Nur die heimischen Sujets und die aus der russischen Literatur — deren großer Bewunderer er war —- haben eine Konstante, die von starken Gefühlen wie Mitleid, Liebe, Schuld und Reué geprägt ist. Es sind dies die Opern „Katja Kabanowa“ nach Tolstoi, „Aus einem Totenhaus“ nach Dostojewskis Aufzeichnungen, und die bereits erwähnte „Jenufa", ursprünglich „Ihre Ziehtochter“, nach einer Novelle der Gabriele Preissowa. Ins Zentrum von Janáčeks Lebens- und Naturgefühl führt „Das schlaue Füchslein“, nach einem Roman von Rudolf Tesnohlidek. „Die Sache Makropoulos“, eine Utopie vom künstlich verlängerten Leben, und „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ sind gewissermaßen Außenseiter.
Für jede der genannten Opern brauchte Janáček jeweils zwei bis drei Jahre. Nur an seinem ersten Bühnenwerk, „Jenufa“, arbeitete er neun Jahre, und ebensolang brauchte er für den Herrn Brouček. Den Stoff fand er in zwei Novellen seines Landsmannes Svatopluk Cech: „Die Ausflüge des Herrn Brouček auf den Mond“ und „Die Ausflüge des Herrn Brouček ins 15. Jahrhundert". Aber Janáček, der sonąt eigenhändig, seine Texte nach brauchbaren Vorlagen gestaltete, kam diesmal nicht zurecht: sechs Textbearbedter mußten helfen, bis ein Libretto zustande kam. Das gilt besonders für den ersten Teil, mit dem Janáček in den Jahren 1908 bis 1917 beschäftigt war, während er den 2. Teil innerhalb eines Jahres vollendete. 1920 fand unter der Leitung von Otakar Ostrcil die Premiere am Prager Nationaltheater statt.
Wer ist nun dieser Brouček, der zuerst auf den Mond, in ein poetisches Fabelreich, und dann ins 15. Jahrhundert entführt wird, wo die Hussitenkriege toben? Er ist ein Prager Spießbürger, eine Art Schwejk, mit wenig sympathischen Zügen, von dem Janáček selbst einmal sagte: „Ich wollte, daß uns ein solcher Mensch widerwärtig werde, daß wir ihn auf Schritt und Tritt erwürgen, aber vor allem in uns selbst. Daß wir wegen des Charakters der Broučeks nicht leiden müssen, wie andere wegen ihrer Oblomows leiden.“
Aber gar so unliebenswürdig ist dieser Brouček nicht: Janáčeks Musik hat ihn zwar nicht idealisiert, aber in eine Sphäre gerückt, wo Humor, Ironie und gutmütiger Spott — auch gegenüber den allzu ätherischen Mondwesen — regieren.
Die Musik Janáčeks, dieses originellen und impulsiven Musikers, hat drei Quellen: die mährische Folklore in Lied und Tanz, die Sprechmelodien, die er mit akribischer Genauigkeit aufzeichnete, und die Naturlaute, die er ebenfalls nicht „impressionistisch“, sondern mit größtmöglichem Realismus wiederzugeben versuchte. Aber nicht nur an Stimmungsbildern und grotesken Szenen ist diese Oper reich, sondern es gibt darin auch Belkantostellen und eine große schwärmerische Arie des Freiheitsdichters Svatopluk Cech sowie Kriegslieder und Choräle der streitbaren Hussiten. Dem Regisseur und dem Bühnenbildner ist reichlich Gelegenheit gegeben, zu zaubern und interessantes Theater zu machen. — Ist das in der Volksoper, wo man die deutsche Übertragung von Robert Brock spielte, geschehen?
Das Bühnenbild Wolfram Skalickii für die Rahmenhandlung im alter
Prag war stimmungsvoll, hatte Atmosphäre. Das Fabelreich der Poesie auf dem Mond verwechselten der Regisseur Adolf Rott und der Bühnenbildner ein wenig mit einem Hippiefest im Prater. Für ein saty- risches Spiel, wie es vom Dichter und vom Musiker gemeint ist, fehlt die Transparenz, die Leichtigkeit und Eleganz. Freilich liegt auch dem Komponisten diese Sphäre nicht sonderlich. Die Szene aus den Hussitenkriegen mit den an Rotarmisten erinnernden Gestalten, ihre geschlossen vorrückende Formation, gelang beklemmend echt. Daß der Text des Freiheitshymnus von Svatopluk Cech während des Gesangs in großen Lettern auf den Hintergrund projiziert wurde, wirkte zwar fremdartig, aber diese ganze Szene ist, ja auchvon Janáček als Montage angelegt…(„De? Richter spricht“). Ronny Reiter hat viele Kostüme entworfen, mit Phantasie und dem Stil der Inszenierung angepaßt.
Mit Karl-Ernst Merckers Brouček, der zweimal in ein ihm ungemäßes Milieu stolpert, konnte man, dank der Lebensechtheit dieser Figur und ihrer vorbildlichen Interpretation, nur Sympathie — oder Mitleid — empfinden. Wolfgang Witte als Kunstmaler Peter und Stemenfried hat einen Tenor mit trompetenartigem Timbre einzusetzen. Ernst Gutstein war ein glaubwürdiger, schön singender Sakristan und Mondkri- stan. Marilyn Zschau sang die drei Partien der Malinka (in der Rahmenhandlung), der Etherea auf dem Mond und der Kunka im 2. Akt mit schöntimbrierter, großer und guttragender Stimme. Auch Jaroslav Stajnc und Elisabeth Sobota bewährten sich in je drei sehr verschiedenartigen Rollen darstellerisch und stimmlich bestens. Den großen Hymnus Cechs trug Peter Baillie recht eindrucksvoll vor. — Das Schönste freilich kam aus dem Orchester unter der Leitung von Jaroslav Krombholc, der ein erstklassiger Janáček-Dirígent ist. Das Orchester folgte ihm erst ein wenig zögernd und etwas unsicher, erwärmte sich aber rasch und spielte im zweiten, auch musikalisch ergiebigeren Akt klangschön und intensiv.
Viel Beifall für alle Ausführenden. (Da jeder der beiden Akte nur eine knappe Stunde dauert — weshalb der vorverlegte Anfang auf 19 Uhr?)
• Die folgenden Festspiele kündigt Berlin an: Das deutschsprachige Theatertreffen vom 15. bis 26. Mai, die 21. Internationalen Filmfestspiele vom 25. Juni bis 6. Juli und schließlich die Berliner Festwochen vom 12. bis 30. September und die Jazztage vom 4. bis 7. November 1971.
• Krysztof Penderecki schreibt an einem Werk für Kammerorchester und ein Tänzerpaar, „Canticum Can- ticorum“, das beim Gulbenkian- Festival 1971 uraufgeführt werden soll.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!