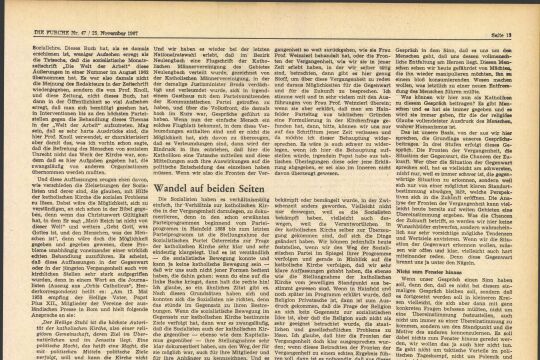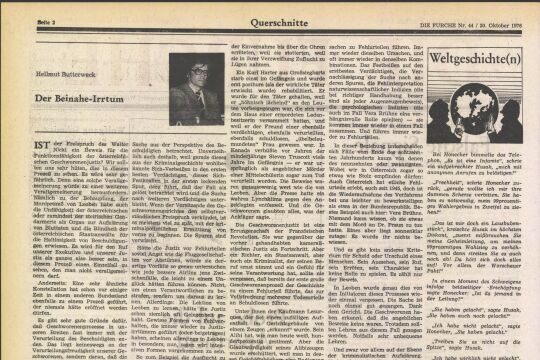Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Recht tot, Opfer leben
„Wir stechen in See, auf natürlich weitgehend in der Vollziehung unbekannte Meere, aber wir werden schon auch zu neuen Ufern damit kommen. Ich bin da ganz sicher.“
Derart zuversichtlich gab sich Justizreformer Christian Broda, als am 16. März 1978 in euphorischer Übereinstimmung aller drei Parlamentsparteien die Strafprozeßnovelle 1978 verabschiedet wurde.
Ihr Kernpunkt: Entschädigungsleistungen an Verbrechensopfer haben Vorrang gegenüber den staatlichen Geldstrafen. Zuerst müßte also ein wegen Diebstahls oder Betruges Verurteilter dem Opfer den Schaden ersetzen,
dann erst bekommt die Republik „ihre“ Geldstrafe.
Von der Hilfe für Verbrechensopfer wurde vor und bei Beschlußfassung sehr viel gesprochen, jetzt herrscht Funkstille. Mit gutem Grund: Nach eineinhalb Jahren ist- frei nach Broda - kein Land in Sicht. Was als beispielgebende Großtat des Kleinstaates Österreich gefeiert wurde, wird in aller Stille vergessen. Weil sich nichts tut, hört man auch nichts.
„Das kann ich nur bestätigen: Ich hör’ überhaupt nichts“, meint Günter Woratsch, Oberlandesgerichtsrat und Vizepräsident der Richtervereinigung, darauf angesprochen.
Ist vielleicht den Rechtsanwälten bekannt, daß die gesetzlichen Bestimmungen angewendet werden? Kammerpräsident Walter Schuppich antwortet: „Schlicht und einfach - nein.“
Das Justizministerium bestätigt die Erfahrungen der beiden Standes- vertreter zurückhaltend vorsichtig. „Wir wissen“, bedauert der zuständige Sektionschef Egmont Foregger, „daß leider diese Bestimmung relativ wenig angewendet wird.“ Und Brodas Pressesprecher Sepp Rieder sekundiert: „Von dieser Bestimmung wird, soweit ich gehört habe, kaum Gebrauch gemacht.“
Die Hoffnung, doch einen Fall zu finden, bei dem das Hilfe-Gesetz einem Verbrechensopfer geholfen hat, kann auch Sektionschef Foregger nicht erfüllen: „Ich kann Ihnen keine Zahlen bieten, weil ich keine zur Hand habe. Das ist nicht in die üblichen Statistiken miteinbezogen.“
Wo die Statistik ausläßt, wird in Er innerungen gekramt. Vom Hörensagen-will Foregger von drei Fällen erfahren haben, nur weiß ernichts über deren Ausgang. Woratsch hat gesprächsweise einmal von einem Kollegen gehört, „daß er einen Fall gehabt hat, da brauch ich Ihnen nicht mehr zu sagen: wir haben 90 Richter hier im Haus“ (Landesgericht für Strafsachen, Wien).
Dabei gesteht Woratsch offen einen Irrtum ein. Bei der Beratung des Gesetzes haben die Richter nämlich Bedenken wegen der zu erwartenden Mehrbelastung vorgebracht. Doch Broda beruhigte und riet zum Abwarten.
„Der Minister“, so Woratsch heute, „hat in diesem Fall recht gehabt. Es hat tatsächlich keine Mehrbelastung gegeben, weil nichts kotnmt“
Der seinerzeitige Broda-Ratschlag än die Adresse der Richter war vielleicht realistisch, stand aber im direk- tenGegensatz zur offiziellen Sprachregelung, die der Justizminister im Parlament vertrat. „Die praktischen
Auswirkungen“, deponierte er dort, „sind sehr bedeutend, das wird man sehr bald sehen, und niemand wird das Gesetz kleinlich auslegen wollen und niemand wird mit gutem Grund glauben können, daß das ein Gesetz ist, das nur auf dem Papier stehen wird, sondern dieses Gesetz wird sehr rasch wirksam werden.“
Eineinhalb Jahre später hält Woratsch das so gepriesene Paragraphenwerk „für die Inkarnation des Gesetzes zum Herzeigen. Aus meiner Sicht stellt sich das als totes Recht dar. Aber das ist ja nicht Sinn des Gesetzes, daß die Leute nichts bekommen“.
Das Recht ist tot, die Opfer leben.
Im nachhinein ist nun auch Sepp Rieder bewußt, es sei schon von vornherein klar gewesen, „daß das nicht so große Dimensionen annehmen wird“. Daß es aber keinerlei Dimensionen angenommen hat, berührt alle
Beteiligten peinlich.
„Entweder sind die Leute nicht informiert“, sucht Woratsch nach einer Erklärung, „oder sie haben ein gesundes Mißtrauen.“ Ein Informationsmangel wäre durchaus vorstellbar. Auch bei den Anwälten?
„Wenn’s bei den Anwälten ein Informationsmangel ist, wäre das ein Armutszeugnis.“
Schuppich selbst bestreitet diesen Informationsmangel nicht, sieht aber auch in der Konstruktion des Gesetzes Probleme: „Das ist wie mit einem Salon, den man zum Herzeigen hat, den man aber nicht betritt.“ Mehr produzierte Gesetze, ist er sich mit der Richterseite zudem einig, bedeuten noch lange nicht mehr Recht und Hilfe für den einzelnen.
Das Justizministerium beteuert zwar, jedem Geschädigten ein Formblatt zu übermitteln, in dem er informiert wird; „man muß aber auch untersuchen, was die Gründe sind, warum so wenig Gebrauch gemacht wird“
(Rieder).
Übereinstimmend finden zwar alle kompetenten Stellen, daß ein Hilfsbedürfnis bei den Verbrechensop- fem vorhanden ist, aber die Regelung geht an den praktischen Notwendigkeiten vorbei: Eine gute, sogar großartige
Idee wurde als Minimallösung unbrauchbar.
Mehr schlecht als Recht
Dazu kommt auch noch das Problem einer bürokratischen Doppel- geleisigkeit. Neben den Bestimmungen der Strafprozeßnovelle 1978 gibt es nämlich auch noch ein gesondertes Verbrechensopferentschädigungsgesetz,
das allerdings als reine Sozialfürsorge konzipiert ist. Damit soll Verbrechensopfem in Fällen geholfen werden, in denen das Netz der Sozialversicherung Löcher hat, keinesfalls wird aber dadurch materieller Schaden eines
Verbrechens abgedeckt. Diesbezügliche Anträge sind zudem nicht bei Gericht, sondern bei den Landesinvalidenämtem einzubringen.
Die Hoffnung, daß durch die Strafprozeßnovelle Verbrechensopfem rasch und unbürokratisch substantielle Hilfe geleistet wird, hat sich nicht erfüllt. Eine große Reform hat nicht gehalten, was die Papierform versprochen hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!