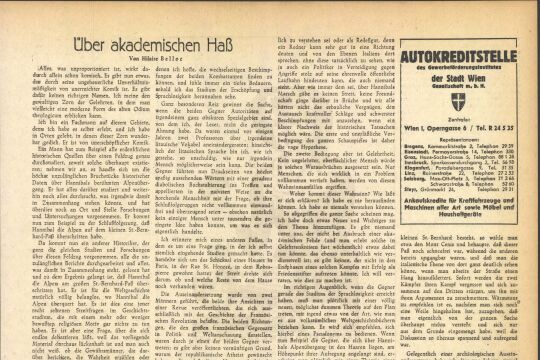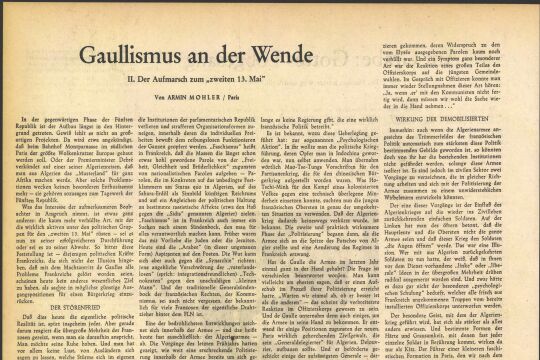offizielle Vorschläge auszuarbeiten; an dem Konzil liegt es, die Beschlüsse zu fassen. Der Gedanke des Papstes scheint also dieser zu sein: Die Vorbereitenden Kommissionen sollen die Diskussionsvorlagen schaffen, dann will der Papst die Reaktionen des versammelten Episkopats prüfen. Falls diese der Vorlage günstig sind, kann das Konzil kurz dauern. Falls sich aber eine bedeutende Opposition unter den am Konzil teilnehmenden Bischöfen zeigen sollte, so wird dieser Gelegenheit gegeben werden, auf die weiteren Beratungen Einfluß zu nehmen. Dann allerdings wird das Konzil viel länger dauern. Es ist also eine ungerechte Behauptung, zu sagen: Johannes XXIII. will ein kurzes Konzil machen. Was er will, ist, ein kurzes Konzil zu ermöglichen.
DEM PAPST ALLEIN VORBEHALTEN
Nicht weniger ungerecht ist die Behauptung, eine Diskussion sei überflüssig, weil jede Entscheidung ohnedies vom Papst komme. Dazu ist zu bemerken, daß für alle Konzilien der Geschichte und teilweise auch für das Vaticanum I ein bestimmter Anlaß vorgelegen hatte. Für das Vaticanum II liegt überhaupt kein direkter Anlaß vor, seine Einberufung ist daher auch gänzlich unerwartet gekommen. Die Theologen sind der Meinung, daß ein Konzil zwar möglich sei, der Entwicklung der römischen Kurie nach und nach der Verkündung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes aber auch überflüssig. Johannes XXIII. sieht das Konzil aber unter einem anderen Aspekt: von den meisten dieser obersten ökumenischen Versammlungen der katholischen Kirche ist eine starke religiöse Erneuerung ausgegangen. Für ihn hat die Erneuerung in unserer Zeit nur eine Bedeutung: Rückkehr zur Einheit und zur Reinheit des Evangeliums. Das vatikanische Konzil ist für ihn das große Unternehmen seines Ponti-fikats geworden, und er widmet dem Studium der vergangenen Konzilien täglich mehrere Stunden. Aus fast allen Ansprachen klingt heraus, wie ihn die Konzilsidee innerlich beschäftigt und mit welch heißen Wünschen er ihr Gelingen herbeisehnt. Damit dieses Gelingen seinen Ideen folgt und nicht kompromittiert wird, ist die Konzilsangelegenheit unter jenen Dingen, bei denen er sich die grundsätzlichen Entscheidungen durchaus vorbehalten hat. Er berät sie mit dem Staatssekretär oder mit den Präfekten der einzelnen Kongregationen, aber er entscheidet selbst.
Diese Feststellung ist nicht überflüssig, denn eine gewisse Berichterstattung hat immer wieder durchblicken lassen wollen, daß die Vorbereitung des Konzils den Absichten und den Händen Johannes' XXIII. entglitten sei. Doch genügt das Studium des Motu proprio „Supremo Dei nutu“ vom 5. Mai 1960, um zu erkennen, wie wenig Papst Roncalli gewillt ist, sich sein „großes Unternehmen“ entwinden zu lassen. Die absolute Gewalt des Papstes über das Konzil wird darin in geradezu eindrucksvoller Weise bekräftigt. Er allein wählt die Materien, die Vorsitzenden, Konsulenten, Mitglieder des Konzils, bestimmt ihre Anzahl, die Norme.i und die Entwickhing der Vorbereitung.
Perfekter Pariser ist man erst, wenn man das Wochenblatt „L e Canard enchaine“ von der ersten bis zur letzten Zeile kapiert. Ich zum Beispiel wohne nun seit siebeneinhalb Jahren in Paris. Aber obgleich ich kein Produkt der französischen Presse so gründlich lese wie diese „gefesselte Ente“, gibt es immer noch Dinge auf den sechs Seiten dieser Wochenzeitung, wo ich nicht nachsteige. Da gibt es zum Beispiel ganz hinten eine Rubrik, wo jeweils etwas ins „Album der Komtesse“ geschrieben wird: stets hochgestochene Worte recht banalen Inhalts. Aber die Eingeweihten, zu denen ich in diesem Fall leider nicht gehöre, beginnen meist unverschämt zu grinsen, nachdem sie gemerkt haben, welche Buchstaben umgestellt werden müssen. Aber ich greife vor. Was ist überhaupt der „Canard“?
Von außen gesehen ist er einfach das politische Witzblatt Frankreichs, in dem Texte und Karikaturen bunt durcheinanderwechseln. Der Kenner jedoch weiß, daß diese so „unseriös“ auftretende Zeitung das innenpolitisch bestinformierte Blatt des Landes ist. (Sein nicht sonderlich ausgebauter außenpolitischer Teil hält lange nicht die gleiche Höhe, was aber in einem so wenig am Ausland interessierten Land wenig wundert.) Man kann guten Gewissens sagen: im „Canard“ steht sehr viel, was man erst 14 Tage später im „France-Observateur“, im „Express“ oder gewissen Organen der äußersten Rechten liest — und was man im ,,Figaro“ nie lesen wird. Darüber hinaus aber ist er eine Institution. Das sieht man schon daran, daß jeder weiß, wer mit dem „Canard“ gemeint ist, obwohl in der Umgangssprache jede Zeitung ein „canard“ (kleingeschrieben) ist. Es gibt eine typische Anekdote von Robert Lacoste, dem man viel vorwerfen kann, bloß das nicht, daß er kein typischer Franzose sei. Als er noch als Vizekönig in Algier amtete und im „Canard“ gerade wieder eine saftige Enthüllung über algerische Angelegenheiten erschienen war, schlug ihm ein Herr seines Kabinetts vor, die Zeitung für Algerien zu verbieten. Der Beamte zog sich aber die Replik zu: „Meinen Sie denn, ich stelle mich als ein Rindvieh (im Original: c..) hin, das den ,Canard' verbietet!...“
Wenn uns unsere Erinnerung nicht täuscht, ist in all den Jahren, in denen wir den „Canard“ nun lesen, nie eine Nummer dieses Blattes beschlagnahmt worden (in Frankreich wohlverstanden; in Algerien werden sogar ausgesprochene Regierungsblätter beschlagnahmt). Es gibt wohl kaum ein anderes ausgesprochenes Oppositionsorgan, das das von sich sagen kann. Das liegt nur daran, daß der „Canard“ seine explosivsten Enthüllungen jeweils mit Scheinheiligkeiten von diesem Stile serviert: „ ... Das sind natürlich gräßliche Verleumdungen, an die wir niemals zu glauben wagen!“ Schließlich gibt es auch viele Spalten, wo sich die Equipe des „Canard“ gar nicht versteckt. Beispielsweise findet sich seit Wochen auf der dritten Seite eine ständige Rubrik „La Cour“ (Der Hof), in der im höfischen Französisch des 18. Jahrhunderts von einem als Sonnenkönig auftretenden de Gaulle berichtet wird, den man im Gebetsstuhl sprechen hört: „Mein Gott, Du kannst ruhig Vertrauen zu mir haben.“
Aber das ist nur eine Rubrik unter vielen. Der erste Blick gilt stets dem Enterich und der Ente, die den Zeitungskopf einrahmen und dabei Zwiegespräch halten. Am 7. Dezember fragte ,,er“: „Wo versteckt er sich?“ Lind „sie“ antwortete: „Beim Barbier von Sevilla!“ (Vergleiche Abbildung.) Da zwei Tage vorher der bärtige Lagaillarde nach Spanien verschwunden war, wußte der Leser sogleich, wer gemeint war. So glitzert es durch das ganze Blatt von Anspielungen. Ist die Rede von einer Ultraregierung, so stellt der „Canard“ gleich eine Regierungsliste auf: Susini, der sich im „Barrikadenprozeß“ zu einem „nationalen Sozialismus“ bekannte, bekommt da das Portefeuille der „Nazfonalen Erziehung, und der nach Spanien geflüchtete Kovacs, der seinerzeit mit der
Bazooka auf General Salan schoß, das Verteidigungsministerium. Eine sehr beliebte Spalte ist ausschließlich (leider meist unübersetzbaren) Kalauern über die aktuellen Ereignisse gewidmet; allwöchentlich wird die „Ehrennuß“ an die Persönlichkeit verliehen, die in den verflossenen sieben Tagen den größten Blödsinn gesagt oder geschrieben haben soll (Zitat anbei); es gibt Film-, Theater-, Radio- und Fernsehkritik und sogar einen Briefkasten (in dem man unter „Cocteau“ einmal lesen konnte: „Marais homo nostrum“). Wir können hier gar nicht . alle Rubriken aufzählen — wir beschränken uns auf das, was den politisch interessierten Leser am „Canard“ am meisten interessiert: die bei aller scherzhaften Aufmachung durchaus ernst gemeinten politischen Informationen, die sich als eine Kette von mit Zwischentiteln markierten Anekdoten (sogenannten „potins“) über die Seiten 2 und 3 hinwegziehen.
Man hat sich oft gefragt, wo der „Canard“ diese Informationen her hat. Man kann diese Frage zusammen mit der anderen beantworten, wie ein Blatt leben kann, das von niemandem subventioniert wird, pro Stück bloß 35 Cts. kostet und zum Segen für seine Freiheit kein einziges Inserat annimmt. Der „Canard“ kommt mit einem geringen Personal aus, weil ihm der Großteil seiner Informationen ins Haus geliefert wird. Ein Beispiel für viele. Ein Minister ist einem Kollegen nicht gerade grün. Was tut er? Er steckt dem „Canard“ das Material über ein Skandälchen im Ressort des lieben Kollegen zu. Die Fama geht um, daß die Arbeit der „Canard“-Redakteure nicht wie die Arbeit anderer Redaktionen im Sammeln von Material, sondern vielmehr im Sichten und Kontrollieren des überreich Zugeströmten bestehe.
Es wäre nun aber falsch, zu glauben, der „Canard“ sei ein bloßes Auffangbecken für solche „potins“. Er hat durchaus auch eine Richtung. Ihn als „links“ oder gar „sehr links“ einzustufen, wäre zu summarisch — er ist vor allem nonkonformistisch. Auch dafür ein Beispiel. Der Schriftsteller Henry Coston gilt als Faschist, und das nicht ohne Grund, denn er hat vor dem letzten Weltkrieg eine antisemitische Zeitschrift herausgegeben. Von diesem Coston kam nun letztes Jahr ein Buch, „Le Retour des 200 Familie s“ (Die Rückkehr der 200 Familien, Verlag Librairie Francaise, Paris), heraus, das ausschließlich aus Ausschnitten aus der offiziellen Presse besteht und eine These verficht, die zumindest geprüft werden sollte: daß nämlich in der Fünften Republik die in bestimmten Familien verkörperten großen Geldmächte in einer Weise die unmittelbare politische Macht ergriffen hätten, für die es keinen Präzedenzfall in der französischen Geschichte gebe. Daß in der offiziellen Presse kein Sterbenswörtchen über dieses Buch gesagt wird, erstaunt nicht. Aber selbst das rechtsextremistische Wochenblatt „Rivarol“, in dem Costons politische Weggefährten sitzen, wagte, aus Angst um seinen Inseratenteil, nicht, von diesem Buch zu sprechen oder auch nur ein bezahltes Inserat darüber aufzunehmen. Der „Canard“ jedoch sagte: Der uns als Faschist unsympathische Herr Coston hat ein Buch veröffentlicht, mit dem man sich auseinandersetzen muß. Und er machte seine Leser über viele Spalten hinweg mit dem von Coston verarbeiteten Material bekannt. Coston hat es wohl in erster Linie dem „Canard“ (und einem anderen Nonkonformistenorgan, dem „Crapouillot“) zu verdanken, wenn er von seinem von ganz links bis ganz rechts totgeschwiegenen Buch schon viele Tausende von Exemplaren verkauft hat.
In einem Punkt allerdings ist der „Canard“ doch etwas konformistisch. Er ist nämlich in einem Grade antiklerikal (oder, wie es in Frankreich heißt: laizistisch), wie man es heute wirklich nur noch an der Seine sein kann.
Andere Länder, andere Sitten. Vielleicht ist es auch nur in Frankreich möglich, daß ein Witzblatt in so starkem Maße meinungsbildend wirken kann: die Franzosen sind nun einmal Leute, die einer Pointe schwer zu widerstehen vermögen. Sie sind so sprachbewußt, daß man sie mit einer gutgezielten Wendung fast besser beeinflussen kann als mit einem Haufen „facts“. Das Bild Soustelles in den Köpfen tausender Franzosen wird von dem Spitznamen bestimmt, den ihm der „Canard“ angehängt hat: „gros-matou“, „dicker Kater“, mit all dem geschmeidig und zugleich träge Lauernden, das darin liegt. Vielleicht hat es stärker als jede parlamentarische Opposition gegen die Fünfte Republik gewirkt, als der „Canard“ eines Tages harmlos lächelnd dazu überging, vor jede mit de Gaulle zusammenhängende Person ohne Abstand eiri großgeschriebenes „Man“ (Mein) zu setzen. Premierminister Debre wird sich nie vom „Mondebre“ erholen können. Und als der „Canard“ begann, auch die übliche Anrede an den Staatschef, „mon General“, plötzlich
„Erholt euch in Spanien, dem Land der Kapuzenmänner — Sicherheit, aber nicht Gesundheit — Agentur France.“ (Ein Beispiel für die Wortspiele des „Canard“: „Cagoulards“ nennt man in Frankreich faschistische Terroristen; „Sante“ ist auch der Name des Pariser Gefängnisses, in dem Lagaillarde laß.)
„Mongeneal“ zu schreiben, soll das zu ergötzlichen Atemübungen in der Umgebung de Gaulles geführt haben: jedermann trennte vor dem hohen Herrn das „mon“ und das „General“ so deutlich wie möglich, um nicht subversiver Tendenzen verdächtig zu erscheinen. So deutlich zuweilen, daß das befürchtete Stirnrunzeln erst recht eintrat...
Die bloße Existenz eines Blattes wie de „Canard enchaine“ ist ein Maßstab. Wenn er eines Tages verschwinden sollte, wird man wissen, daß es mit der Französischen Republik endgültig zu Ende ist.