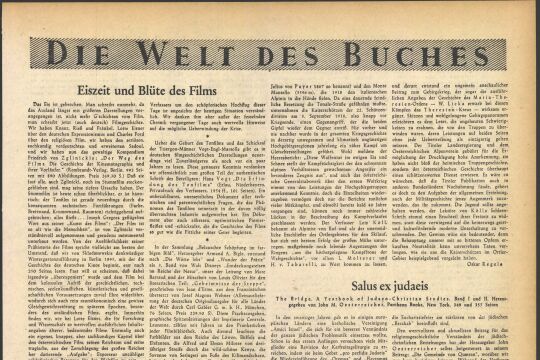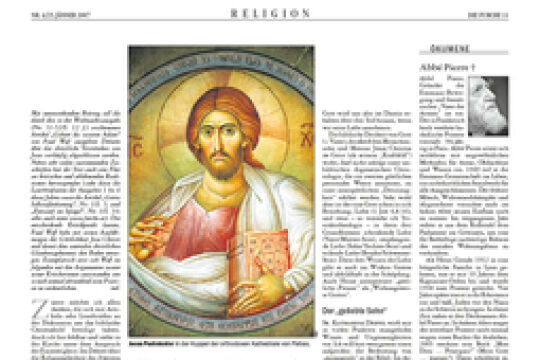Dialog ohne Umkehr
Die lektüre des jüngsten vatikanischen Dokuments übers Judentum zeigt: Der Dialog-Weg der Kirche zu den Juden ist noch weit. sehr weit.
Die lektüre des jüngsten vatikanischen Dokuments übers Judentum zeigt: Der Dialog-Weg der Kirche zu den Juden ist noch weit. sehr weit.
Am 10. Dezember 2015 hat die Vatikanische Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum das Dokument Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt (Röm 11,29) veröffentlicht. Anlass ist der 50. Jahrestag der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils Nostra Aetate, in dessen Kapitel 4 es um das Verhältnis von Kirche und Judentum geht.
Im Vorwort liest man, dieses Dokument sei kein Dokument des Lehramtes, sondern biete Überlegungen, deren Bedeutung für die Mitglieder beider Glaubenstraditionen relevant und zugleich Ausgangspunkt für eine weitere theologische Reflexion sein soll.
Damit wird ein Anspruch formuliert, den die katholische Tradition über mehr als eineinhalb Jahrtausende kennt: Man spricht nicht nur fürs katholische Christentum, sondern auch für das Judentum. Das mag als eine Einladung an Juden verstanden werden, sich mit diesem Dokument zu befassen; es schwingt aber auch etwas anderes mit: Juden wird von christlicher Lehre beschieden, wie sie sich verstehen sollen.
Diese Methode der Fremdbeschreibung mündete stets, auch unabhängig von ihrer Motivation, in die Enterbung des Judentums durch das Christentum und in die damit verbundene theologische Zerstörung jüdischer Eigenständigkeit ein. Denn angesichts der Universalität des Christentums ist das Judentum neben Christus abgetan.
Eine verwegene Argumentation
Dieses Problem dürften die Verfasser dieses Dokuments geahnt haben; so betonen sie, es gehe nicht um Fremdbeschreibung des Judentums, sondern im Geist von Nostra Aetate 4 darum, so mit dem Judentum vertraut zu werden, wie es sich selbst versteht (Nr. 4). Das aber ist christliche Fiktion, sehr verwegen und de facto nirgendwo eingelöst. Dafür fehlt es an echter Demut - nicht zu verwechseln mit taktvoller Bescheidenheit -und an Bildungsvoraussetzungen: Christen kennen sich in rabbinischen Überlieferungen nicht aus, weil sie nie gelernt haben, sie zu lesen und zu interpretieren.
Sieben Teile hat das Dokument. Zunächst geht es um eine kurze kirchliche Wirkungsgeschichte von "Nostra Aetate"(Nr 4). Teil 2 bezieht sich auf die theologische Sonderstellung des jüdisch-katholischen Dialogs und betont die Grenzmarkierung des Christusereignisses, das außerhalb des jüdischen Erwartungshorizontes (Nr. 14) stehe. Durch gegenseitige Polemik trennten sich die Wege (Nr. 16), eine Entschärfung dieser Entwicklung habe das 2. Vatikanische Konzil gebracht (Nr. 17).
Vom Heil ausgeschlossen - oder doch nicht?
In Teil 3 ist die Rede von der Offenbarung und dem Heilsplan Gottes (Nr. 22), der sich in Christus erfüllt habe; gleichzeitig wird die an sich zwingende Logik bestritten, dass das nicht zu solcher Erfüllung gelangte Israel nicht mehr als Volk Gottes betrachtet werden kann (Nr. 23). Teil 4, die Beziehungen zwischen Altem und Neuem Bund, steht unter der gleichen Vorgabe des Heilsplans: Jesus lebt in der Zeit des Alten Bundes, doch in seinem Heilswerk im Neuen Bund bestätigt und vollendet er die Dimensionen des Alten (Nr. 28). Daher ist die Kirche der endgültige und definitive Ort des Heilshandelns Gottes (Nr. 32).
Und da nun Christus, wie Teil 5 titelt, die exklusive Heilsuniversalität Gottes ist (Nr. 35), wird es wieder fürs Judentum eng, das Jesus weder als Messias bekennt noch als Gottmenschen; das Dokument begegnet diesem Problem mit dem Hinweis, daraus folge jedoch in keiner Weise, dass die Juden von Gottes Heil ausgeschlossen wären. Die Rettung der Juden ist und bleibt ein abgrundtiefes Geheimnis Gottes (Nr. 36). Teil 6 verlangt das entschiedene Christus-Zeugnis der Christen gegenüber Juden (Nr. 40).
In Teil 7 werden Dialogziele genannt wie gegenseitiges Kennenlernen, volle Religionsfreiheit von christlichen Gemeinden in Israel - das sei sogar ein Lackmus-Test (Nr. 46) - und gemeinsame Wachsamkeit gegenüber Rassismus und Antisemitismus.
Dieses Dokument tut sich sehr schwer mit der Reflexion seiner Thematik. Die von ihm angeregte weitere theologische Reflexion ist nicht zu machen ohne Analyse seines Textes. Diese kann man an einem Punkt zusammenfassen: Das Dokument ignoriert die Voraussetzungen seiner Grundlage und unterläuft damit das, was zu jedem ehrlichen Dialog gehört - die gewissenhafte Nachfrage bei sich selbst, die echter Umkehr vorausgeht. Die Voraussetzungen liegen vereinfacht darin, dass die kirchliche Lehrentwicklung, die vom vierten Jahrhundert an heidenchristlich und antijüdisch war, als sakrosankt fixiert wird.
Diese Lehrentwicklung hat Dogmen formuliert, in denen Jesus seiner jüdischen Bestimmtheit entkleidet wurde; und damit war eine neben dem Gottmenschen weiterlaufende Relevanz des Judentums verneint. So haben viele christliche Gelehrte der Antike, die aus dem Heidentum kamen, mit diesem die Aversion gegen Juden und gegen den jüdischen Jesus geteilt, Jüdisches innerhalb und außerhalb ihrer Gemeinden scharf bekämpft - mit Brandreden etwa, die man bei Johannes Chrysostomos häufig findet - und einen nicht durchs Judentum kontaminierten Jesus geschaffen.
So etwas kann man aus Stilgründen heute nicht machen. Das Dokument will sich auf einen anderen Weg begeben, bleibt aber dieser Vorgabe verhaftet, weil es den Bruch, der in dieser frühen Zeit der Lehre erfolgte, nicht reflektiert. Stattdessen wird geschrieben, Christentum und Judentum seien zwei gleichwertige Wege, wie man sich die Schriften Israels nach der Tempelzerstörung im Jahr 70 zu eigen gemacht habe (Nr. 25). Doch diese Gleichwertigkeit, die angesichts der Exklusivität des Christus nicht theologisch, sondern nur historisch gemeint sein kann, liegt keineswegs vor. Glasklarer Monotheismus (in der gegenwärtigen Theologie mitunter als "abstrakt" denunziert), Schabbat, Beschneidung, Elternehre, Bilderverbot oder der Gebrauch des Hebräischen - zentrale Kennzeichen des biblischen Judentums - sind auch Identitätsmerkmale des nachbiblischen Judentums sowie der einstigen jüdischen Jesusgemeinschaft, nicht aber der heidenchristlichen Kirche und ihrer Lehre.
Franziskus: zwei gleichwertige Wege zu Gott
Papst Franziskus hat von zwei gleichwertigen Wegen zu Gott gesprochen, dem der Tora und dem des Christus. Das Dokument zitiert ihn (Nr. 24) und widerspricht ihm (Nr. 25,35 u. 37). Franziskus sah etwas, was das Dokument nicht fand, weil es dem heidenchristlichen Unverständnis des Judentums folgt: Diese beiden Wege sind Wege innerhalb des Judentums. Das bedeutet: Ein sogenannter Heilsplan Gottes liegt wohl anders - oder eigentlich war er nie anders als so: Am Ende werden alle auf dem Zion Ihn, den Einzigen, bekennen. Jesu Rolle ist damit klar umrissen. Durch ihn werden die ehemaligen Heiden in den Glauben des biblischen und des nachbiblischen Judentums eingeladen; sie reden nicht mehr in heidnischer Logik von Vollendung und Exklusivität, sondern sind eucharistisch - dankbar -geworden: dankbar für den Mann aus Nazareth, der ihnen die Tradition und den Glauben Israels vermittelt. Das genügt und wäre Resultat eines echten christlichen Lernens vom Judentum aller Zeiten und vom Juden Jesus.
Nach der Lektüre des Dokuments scheint der Weg zu echter christlicher Umkehr durch den Dialog noch sehr weit zu sein.
Der Autor ist Prof. für Fundamentaltheologie an der Kath.-Theol. Fakultät d. Uni Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!