Die Christentumsgeschichte liest sich von früh weg als Emanzipation von jüdischen Wurzeln. Aber heute müsste klar sein: Christentum ist ohne klaren Bezug aufs Judentum nicht denkbar.
Zum 14. Mal wird heuer der Tag des Judentums begangen. Im Vorjahr sagte der Präsident des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der katholische Theologe Martin Jäggle: "Was das Judentum für den christlichen Glauben bedeutet, ist noch lange nicht erschöpfend formuliert.“ Die Notwendigkeit einer solchen Neuformulierung des Christentums - einer echten Re-Form - ergibt sich von selbst: Denn das Christentum ist die einzige monotheistische Religion, die ihre Herkunft direkt, unmittelbar und ausschließlich dem damaligen Judentum verdankt. Und sein Weg durch die Geschichte lief spätestens ab dem 4. Jahrhundert in massiver Abkehr von eben dieser seiner Herkunft, die der jüdische Dichter Franz Werfel im Jahr 1944 deutlicher als die damalige Theologie und das Lehramt niedergeschrieben hat: "Jesus wurde nicht aus Griechen oder Indern geboren, sondern aus Juden. Es handelt sich hiebei … um Konformität und Konspiritualität.“ Gleiche Form, gleicher Geist - eine Ansage, die dem christlichen Empfinden und Nachdenken in diesen Tagen direkt widersprach, nachdem etwa der Dogmatiker Michael Schmaus im Jahr 1933 Christus als den Gott gefunden hatte, der den deutschen Menschen zur Opferbereitschaft formt, und Papst Pius XII. in der Weihnachtsansprache vor den Kardinälen 1942 davon gesprochen hatte, dass Jerusalem der Einladung Christi "mit starrer Verblendung und hartnäckiger Verleugnung entgegentrat, die es auf dem Wege der Schuld bis hin zum Gottesmord geführt hat“.
Verhängnisse bis hin zur Schoa
Die Geschichte des Christentums liest sich von früh weg, nachdem die judenchristlichen Gemeinden rasch an Bedeutung verloren haben, als eine Geschichte der Emanzipation von den jüdischen Wurzeln. In Verbindung mit teils recht durchsichtigen Machtinteressen wurden Dogmen formuliert, denen man den Bezug zum Juden aus Nazareth und den ersten formativen Elementen des Christentums manchmal kaum noch ansah. Sie dienten, was die historische Forschung von jüdischer Seite aus profund nachgewiesen hat, der bewussten Abgrenzung gegen das Judentum und der Installation eines verhängnisvollen Prinzips: das der Beerbung jüdischer Traditionen und damit der Abschaffung jüdischer Geltungen nach Jesus Christus - Christentum als Vollendung der Vorgeschichte, die das Judentum war. Das gab Wege frei für eine Unzahl von Pogromen gegen Juden, jüdischen Gemeinschaften und Gemeinden im Namen christlicher Wahrheit bis hin zur Schoa, die in christlichen Ländern durchgeführt wurde.
Das ist das geschichtliche Erbe des dominanten Heidenchristentums, das seine Lehre ohne und mitunter direkt gegen das Judentum formulierte und das Dogma über die Heilige Schrift stellte. Das Zweite Vatikanische Konzil hat zwar darauf aufmerksam gemacht, dass die Heilige Schrift Fundament aller Lehre sei und Antisemitismus (und mit ihm theologischer Antijudaismus) keine christliche Option sein dürfen; doch das, was heute wieder sichtbar ist an Überbietungsrhetorik, weist auf ein hermeneutisches Prinzip, das diese Ansage des Konzils relativiert: Man könne die Schrift nur durchs Dogma richtig lesen und richtig verstehen.
In solchen Wendungen kündigt sich das Ende eines ernsthaften Dialogs mit dem Judentum an, weil er an die Substanz gehen könnte. Statt der Umkehr werden Kontinuität und Treue betont, ohne die in der Geschichte nachweisbaren Folgen solcher Kontinuität zu berücksichtigen. Genau darin wurzelt auch die steigende Kluft zwischen theologisch-dogmatischer Selbstbehauptung des Christentums einerseits und Lebens- und Denkweisen andererseits, die vom Judentum lernen wollen, um besonders das Zentrum des christlichen Glaubens besser zu verstehen. Vom Judentum lernen, heißt: den Sinn und die Gefährlichkeit von Wandlungen in der Geschichte zu bedenken und zu erkennen; nicht den Sieger zu mimen, wo noch lange nichts gewonnen ist, sondern von unten, de profundis (Ps 130), beten und hoffen zu lernen auf den erlösenden Gott; nicht der Logik eines Christusdenkens zu folgen, die sich weithin aus sich selbst abstützt, sondern den Nazarener zu suchen, ohne den Christentum niemals wirklich geworden wäre.
Beim Judentum in die Schule gehen
So würde in der Lehre ein anderes Licht aufleuchten, triebe man wirklich unbegrenzten, das heißt, wahrhaften Dialog und ginge man beim Judentum in die Schule. Drei Beispiele dafür:
• Das Judentum hat seit jeher zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen der Menschen eine unüberbrückbare Trennlinie gezogen. Das war auch für Jesus verbindlich. Wer diese Basis Jesu Christi und Israels ernst nimmt, die genauso im Judenchristentum gegolten hat, findet in Jesus den Gott Israels und in ihm daher die Unterscheidung von Mensch und Gott so radikal wie im biblischen Zeugnis. Der eine starb und wurde erweckt, der andere ist ewig und deshalb allein die Hoffnung der Lebenden und der Toten. So klar und einfach ist das.
• Jesus war und ist als Messias aus Davids Haus, der endgültig Friede bringen wird, ein fundamentales Problem. Denn Gewalt wurde durch Jesus nicht beendet. Israel wurde nicht befreit. Der Weltfriede ist bis heute zerstört. Und was ist aus dem Zeitenende geworden? Die messianische Hoffnung spirituell ins Innere zu verlegen - als meine Rettung aus dem Tod -, kapituliert vor der schwierigen Messianität und schafft sie ab. Denn für die Totenerweckung braucht es keinen Messias. Dagegen sind die im Rabbinischen Judentum verbürgten Motive eines Leidensmessias völlig unausgeschöpft.
• Jesus lebte aus den Reinheitsgesetzen der Thora. Diese verboten jede Form von Blutgenuss. Es gibt eine alte judenchristliche Überlieferung, die Didache, die diese Reinheitsgesetze auch der Deutung der Eucharistie einschrieb. Da ist gerade nicht vom Bluttrinken die Rede, was jüdisch strengstens untersagt ist, sondern da wird Gott für den Messias gepriesen: Er ist der heilige Weinstock aus König Davids Geschlecht. Kein Blutritus, keine Transsubstantiation - und doch ganz unmittelbar Eucharistie als Dank an den Ewigen für den Messias.
Der Theologie fehlen die richtigen Bestecke
Tag des Judentums - Tag der Hin- und Umkehr zu einem aufrichtigen Dialog mit dem Judentum in seinen vielen Varianten. Die Erneuerung des Christentums nach seiner mehr als 1500-jährigen griechisch-philosophischen Tradition kommt aus Israel. Was das bedeutet, ist tatsächlich noch lange nicht ausgeschöpft. Wahrscheinlich haben Theologie und Lehramt noch nicht einmal die richtigen Bestecke, um schöpfen zu können. Sie wären geschmiedet durch eine vorbehaltlose Zuneigung zu 4000 Jahren jüdischer Geschichte und Gegenwart - auch um Jesu Christi willen. Und sie wären gebildet von einem Gelübde, das mehr als 2500 Jahre alt ist und auch von Jesus gesprochen wurde: Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe (Ps 137,5f). Wenn ich Jerusalem vergäße, würde ich aufhören, theologisch zu schreiben und zu reden. So einfach und klar ist das.
* Der Autor ist Professor für Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien
Zum Thema
Rund um den Tag des Judentums gibt es auch Folgeveranstaltungen. Am 24. Jänner referiert der Dogmatiker Josef Wohlmuth, Bonn, zum Offenbarungsereignis in geschichtlicher Vermittlung“ (Wien, Inst. f. Ethik u. Recht in der Medizin, 18.30). Am 30. Jänner diskutieren Wolfgang Treitler (s. Artikel oben) und Rabbiner Schlomo Hofmeister über den "Jüdischen Jesus“ (Pfarre St. Nepomuk, Wien II., 19.30 Uhr). Infos unter:
Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit
www.christenundjuden.org
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!







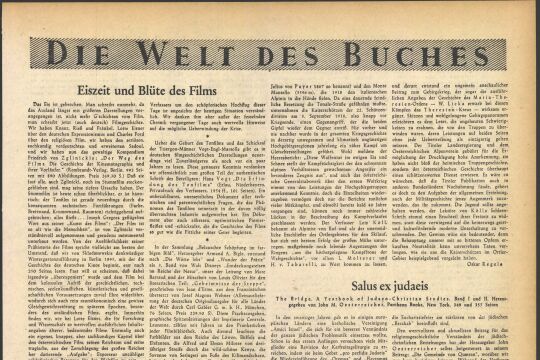




































.jpg)















































