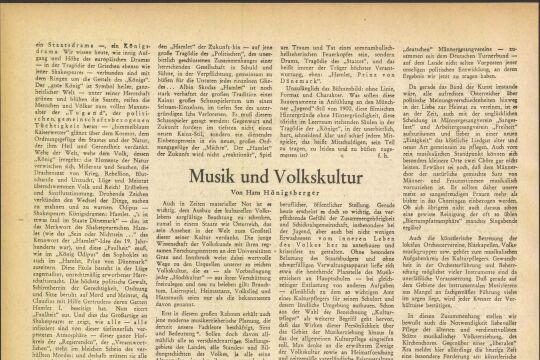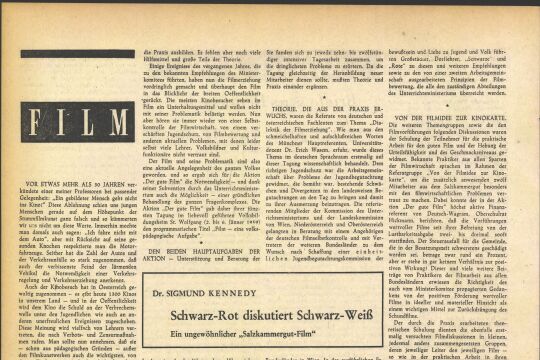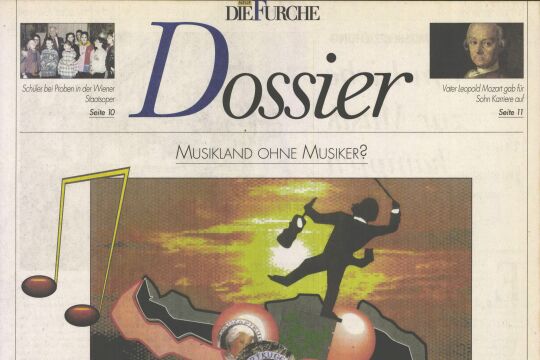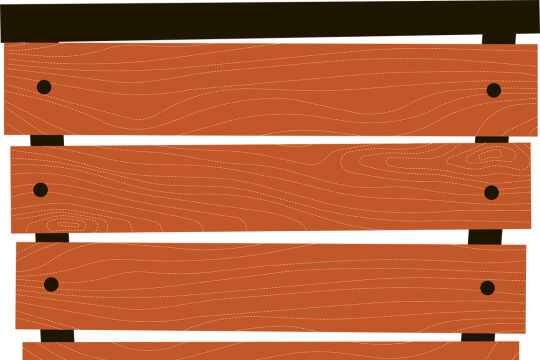Alarm im klingenden Österreich
Harald Huber, Präsident des Österreichischen Musikrates, über die Gründe seines "Musikalarms", die guten Seiten von Castingshows - und die schlechten der Klassik.
Harald Huber, Präsident des Österreichischen Musikrates, über die Gründe seines "Musikalarms", die guten Seiten von Castingshows - und die schlechten der Klassik.
Eigentlich liegt das kleine Büro von Harald Huber im Keller. Doch für das Foto hat sich der Mitbegründer und -leiter des Instituts für Popularmusik ("ipop") an der Wiener Musikuniversität in den schönsten Saal des Palais Rothschild in der Metternichgasse 8 begeben. Auf einem Bösendorfer-Flügel beginnt er zu improvisieren und spielt anschließend ein selbst komponiertes, eher melancholisches Stück, das von einer Reise zum sizilianischen Vulkan Stromboli inspiriert ist. Als Präsident des Österreichischen Musikrates machen Huber jedoch eher die Einsparungen im Musikbereich nachdenklich. Im Interview erklärt er, warum er den "Musikalarm #1" initiiert hat (vgl. www.oemr.at) - und ob die Rede vom "klingenden Österreich" tatsächlich stimmt.
DIE FURCHE: Herr Professor Huber, wie populär ist es heute eigentlich noch, selbst zu musizieren?
Harald Huber: Das Musizieren hat sich verlagert und verbreitert. Das, was man unter "Hausmusik" versteht, ist zwar rückläufig, aber keineswegs verschwunden - dank der Erfolgsgeschichte der österreichischen Musikschulen. Zugleich wird heute in den verschiedensten Genres musiziert. Die Befürchtung, dass der Medienkonsum die Eigentätigkeit zum Erliegen bringen würde, hat sich also nicht bewahrheitet. Gerade die medialen Vorbilder oder auch diese Wettbewerbe können dazu anregen, selbst zu musizieren und zu singen.
DIE FURCHE: Meinen Sie damit auch Casting-Shows wie "Die große Chance" des ORF?
Huber: Ja, wobei diese Shows gleichzeitig das Problem haben, dass sie unerfüllbare Erwartungen erzeugen und dann mitunter fahrlässig mit diesen Erwartungen umgehen. Aber interessant ist, dass gerade bei der letzten Staffel der "Großen Chance" zwei Tiroler Mädchen mit Harfe und Geige gewonnen haben - also Vertreterinnen klassischer Hausmusik.
DIE FURCHE: Landläufig geht man davon aus, dass vor allem Kinder bildungsaffiner Mittelklassefamilien überhaupt die "große Chance" bekommen, ein Instrument zu lernen. Entspricht das der Realität?
Huber: Zum Teil. Durch den Ausbau der Musikschulen und anderer Musikvermittlungskonzepte haben heute aber auch Bevölkerungsschichten Zugang zum Instrumentenlernen, die ihn früher nicht hatten. Außerdem gibt es ja noch das autodidaktische Musizieren: dass etwa junge Leute in einem Proberaum ein Bandprojekt starten, sich als DJ versuchen oder die Optionen der Computertechnologie nutzen. Die Vielfalt ist groß.
DIE FURCHE: Sie wird aber finanziell nicht besonders gefördert, wie Sie im aktuellen "Austrian Report on Musical Diversity" kritisieren
Huber: Bei der Förderung und in der Außendarstellung gilt Österreich nach wie vor als Klassikland. Zugleich haben wir in den Medien und am Markt eine Dominanz internationaler Popmusik. Was dazwischen zu kurz kommt, ist das zeitgenössische Musikschaffen - von der neuen Musik über die Jazz-Szene bis zu österreichischem Rock und Pop oder der "World-Music". Hier muss es bei den Förderungen dringend ein Umdenken geben: Der Österreichische Musikfonds, mit dem Produktionen gefördert werden, verfügt gerade einmal über 800.000 Euro jährlich. Sehr viele sehr gute Projekte müssen abgelehnt werden. Damit dieses Aushungern aufhört, fordern wir auch endlich eine Speichermedienabgabe. Doch unsere Versuche, die Politik für die Situation der Musikbranche zu interessieren, waren bisher erfolglos.
DIE FURCHE: Sie haben unlängst sogar "Musikalarm" ausgelöst -u. a. mit der Konferenz der Musikschulwerke, der Blasmusikjugend und den Fachinspektoren für Musik. Was genau alarmiert Sie?
Huber: In erster Linie, dass bei den geplanten, neuen Curricula für die Ausbildung der Volksschullehrerinnen und -lehrer an vielen Pädagogischen Hochschulen der Anteil der Musikausbildung drastisch zurückgefahren wird; an der PH Wien etwa von zwölf Pflicht-Semesterwochenstunden auf 5,5. Besonders betroffen ist hier der Instrumentalunterricht, in dem angehende Volksschullehrerinnen etwa lernen, ein Lied mit einer Flöte, Gitarre oder dem Klavier zu begleiten. Das ist aber eine Schlüsselqualifikation, um Kinder zum Musizieren und Singen zu motivieren! So wie es aussieht, gibt es hier auch keinen Einzelunterricht mehr. Da läuten die Alarmglocken!
DIE FURCHE: Drastisch zurückgefahren werden auch die Förderungen der Musikwettbewerbe
Huber: Richtig. Sowohl das "Bundesjugendsingen" wie auch die Wettbewerbe "prima la musica","gradus ad parnassum" und "podium.rock.pop.jazz" wurden entweder schon eingestellt oder können nur noch mit Hilfe der Länder überleben. Der Bund lässt hier zunehmend aus. Auch Projekte wie "Stimmbogen" oder das "Musikfest der Vielfalt" werden gekürzt oder abgeschafft. In der Ära Claudia Schmied konnten wir ausgehend von der "Musik-Enquete" 2008 noch die Plattform www.musikbildung.at aufbauen. All diese Strukturen werden nun zerstört.
DIE FURCHE: 2008 wurde auch ein Erlass verabschiedet, der die Zusammenarbeit von Musikschulen und öffentlichen Schulen ermöglicht: von der räumlichen Kooperation bis zum Team-Teaching. Angesichts von immer mehr Ganztagsschulen ein nötiger Schritt. In Wien läuft diese Kooperation unter dem Namen "Elemu" an 70 Volksschulklassen. Ihr Kommentar?
Huber: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In der Steiermark und in Salzburg hat es hingegen geheißen, dass solche Kooperationen rechtlich nicht möglich sind. Aber mit diesem Erlass haben wir Klarheit geschaffen, dass sie sowohl möglich wie auch erwünscht sind.
DIE FURCHE: In Wien gibt es dafür nur relativ wenige Musikschulplätze. Vor allem in Klavier, Gitarre und Schlagzeug gibt es kaum Chancen, unterzukommen
Huber: Das stimmt, hier gibt es Nachholbedarf. Wobei die Situation in Wien gemildert wird durch die Konservatorien und das reichhaltige private Angebot, etwa die "Johann Sebastian Bach Musikschule" der evangelischen Kirche oder auch die "Pop Akademie" im Gasometer.
DIE FURCHE: Wie sieht es an öffentlichen Schulen aus: Gibt es hier genügend Musiklehrerinnen und -lehrer?
Huber: Nein. In den Schulen der Zehn-bis 14-Jährigen haben wir häufig viel zu wenige Musiklehrer, sodass auch Kollegen mit anderen Fächern unterrichten müssen. In der Oberstufe ist die Lage ähnlich. Dem könnte man nur begegnen, indem man mehr Ausbildungsplätze schafft. Wir haben etwa an der Wiener Musikuni nur 40 Plätze für das Fach Musikerziehung - und das für ganz Ostösterreich! Dazu kommt, dass die Unis künftig bei der Ausbildung der Musiklehrer im Sekundarschulbereich mit den PHs kooperieren sollen. Doch dann müssen wir bitte auch entsprechend ausgestattet werden!
DIE FURCHE: Kommen wir von der Musik im Klassenzimmer zu jener im Konzertsaal: Viele Berufsmusiker klagen über mentale und körperliche Belastungen. Welche Unterschiede gibt es hier zwischen Popularmusik und Klassik?
Huber: Das Thema Nervosität ist in der Popularmusik nicht so groß, weil es von vornherein einen anderen Zugang gibt. Es ist ja tatsächlich angsteinflößend, sich vorzustellen: So, jetzt tritt die vollkommene Stille ein und ich muss mit Angstschweiß eine gestrenge Jury überzeugen. Dafür gibt es in der Popularmusik andere Gesundheitsgefährdungen, etwa dass man zu irgendwelchen Hilfsmitteln greift. Beim Thema Lautstärke haben wir aber das gleiche Problem. Und auch der Tourneestress ist für Profimusiker groß. Man sagt nicht umsonst, dass einem als Musiker nichts Schlimmeres passieren kann, als berühmt zu werden.
DIE FURCHE: Sie selbst treten derzeit in der Improvisations-Show "Sport vor Ort" im Wiener Theater an der Gumpendorferstraße auf - und jeden dritten Donnerstag im Monat bei einem "musikalischen Workout-Abend" im Club "Schwarzberg". Wieviel Lust bleibt da noch, privat in die Tasten zu greifen?
Huber: Sehr viel. Klavier und Komponieren sind für mich Wege, um Erlebnisse zu verarbeiten und das Leben zu reflektieren. Diese Verbindung von Intellekt und Emotion, das ist das Geniale an der Musik.
Das Gespräch führte Doris Helmberger
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!