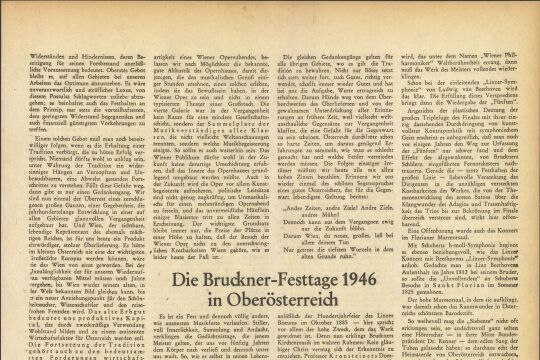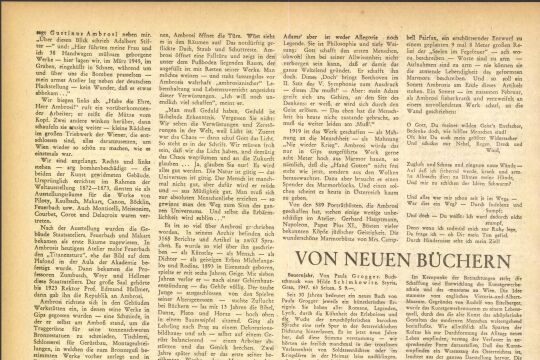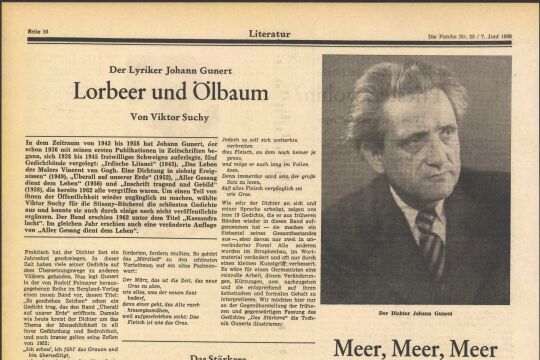Judith Schalansky: Die Ton-Künstlerin
Kleiner Schrein für Judith Schalansky. Gekürzte Fassung der Laudatio anlässlich der Verleihung des Christine Lavant Preises
Kleiner Schrein für Judith Schalansky. Gekürzte Fassung der Laudatio anlässlich der Verleihung des Christine Lavant Preises
Ein Gedicht aus dem Nachlass der Christine Lavant beginnt so:
Aus Ebenholz, aus Elfenbein,
aus Marmor und zuletzt aus Ton
versuchte ich seit langem schon
zu formen einen Schrein.
Die Trauer ist mein Ebenholz,
das glatte Elfenbein mein Leid,
den Marmor hol ich meilenweit
von meinem Mädchenstolz.
Wenn Dichterinnen einen Schrein formen, verbirgt sich darin meist eine Poetik. Ich möchte
mit Ihnen vor dem Bild des Lavant’schen Schreins dem so ganz anders gearteten Geheimnis von Judith Schalanskys Schreiben nachspüren. Es ist gleichwohl auch eines der Pretiosen, der Kostbarkeiten und Rarissima, thematisch, sprachlich und in seiner äußeren Erscheinung. Denn die gelernte Buchgestalterin und Kunsthistorikerin Schalansky ist geradezu besessen vom Stofflichen, vom Material. Sie weiß: Kunst wird aus Trauer, Leid und Stolz gemacht, augenscheinlich und handgreiflich aber eben auch aus Ebenholz, Elfenbein und Marmor.
1 Ebenholz – dunkler Glanz
Auf den Zwischenblättern, die die zwölf Kapitel von Schalanskys jüngstem Buch, dem „Verzeichnis einiger Verluste“, trennen, sind charakteristische Motive schwarz auf schwarz gedruckt. Man sieht nicht nichts, man sieht schimmernde Schemen, allerdings nur bei richtigem Lichteinfall: den Kaspischen Tiger, ausgestorben um 1970, die barocke Villa Sacchetti in Rom, endgültig abgetragen nach 1861, Otto von Guerickes Einhorn oder die Fragmente von Sapphos Gedichten. Judith Schalansky hat ein feines Gespür für die fifty shades of black.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
In diesem Buch zeigt sie sich einmal mehr als Verwandlungskünstlerin, eine jede Verlustanzeige hat ihre eigene Form – Erzählung, Essay, Portrait, innerer Monolog – und ihren eigenen Ton, von großartig-pathetisch für eine antike Tierkampfszene im Kolosseum bis verzweifeltschnoddrig für eine Suada der nicht mehr jungen Greta Garbo auf ihrem Gang durch Manhattan. Die Grundierung dieser Literatur ist freilich tiefschwarz, ist seit Schalanskys Erstling „Blau steht dir nicht“ durchtränkt von der Trauer um Verlorenes, ob sie nun die DDR-Kindheit der kleinen Jenny rekapituliert oder in ihrem „Bildungsroman“ „Der Hals der Giraffe“ die Biologielehrerin Inge Lohmark dem realsozialistischen Schulwesen nachtrauern lässt.
„Am Leben zu sein bedeutet, Verluste zu erfahren“, heißt es weise im Vorwort zum „Verzeichnis einiger Verluste“. Das schließt Humor und Heiterkeit nicht aus. Und doch ist jede Zeile ihres Werkes ein Aufbegehren gegen den Lauf der Dinge, ein furioses Anschreiben gegen das Unabwendbare, mit Engelszungen, mit schauriger Genauigkeit, mit dunklem Glanz und Eleganz: „Nichts kann im Schreiben zurückgeholt, aber alles erfahrbar werden.“ Zum Beispiel das Ende Napoleons, der neunzehn Jahre nach seinem Tod auf St. Helena exhumiert und nach Paris zurückgeholt wird, wie wir in Schalanskys bereits legendärem „Atlas der abgelegenen Inseln“ erfahren. Einer seiner vier Särge war aus Ebenholz. Ebenholz schützt gegen böse Geister, Zauberstäbe aus Ebenholz verzaubern besonders zuverlässig. Wie Judith Schalanskys Prosa.
2 Elfenbein – better than life
Das angebliche Skelett eines Einhorns, das man 1663 in Quedlinburg entdeckte, war eine Bastelarbeit (aber nicht des Physikers Otto von Guericke), zusammengesetzt aus eiszeitlichen Knochen von Mammut und Wollnashorn, vielleicht war auch der Stoßzahn eines Narwals mit im Spiel, Elfenbein, „von der Natur gedrechseltes Kalziumphosphat“. „Guerickes Einhorn“ heißt das Kapitel im „Verzeichnis“, in dem die Autorin ihre prinzipielle Auseinandersetzung mit Fabelwesen und Wunderglauben raffiniert hinter einer autobiographisch verbrämten Gruselgeschichte versteckt: Eine Schriftstellerin zieht sich in die Berge zurück, um dort einen „Naturführer der Monster“ zu schreiben, muss jedoch einerseits erkennen, dass der Einfallsreichtum der Evolution jede Phantasiegeburt übertrifft, und andererseits, dass das Unheimliche sich nicht domestizieren lässt. Das unsterbliche Einhorn übersteht sozusagen seine Dekonstruktion und rückt der Erzählerin zu Leibe: „Gegen den Mythos konnte man nur verlieren.“
Stoßzahn und Horn sind als Symbole schon aufdringlich phallisch, jedenfalls übt das Elfenbein auch den Reiz des Exotischen aus. Der „Atlas der abgelegenen Inseln“ hat den Untertitel: „Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde“. Seine Flagge auf einem Fleckchen Erde aufzupflanzen scheint nach wie vor ein männliches Geschäft. Robinson Crusoes Prinzip der Herrschaft durch Ordnung und Organisation ist dieser Autorin aber nicht fremd. Und zugleich rebelliert sie gegen die Anmaßung, die darin steckt.
Schalanskys nimmersatte Neugier, ihr Wissensdurst, ihre Entdeckerfreude gilt der Welt als dem ‚unüberschaubaren Archiv ihrer selbst‘.
Der Elfenbeinturm als vornehmes Refugium für Geistesmenschen, als eremitisches Gehäus erscheint dennoch durchaus passend als Wohnort für Judith Schalansky, das bedeutet freilich keinen Rückzug nach innen. Schalanskys nimmersatte Neugier, ihr Wissensdurst, ihre Entdeckerfreude gilt der Welt als dem „unüberschaubaren Archiv ihrer selbst“. Ihr Schreiben ist viel eher literarische Forschungsarbeit denn Schöpfung, jedenfalls keine Creatio ex nihilo, es braucht den Anhaltspunkt im Rea len, um den Faden zu spinnen. Schon in „Blau steht dir nicht“ finden wir die Überblendung des autobiographischen Kerns mit einem Netz aus Geschichten, Portraits, Fotos, Recherchen, von der Geburtsstadt Greifswald bis zur ermordeten Zarenfamilie; alles ist da schon drin, das Walskelett, der Atlas, die Insel, die Ruine.
3 Marmor – perfekte Kühle
Weißer Marmor umrahmte die Fassade des Ostberliner Palasts der Republik, abgerissen im Jahr 2006. Bei Judith Schalansky erscheint der Stein der Denkmäler, der edle Baustoff der Ewigkeit, immer schon als Abbruchmaterial. In „Palast der Republik“ erzählt sie eine sehr private Geschichte von Liebe und Betrug, das Denken in Vorläufigkeiten umfasst auch den Bestand der Familie.
„Schön sind nur Dinge, die uns nichts angehen“, meinte Oscar Wilde. In der Kühle des Marmors verbirgt sich jene Schönheit, die nicht nur erotisches Verlangen in Gang setzt, sondern auch einen Anspruch auf Vollkommenheit erhebt, der Distanz herstellt und in der Kunst der Moderne in Verruf geraten ist. Bei Judith Schalansky ist er rehabilitiert. Das Monumentale verspricht allemal Ordnung und Struktur: Judith Schalansky liebt das ausgeklügelte Spiel mit der Zahl, programmatisch gewinnt sie dichterische Freiheit aus der Beschränkung der Form. Sie ist eine Perfektionistin, die der Perfektion misstraut. Wo Grenzen verwischt und Identitäten diffus werden, bröckelt indes unser marmornes Selbstbild, und das ist nicht ungefährlich: Im ironisch schillernden „Bildungsroman“ „Der Hals der Giraffe“ durchschaut die Lehrerin Lohmark zwar die Slogans der nach 1989 demokratisch gewendeten Schulleitung: „Das kannte sie. Kritisches Denken war immer erlaubt. Nur linientreu musste es sein.“ Aber als die Versteinerung in ihrer eigenen Brust sich zu lösen beginnt, gerät die Anhängerin Darwins und einer tiefschwarzen Pädagogik der Distanz aus dem Tritt.
4 Ton – Puls der Passion
In ihrem Gedicht über den vergeblich versuchten Schrein kommt Christine Lavant zu dem Schluss, die „drei Dinge“ stünden wie Särge „um mich her“:
Der braune Ton,
mein warmes Blut,
erschien mir lange viel zu schlicht,
doch meinem Götzlein dünkt
dies nicht,
es fühlt sich darin gut.

Daniela Strigl
Die Autorin ist Germanistin und Literaturkritikerin.
Die Autorin ist Germanistin und Literaturkritikerin.
Was kann das für ein „Götzlein“ sein, das sich im schlichten Tongefäß eher zu Hause fühlt denn im kostbaren Schatzkästlein? Es besitzt offenbar die Gabe poetischer Befeuerung. Die Antwort ist so leicht wie naheliegend: Eros, der göttliche Knabe, tritt hier seine Herrschaft an.
Irdische Fragen und irdene Formen finden sich auch in Schalanskys Werk, in den schlicht autobiographischen Geschichten im „Verzeichnis einiger Verluste“ etwa; und Inge Lohmark darf, muss auf ihre alten Tage etwas über die Liebe lernen. „Was war das schon, Liebe?“, dachte sie einst. „Ein scheinbar wasserdichtes Alibi für kranke Symbiosen.“ Dann verliebt sie sich ohne jeden biologischen Zweck in eine Schülerin – und alles ist anders.
Zwar hat Judith Schalansky keine Liebesgedichte geschrieben, doch sie hat „Sapphos Liebesliedern“ einen fulminanten Eintrag im „Verzeichnis“ gewidmet. Von Sapphos Fragment über die gliederlösende Macht des Eros gelangt sie zum Faszinosum der Auslassung und zur an Skurrilem nicht armen Geschichte der lesbischen Liebe.
Von der Macht des Eros zeugt auch die Leidenschaft, mit der Schalansky die Grenzen zwischen den Genres und Gattungen ignoriert, mit der sie die vielen prächtigen Bände der „Naturkunden“ herausgibt, mit der sie, „maßlos und vergeblich“, an der Idee des einen Buches festhält, „in dem alles steht, was man wissen muss“. Dass sie ihr Publikum unterschätzt, wie so viele, die heute in Feuilleton, Funk und Fernsehen das Sagen haben, kann man ihr nicht vorwerfen. Leidenschaft wirkt ansteckend: Deshalb hat Judith Schalansky nicht nur zahlreiche Preise bekommen, sondern auch veritable Bestseller produziert.
Man darf ihr wünschen, dass in ihrer literarischen Wunderkammer Lavants Götzlein auch weiterhin seinen Platz im Tonkrug hat und sich darin gut fühlt.
Christine Lavant Preis 2020
Die Preisverleihung hat am 11. Oktober im ORF RadioKulturhaus stattgefunden.
Die ganze Rede gibt es hier.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!