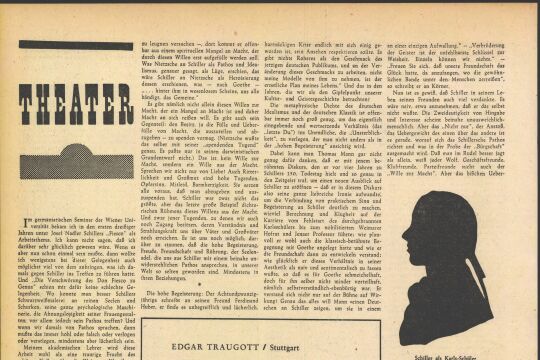Dem „Zauber des Schönen“ widmete sich heuer das schon traditionelle Philosophicum Lech. In der von griechischem Denken und jüdisch-christlicher Religion geprägten europäischen Tradition galt lange die Trias von Schönem, Wahrem und Gutem als eine leitende Idee. Doch lässt sich davon heute noch sprechen?
„ Ach, dass ich dich so spät erkannte, / du hochgelobte Schönheit du, / dass ich nicht eher mein dich nannte, / du höchstes Gut, du wahre Ruh; / es ist mir leid, ich bin betrübt, / dass ich so spät geliebt. “
Als diese Zeilen des christlichen Mystikers Angelus Silesius (17. Jh.) in der Neuen Kirche von Lech zitiert wurden, war das diesjährige Philosophicum über den „Zauber des Schönen“ schon fast an sein Ende gekommen. Nicht weil jemand den angestammten Bereich der Philosophie verlassen und ins Theologische gekippt oder das Symposium schlussendlich fromm-religiös überhöht worden wäre. Nein, der Salzburger Benediktinerpater Michael Köck, selbst Teilnehmer des Philosophicums, stellte die Worte an den Anfang des von ihm geleiteten Sonntagsgottesdienstes, um auch für die Lecherinnen und Lecher eine Brücke zum Thema der Tagung zu schlagen.
Nun ist seit einigen Jahren die Neue Kirche als größter Raum des Ortes zwar Schauplatz des Philosophicums, die Sonntagsmesse aber freilich kein integraler Bestandteil desselben – nur wenige der Referenten und Zuhörer verirren sich dorthin. Gleichwohl fügte sich der Text des „Schlesischen Boten“ (angelus silesius; eig. Johannes Scheffler) in den großen Bogen dieser Tage gut ein, indem er eine Perspektive markierte, die zwar keine genuin philosophische sein kann, für die philosophisches Denken aber prinzipiell offen ist. Scheffler bezieht sich hier auf die „Confessiones“ des Augustinus (4./5. Jh.), in denen dieser die große Bekehrung seines Lebens, seine späte Hinwendung zu Gott reflektiert: „Spät habe ich dich geliebt, du uralte und doch so neue Schönheit“, heißt es dort („Confessiones“ X/27). Gott wird als vollkommene, wahrhaft zeitlose Schönheit vorgestellt. Alle irdische Schönheit erscheint demgegenüber nur als Abglanz des Ewigen.
Lifestyle statt Lebensführung
Wo dem Menschen diese Perspektive abhanden gekommen ist, strebt er selbst nach perfekter Schönheit: des eigenen Körpers, seines Lebensraumes, seiner Berufs- und Freizeitwelt. Fragen der Lebensführung mutieren zu solchen des lifestyles, das eigene Ego will auf Hochglanz poliert werden. Um die Auswüchse dessen zu kritisieren, muss man freilich nicht gläubig sein: Der Frankfurter Philosophieprofessor Martin Seel, einer der Referenten in Lech, spricht im FURCHE-Interview (siehe S. 22/23) von einem „ganz verengten, bloß schematischen Schönheitsbegriff“, der dem zeitgeistigen Körperkult zugrunde liege; und er postuliert: „Ein gutes Leben besteht auch darin, dass man fähig ist, sich und einen Teil der Welt – nicht alles – zu lassen, wie es ist.“
Paminas Wahrheit in C-Dur
Verengt ist ein solcher, rein äußerlicher Schönheitsbegriff auch, weil er den Zusammenhang zwischen Schönem, Gutem und Wahrem außer Acht lässt. Dieser versteht sich in einer säkularen, pluralistischen Gesellschaft nicht mehr von selbst, geschweige denn, dass es ein Deutungsmonopol dafür gäbe. Deswegen aber ist die innere Beziehung zwischen diesen drei Begriffen, ihre Aufeinander-Verwiesenheit noch nicht obsolet. Was viele freilich gerne hätten, gilt ihnen doch der Gedanke, dass Schönheit mit Gutsein und Wahrheit etwas zu tun haben, bestenfalls als antiquierte intellektuelle Zumutung, schlimmstenfalls als Ausdruck latent faschistoider Gesinnung.
Wie so oft, kann auch hier die Kunst manches besser verdeutlichen, als bloße Theorie: „Mein Kind, was werden wir wohl sprechen?“, ruft Papageno, die Hose gestrichen voll angesichts des nahenden Sarastro. – „Die Wahrheit, wär’ sie auch Verbrechen“, antwortet Pamina mit der größten Selbstverständlichkeit. Eben diese Selbst-Verständlichkeit, dieses Sich-von-selbst-Verstehen der Wahrheit drückt Mozart, ganz selbstverständlich, in klarem C-Dur aus. Kann, wer diese paar Takte hört, daran zweifeln, dass schön, wahr und gut zusammengehören? Das ist unverfälschte, echte Schönheit, die aus dem Inneren kommt und immer auch zumindest eine Ahnung des Guten und Wahr(haftig)en vermittelt. An solcher Schönheit aber prallt der Vorwurf der billigen Harmonisierung, des Verwischens von Bruchlinien, der Verdrängung gar, ab. Sie ist – was viele von der Kunst zurecht einfordern – gerade in ihrer Klarheit verstörend.
Damit ist freilich die Dissonanz, das Hässliche nicht ausgeschlossen. Kritikern, die sich an den schrägen Klängen seiner „Elektra“ stießen, hielt Richard Strauss in seiner bajuwarisch-deftigen Art entgegen: „Wann der Sohn auf der Bühne die Mutter derschlagt, kann i im Orchester ka Violinkonzert spün …“ Im Übrigen werden auch Konsonanzen nicht zwingend als „schön“ empfunden: Es gibt kaum Beklemmenderes in der Musik des 20. Jahrhunderts als das gleißend-kalte, hämmernde C-Dur am Ende der „Elektra“ – oder das zweimalige, vom leisesten Piano zum mehrfachen Forte anschwellende, bis zum Zerreißen gespannte „H“ nach der Ermordung Maries in Alban Bergs „Wozzeck“. Dort aber, wo das Widerständige, Schräge, Abstoßende zum Selbstzweck wird, verfehlt es seine Möglichkeiten. Es bewirkt, wie auch die Rezeptionsgeschichte moderner Kunst- und Ausdrucksformen teilweise zeigt, jene Abstumpfung, gegen die es sich wendet, jene Routine, aus der es vorgeblich aufrütteln möchte.
„Ich will deinen Mund küssen, Jochanaan“
Nun ist aber das Schöne nicht nur Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung, sondern auch Objekt der Begierde und Leidenschaft. Interessanterweise ist etwas von dieser erotischen Dynamik gerade in den alten Texten der Mystiker (wie dem eingangs zitierten) deutlicher spürbar als in so mancher kunsttheoretischen Abhandlung. Hier geht es nicht um bloße Ästhetik, hier haben wir es mit der Kehrseite der Schönheit, mit ihren Abgründen zu tun. „Reiz, Begehren und Zerstörung“ lautete denn auch der Untertitel des Philosophicums. Alles Unglück der Welt rühre daher, meinte Blaise Pascal (17. Jh.), dass die Menschen nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Aber das Schöne, auch das Gute und Wahre, lässt sich eben nicht ruhig im Zimmer sitzend erfahren, es treibt den Menschen an und um, es will begehrt, erstritten werden – im äußersten, schlimmsten Fall mit destruktiven Konsequenzen.
Auch für den Zusammenhang von Schönheit, Begehren und Zerstörung bietet das Musiktheater ein drastisches Beispiel: die neutestamentliche Geschichte des Teenagers Salome in der Fassung von Strauss/Wilde: Erst beim abgeschlagenen Kopf des Jochanaan (Johannes der Täufer) kann Salome tun, was ihr der lebende, von ihr rasend begehrte, Gottesmann empört verwehrte: seinen Mund küssen:
„Ich habe ihn geküsst, deinen Mund, / es war ein bitterer Geschmack auf deinen Lippen. / Hat es nach Blut geschmeckt? / Nein? Doch es schmeckte vielleicht nach Liebe. / Sie sagen, dass die Liebe bitter schmecke. / Allein was tut’s? Was tut’s? / Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan. / Ich habe ihn geküsst, deinen Mund.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!