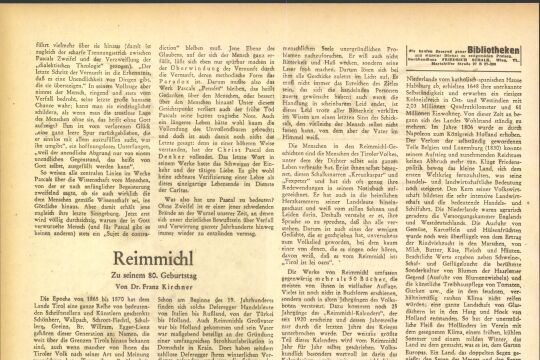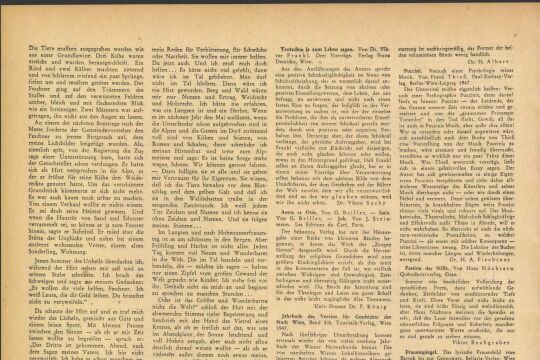Individuum, Geschichte und Literatur im Spiegel der Autobiografie.
Tagebücher, Briefe und Autobiografien sind individuelle, historische und literarische Dokumente. Hier berührt sich der Schreibimpuls eines jeden Menschen mit dem von Schriftstellern und Personen von historischer Bedeutung. Wenn ein Mensch sein Leben erzählt, erzählt er nicht nur von sich selbst, sondern immer auch ein Stück Geschichte. Der Wiener Sozialhistoriker Michael Mitterauer hat deshalb an seinem Institut weit über 1.000 Lebensgeschichten gesammelt. Einige davon sind in der Buchreihe "Damit es nicht verloren geht" erschienen. Ihr Erfolg hat ebenso wie Anna Wimschneiders Buch "Herbstmilch" und der anschließende Film bewiesen, dass uns die Lebensgeschichte eines einfachen, unbekannten Menschen zu faszinieren vermag; und vielleicht kann sie am ehesten die Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte auslösen.
Allzu lange hielt man nur das Leben berühmter Politiker, Künstler oder Wissenschaftler für interessant. Aber gerade die Autobiografie berühmter Persönlichkeiten ist oft ein Mittel der Selbststilisierung und Selbstinszenierung. Für sie gilt Kurt Tucholskys Satz wohl am meisten: "Wer eine Autobiographie schreibt, hat etwas zu verbergen." Oder er will sich rechtfertigen. Auf jeden Fall hat er etwas zu verlieren. Carl Djerassi, der Erfinder der Anti-Baby-Pille, weiß, was es heißt, als bekannte Persönlichkeit mit einer Autobiografie an die Öffentlichkeit zu treten: "Nicht nur meine Autobiografie ist der Versuch, dem Publikum ein bestimmtes Bild zu zeigen. Und wenn Sie nicht ein totaler Masochist sind, wollen Sie doch dem Publikum ein relativ gutes Bild zeigen. Auch wenn Sie das nicht wirklich wissen, haben Sie psychologische Filter, die einfach nicht alles erlauben." Für Djerassi ist Autobiographie ein Stück weit auch Automythologie. Djerassi, dessen Autobiografie auf deutsch den Titel "Die Mutter der Pille" trägt, wurde in Bulgarien geboren, ist in Wien aufgewachsen und musste vor dem Faschismus nach Amerika emigrieren. Dass er seine Frau 1988 zu einem Kongress nach Österreich begleitete und so auf den Tag genau 50 Jahre nach seiner Emigration zum ersten Mal wieder in die alte Heimat kam, war der Auslöser, eine Autobiografie zu schreiben.
Autobiografie oder Roman
Für Künstler war und ist das eigene Leben immer ein wichtiger Stoff. Wenn Schriftsteller ihre Lebensgeschichte literarisch gestalten, muss man genau hinsehen: Ist es eine Autobiografie oder ein autobiografischer Roman? Nicht immer ist dieser Unterschied so eindeutig; als "Autofiktionen" hat der Prosaautor George-Arthur Goldschmidt seine Texte einmal selbst bezeichnet. Der aus Serbien stammende österreichische Autor Ivan Ivanji hat die eigenen KZ-Erfahrungen in dem Buch "Schattenspringen" verarbeitet. Ist es eine Autobiografie oder ein Roman? Ivanji antwortet: "Die Grenze ist schwierig. Für mich soll es ein Roman sein, vom Leser her gesehen unbedingt ein Roman. Aber weil ich mir der Schwierigkeit bewusst bin, kommt es in diesem Buch einige Male vor, dass der Autor aus der dritten Person wie durch einen Fehler in die erste Person verfällt.
Kindheit und Jugend
Erste oder dritte Person, er oder ich: Zwischen beiden Ebenen pendelt Thomas Bernhards "Ursache", das erste seiner fünf autobiografischen Bücher, hin und her. Denn der, der sich erinnert, ist ein anderer geworden als der, der das Erinnerte erlebt hat: "An dieser Stelle muß ich wieder sagen, daß ich notiere oder auch nur skizziere und nur andeute, wie ich damals empfunden habe, nicht wie ich heute denke, denn die Empfindung von damals ist eine andere gewesen als mein Denken heute, und die Schwierigkeit ist, in diesen Notizen und Andeutungen die Empfindung von damals und das Denken von heute zu Notizen und Andeutungen zu machen, die den Tatsachen von damals, meiner Erfahrung als Zögling damals entsprechen, wenn auch wahrscheinlich nicht gerecht werden, jedenfalls will ich den Versuch machen."
Kindheit und Jugend nehmen in jeder Autobiografie den wichtigsten Platz ein; manche Lebenserinnerungen beschränken sich auf sie. Die Rückkehr zur Jugend, zu den eigenen Wurzeln, ist nicht immer ein erfreuliches Unternehmen. Es gibt auch den Wunsch, die bisherige Lebensgeschichte zu widerrufen und aus dem Kerker des eigenen Ich aufzubrechen. Thomas Bernhards letzter Roman "Auslöschung" handelt davon. Der Salzburger Germanist Hans Höller interpretiert ihn als "Antiautobiografie". Denn die Kontinuität des Ich und des Lebens sind die meist unhinterfragte Voraussetzung einer Autobiografie, gegen die Murau, die Hauptfigur der "Auslöschung", revoltiert.
Nicht um Ich-Auslöschung geht es dem Amerikaner Robert Creeley, aber darum zu zeigen, dass jede Autobiografie sich auch ihr Ich konstruiert. Der prominente Lyriker hat eine Autobiografie von sensationeller Kürze geschrieben - 62 Seiten ist die deutsche Übersetzung lang; kein Titel bringt das Leben auf eine Formel, das Buch heißt schlicht "Autobiographie". Creeley macht die Gattung selbst zum Thema: "Aber es wäre wirklich ein Narr, wer annähme, daß irgendein Leben einer schlichten Folgerichtigkeit gehorcht, oder verdient wäre, oder selbstverständlich. Es ist das Vergnügen und das Vorrecht des Schreibens, daß es ein Leben, das gelebt werden soll, erst einmal erfindet."
Die erste Seite des Buches ist wie eine Grabplatte gestaltet: Name und Geburtsjahr sind eingetragen, nach einem Bindestrich ist der Platz für das Todesjahr ausgespart. Deutlicher kann man es nicht bewusst machen: Autobiografien werden von Lebenden geschrieben, oft von ÜberLebenden, aber immer nur von Lebenden. Und daher wissen die Leser auch bei Autobiografien, die ins KZ führen: Der Autor, die Autorin wird überleben. Darum fragt Ruth Klüger in ihrer Autobiografie "weiter leben. Eine Jugend" lapidar: "Wie kann ich euch vom Aufatmen abhalten? Den Toten ist damit nicht geholfen."
Tradition
Autobiografie hat eine lange Tradition, die bis in die Antike zurück reicht. Überraschenderweise liegen die Wurzeln aber nicht bei den Griechen, die so viele Themen und Gattungen zum ersten Mal verwendet haben. Warum es dann bei den Römern zur Autobiografie kommt, weiß man nicht sicher. Bei ihnen war der Subjektivismus stärker ausgeprägt, wie nicht zuletzt ihre Porträtkunst beweist. Ein neuer Subjektivitätsschub war jedenfalls mit dem Christentum verbunden. Der Begründer der Autobiografie im heutigen Sinn ist Augustinus. Seine "Confessiones" erzählen in neun Kapiteln die äußere Biografie, dann folgen Reflexionen über Zeit und Gedächtnis sowie über die Weltschöpfung. Es geht also nicht um die Fakten des Lebens, sondern darum, das Handeln Gottes am Beispiel des Augustinus und an der Geschichte zu zeigen. Die "Confessiones" haben jahrhundertelang gewirkt. Lateinische Jesuitendramen haben sie in Szene gesetzt und Rousseau bezieht sich nicht nur im Titel auf sie, sondern auch in einzelnen Motiven. Ein neues Interesse am Individuum und seiner Lebensgeschichte hat dann noch einmal die Aufklärung geweckt. Und die Gattung Autobiografie hatte eine Blütezeit im 18. Jahrhundert. Höhepunkt dieser Entwicklung ist Goethes "Dichtung und Wahrheit".
Etwas von sich hinterlassen
Seit Jahren erleben Autobiografien einen Boom. Michael Mitterauer vermutet einen Grund dafür: "Ich glaube, dass jede Beschäftigung mit der Lebensgeschichte eines anderen Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte ist. Und diese Lebensgeschichte kann noch so fremd sein - irgendetwas des eigenen Lebens wird dadurch berührt."
Wladyslaw Bartoszewski, Zeithistoriker und ehemaliger polnischer Außenminister, war in seinen Forschungen über den Holocaust oder über die polnische Nachkriegsgeschichte oft auf autobiografische Aussagen von Zeitzeugen angewiesen, weil Dokumente vernichtet worden waren. Und er hat selbst eine Autobiografie geschrieben. Für ihn hat das auch mit dem Wunsch zu tun, dass das eigene Leben nicht in Bedeutungslosigkeit und Vergessen versinkt: "Was kann bleiben? Eine Grabplatte? Die Familie? Eine Familie pflegt das Grab maximal zwei Generationen lang. Das Buch aber, ein Bericht, eine Autobiografie bleibt. Dazu kommt, dass wir so schreckliche und so komplizierte Sachen in Europa erlebt haben. Da bleibt dann die Sehnsucht, etwas zu hinterlassen: den Kindern, den Enkelkindern. Die Menschen in Mittelosteuropa waren arm. Sie konnten kein reiches Erbe anbieten. Aber sie konnten immer eine Tradition anbieten, etwas über sich."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!