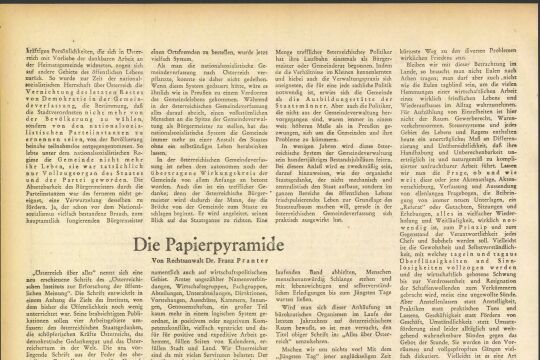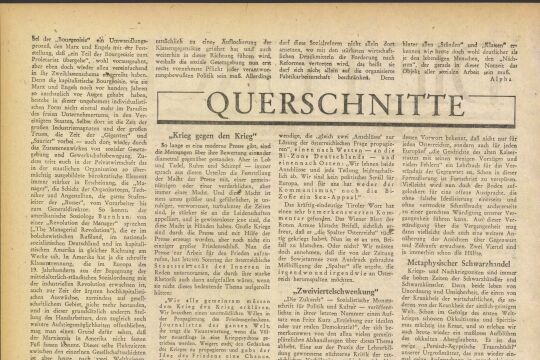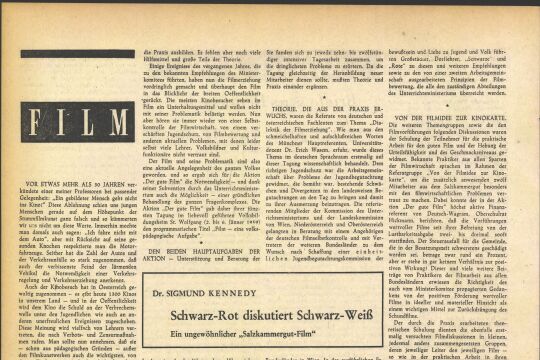Frau Knackal geht in Frühpension
Zumindest im öffentlichen Bild seiner Diener feiert der Staat sein Wiedererstehen - freilich unter neuen Vorzeichen.
Zumindest im öffentlichen Bild seiner Diener feiert der Staat sein Wiedererstehen - freilich unter neuen Vorzeichen.
In einer aktuellen US-Umfrage wird Feuerwehrleuten das höchste moralische Ansehen aller Berufsgruppen bestätigt. Krankenschwestern und Soldaten folgen. Nur eine logische wie zeitflüchtige Folge des Terroranschlages vom 11. September vergangenen Jahres? Nicht unbedingt. Schon vorher feierte der Staat und seine Diener - in den USA ebenso wie in Österreich - eine mitunter fragwürdige Wiederkehr in Filmen, TV-Soaps, Plakaten.
Die eine Seite der Medaille kennen wir zur Genüge. Ihre Prägung heißt Verwaltungsreform, schlanker Staat und vermehrte Effizienz. Auch die dafür eigens geschriebenen Reden kennen wir nahezu auswendig. Gleich ob Bundeskanzler oder Bundespräsident, Verwaltungsexperten oder Gewerkschaftsfunktionäre: das ausgesendete Vokabular über die anstehenden Reformen des Öffentlichen hat sich längst angeglichen, der Unterschied ist nur mehr in der Nuance wahrzunehmen. Soweit so trübe. Die andere Seite der Staats-Medaille erhält ihre Prägung im Kulturellen, vorzugsweise in den Soaps des Fernsehen, im Kino, auf Plakaten; kurz im abgelichteten Beamten.
Im rotweißroten Soap-Imperium treffen wir unseren Beamten meist sitzend an. In der karikierenden Serie "MA2412" ebenso, wie in Helmut Zenkers "Kottan" oder im "Kommissar Rex": Selbst die Kriminalbeamten sitzen bei uns konsequent in viel zu großen Räumen bei ihrer Wurstsemmel, während sich der Fall verlässlich vierpfotig löst. Das öffentliche Image vom österreichischen Beamten unterscheidet sich vom seriellen Bild der ORF-Unterhaltung kaum. Der stereotype Beamte sitzt sich durch das Leben bei penibler Einhaltung seiner Ansprüche. Anders geartete Erzählungen vom Beamten sind TV-Geschichte: Es wäre hierbei an Jörg Mauthes "Familie Merian" zu erinnern, die die bürgerliche Version des korrekten kleinen Beamten mitsamt Familienanhang erzählte, oder - noch einen Schritt weiter zurück - an den berühmten "Hofrat Geiger".
So gesehen erzählt die österreichische Filmgeschichte vom Beamten seit den frühen Tagen der Zweiten Republik zugleich eine Geschichte seines Abstiegs, wie auch eine Geschichte seiner Vermenschlichung. Von der Hofrats-Chiffre des geistvollen, weltmännisch-konservativen Österreichs zum proletarierhaften Kommissar-Beamten à la Kottan oder Brenner aus Wolfgang Haas' "Komm süßer Tod". Was beiden letzteren gemeinsam ist, ist ihr Leiden an den Zuständen, wie auch an der kolportierten Dummheit und Ignoranz der Vorgesetzten.
Man kann die heimischen Dienstklassen-Filme aber auch noch anders lesen, etwa als Kommentar zur modernen Gesellschaft mit all ihren Zerfaserungen und Verästelungen. Vom Ministerium und höfischen "Küss die Hand"-Zeremoniell ging es im Laufe der Jahrzehnte auf die Straße, ins Bezirksamt, in die Außenstelle, zum Parteienverkehr. Die niederen Chargen rückten immer öfter vor die Filmlinse, in den Drehbüchern wurde immer häufiger vom normalen, zuletzt auch vom prekären Leben der Staatsdiener erzählt. "Gelbe Kirschen" (Leopold Lummerstorfer), um einen jüngeren Kinofilm zu nennen, erzählt etwa eine Wiener Beamten-Geschichte aus dem fremdenpolizeilichen Bereich jenseits der Privilegien, der Macht und ihrer Erhaltung. Es ist vielmehr ein Eingeständnis persönlicher Ohnmacht angesichts der herrschenden Verhältnisse.
Endstation Notaufnahme: Auch die krisengeschüttelte westliche Gesellschaft suchte in der Unterhaltungskultur der späten neunziger Jahre zusehends häufiger den Arzt, das Spital, präziser: die Notfall-Ambulanz auf. Der "Emergency Room" - so auch der Titel einer ungemein beliebten amerikanischen Soap-Serie dieser Zeit - entpuppte sich als treffsichere Zustandsbeschreibung einer allgemeinen Befindlichkeit, die die ausgerufene Habermas'sche Theorie der "Neuen Unübersichtlichkeit" in ihrer Unterhaltungskultur bevorzugt mit Chaos und Zusammenbruch übersetzte.
Mit dem 11. September letzten Jahres haben diese gesellschaftlichen Krisenbilder ihren unerwarteten, wie auch vordergründigen patriotischen Rahmen erhalten, ist der Rettungsfahrer durch seinen heldenhafteren "Bruder", den Feuerwehrmann, ersetzt und abgelöst worden. Dennoch: Der neuerdings feststellbare patriotische Grundton soll nicht vergessen machen, dass die Gesellschaft schon weit früher, weit selbstkritischer und weit verstörter ihre Selbstbeschreibungen in den lebensbedrohenden Szenarien der Unterhaltungskultur gesucht und gefunden hat. Mit anderen Worten: Der "kranke Mann" war längst schon nicht mehr allein am Bosporus zu Hause, sondern ebenso in den urbanen Zentren Westeuropas wie auch in jenen der USA. Der Patriotismus kam erst später - und hier vor allem in den USA - hinzu und legte eine falsche, wenn auch vielleicht verführerische Spur diesseits und jenseits des Atlantiks.
Zurück nach Österreich. Auch hierzulande treten uns in letzter Zeit schablonenhaft neue Identitätsträger des modernen Staates plakativ entgegen. Es sind dies die unerlässlichen Systemerhalter der offenen Gesellschaft, die gleichsam garantierten Staatsträger: Der Feuerwehrmann, die Krankenschwester und der Rettungsfahrer. Dazu kommt noch, wenn auch noch nicht so häufig im Gruppenbild des Öffentlichen vertreten, der Soldat, dessen neue Plakat-Ikonographie weit mehr an einen (uniformierten) Entwicklungshelfer, einen (uniformierten) Bergretter oder (uniformierten) Sozialarbeiter denken lässt, als an einen waffentragenden Staatsvertreter. Wir erinnerten uns ihrer nicht nur plakativ im zu Ende gegangenen Jahr der Ehrenamtlichen, viel eher ist anzunehmen, dass uns diese uniformierte, wie paradoxe Figurenkonstellation - die Ehrenamtlichen tragen Uniform, der Soldat will sie ablegen - noch des längeren beschäftigen wird.
Überspitzt formuliert: In dieser Figurengruppe lässt sich auch so etwas wie ein zukünftiges Leitbild des Staates ablesen. Die verloren wirkende Figur des kleinen Beamten scheint zurzeit von bekannten, wie bewährten Leistungsträgern des Öffentlichen abgelöst zu werden. Der Staat gibt sich nach außen markanter und präziser. Sein neues Auftreten signalisiert er lieber durch "stille Helden" unseres Alltags mitsamt klarer und vermittelbarer Kompetenz, als durch den herkömmlichen "Staatsdiener" mit nach außen hin zumindest verschwommener Zuständigkeit. Der Staat schickt so gesehen auch nicht mehr "seine Beamten aus", lieber greift er in seinen Bildbotschaften auf den halbstaatlichen, wie halbprivaten Sektor zurück.
Die Botschaften der Feuerwehr, der Rettung und des Krankenhauspersonals sind so knapp wie eindeutig und allgemein verständlich: Der neue Staat hilft in der Not, dort wo es "brennt", wo Not am Mann ist. Der Krisenbefund einer allgemein verunsicherten Gesellschaft soll somit in dem Maße Vergangenheit werden, wie der Staat mittels neuer Bildbotschaften seine Rückkehr ankündigt. Präsent und abrufbereit, effizient und einsatzfähig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!