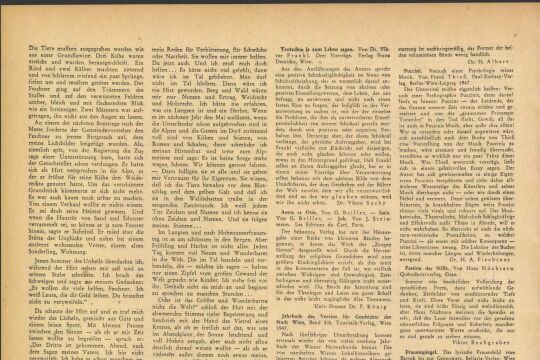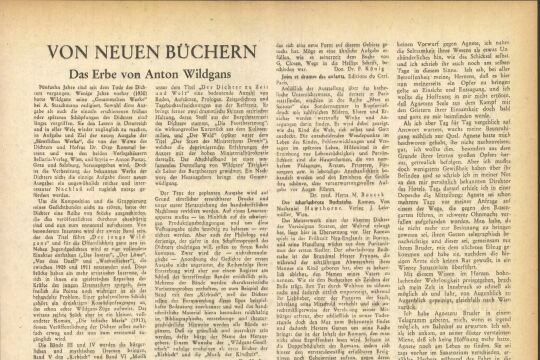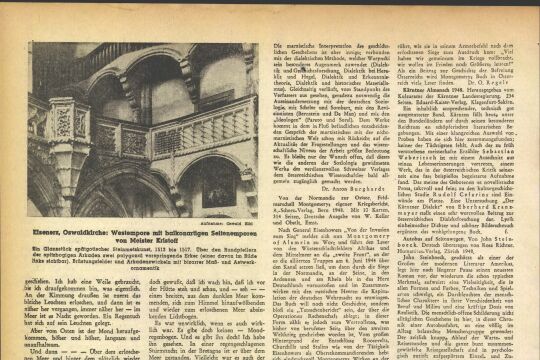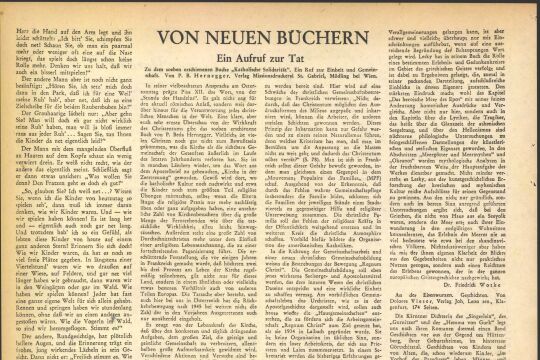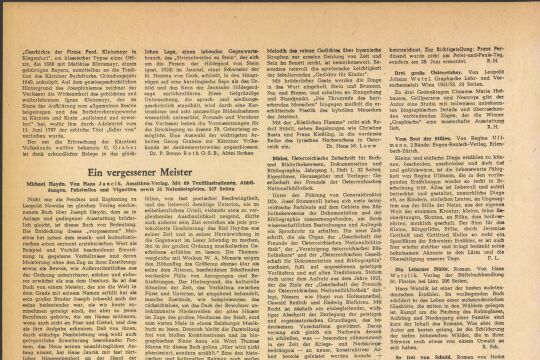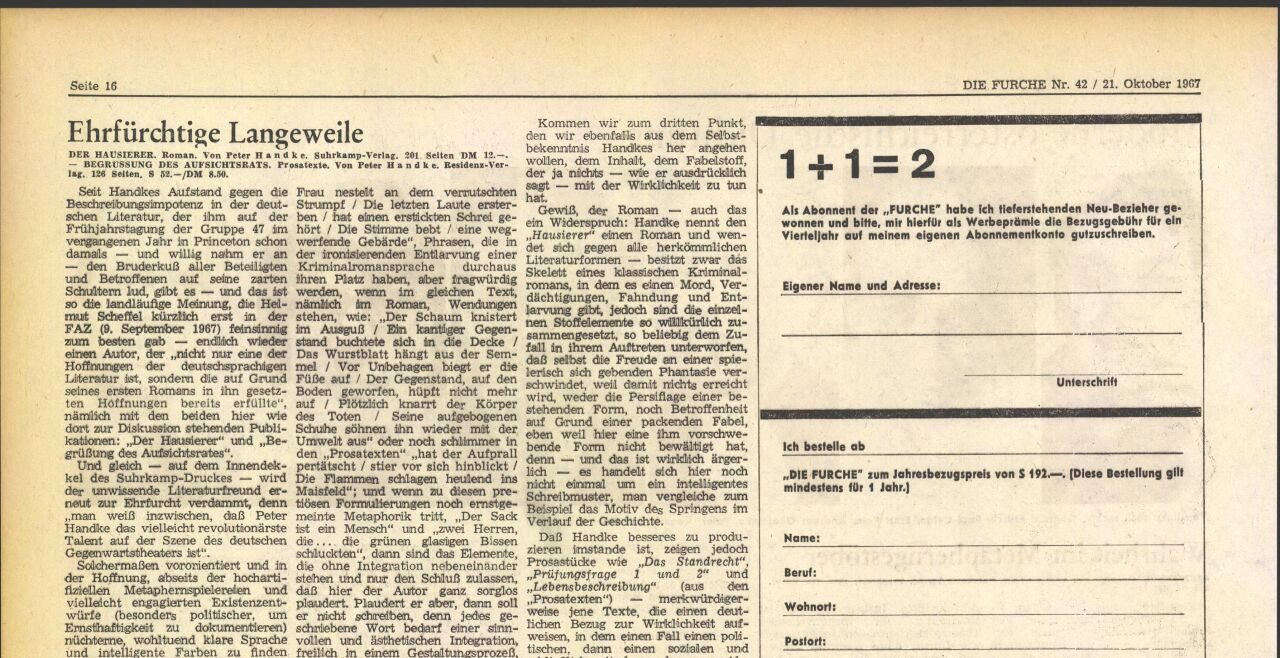
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Belege des Andreas Okopenko
DIE BELEGE DES MICHAEL CETUS. Erzählungen. Von Andreas Okopenko. Residenl-Verlar, Salzburg. 182 Selten. S 59.—.
Wer Okopenkos bisher veröffentlichtes lyrisches Werk („Grüner November“, 1957, und „Seltsame Tage“, 1963), für das er 1966 den Wildgans-Preis bekam, auch nur mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt hat, der weiß, daß dieser sensible Protokoll-lierer trotz aller Sensibilität oder trotz seiner Unsicherheit oder intellektuellen Vorsicht durchaus die Zähne der Polemik zeigen kann. Aber immer mit einer gewissen Spitzbüberei und ironischer Bescheidenheit — auch wenn er beißt...
„Die Materialrutsche oder Die Belege des Michael Cetus“ sind, wie die beiden anderen Erzählungen des gleichnamigen Bandes, in den Jahren 1962/63 entstanden und stellen daher nicht die letzte Entwicklungsstufe des Lyrikers Andreas Okopenko in Richtung Prosa dar. Im Nachhinein manifestieren sie vielmehr eine außerordentlich fruchtbare Zweigleisigkeit, wobei die Lyrik am Ende doch noch mehr profitiert zu haben scheint als die Prosa. Trotzdem kann man ihr den hohen Rang innerhalb der österreichischen Gegenwartsliteratur nicht absprechen.
Der Ausgangspunkt ist gleich geblieben: eine komplizierte, geringsten Schwankungen unterliegende vage Empflndunigsweflt wird auf Fixierbares hin untersucht; Sinneseindrücke und Wunschbilder werden Wiederzugeben versucht, aber die Wiedergabe selbst ist weit von jeder Vagheit entfernt und off limits für Gefühle, die sonst dichterische Beobachtunigen bestimmen. Hier setzt sich der Chemiker ans Protokoll, um „Belage“ aus der Hand zu geben, die durch spezifische Exaktheit bestechen, im. Falle des „Michael Cetus“ sind diese Belege ganz verschiedener Art: Selbstgespräche, Photos, Briefe, Impressionen, Tagebücher, Zeitungsberichte oder Tonbänder... Das Ganze, in 42 Belege (Kapitel) aufgeteilt, zeigt den Selbstmord des 18jährigen Gymnasiasten Cetus aus „politischen Motiven“. Nicht etwa enttäuschte Liebe — er ist im Gegenteil gerade im Vollgefühl seiner ersten —, sondern die durch einzelne Ereignisse oder Erlebnisse (wie dem eines Veteranentreffens) gewonnene Überzeugung, daß die Lage aussichtslos sei. Durch organisierte Brutalität wird die Qual zum integrierenden Lebensbestandteil, und gegen diese Qualen und Bedrohungen gibt es für Cetus keine wie immer geartete Abhärtung geistiger oder physischer Natur. Die Kunst des Tötens lernt er nie, dieser umgekehrte Zögling Törless, der sich nicht mit Beobachtung und Reflexion begnügen „kann
und soll“, sondern Konsequenzen fordert. Und für sich auch eine zieht.
Die zweite Erzählung, „Zwei Schufte“, ist die Entwicklungsgeschichte zweier recht unterschiedlicher Literalten, die sich — glücklich korrumpiert — schließlich doch an einem gemeinsamen Punkt die schmutzigen Hände reichen können. Vielleicht sollte man diese ironische Geschichte von Manfred und Alfred
— mit der nötigen Vorsicht — auch als eine parodistische Kontroverse Andreas kontra Okopenko ansehen. Dann sieht man auch vermutlich, um wieviel es mehr ist...
Die letzte Erzählung trägt den Titel „Der Greis“. Hier wird das Leben des 81jährigen Lehrers Wanner in einzelnen Abschnitten vorgeführt: Im 14. Lebensjahr z. B., darauf im 52. und dann wieder im 16. Die Jahre sind durcheinandergewürfelt
— sie sind auch nicht besonders wichtig, denn der einzige Faden, der durch das ganze Leben Wanners zieht, ist die Einsamkeit: Er hatte nämlich nie ermitteln können, „wozu die ganze Liebe gut ist“.
In keiner der drei Erzählungen Okopenkos wird eine kontinuierliche Geschichte erzählt, aber in keiner geht sie völlig verloren. Das Fehlende zwischen den Stücken, die nie bruchstückhaft wirken, hat der Leser selbst aufzubringen, indem er seine Phantasie mobilisiert. Vom Muidum-gedanken seiner Lyrik („Fluidum ist Gefühl mit existentieller Resonanz oder vor unendlichem Horizont...“) selbstverständlich etwas losgelöst, zeigt diese Prosa In ihrer Assoziato-rik und ihren bewußt „lyrischen“ Partien doch auch starke Parallelen dazu. Nur die Analyse sorgt für den neuen Akzent: „Die Erzählungen dieses Bandes bedeuten Spektralanalysen von Zeiten, Vorgängen und Personen. Bei der Spektralanalyse wird einheitlich scheinendes Licht in eine Skala jener farbigen Lichtsorten zerlegt, als die ein unbestechliches Auge es sehen müßte.“ Für ein unbestechliches Auge mag aber auch vielleicht die allzu sorgfältig und konkret manchen Idiomen des Alltags nachgehenden Spektralanalyse an den relativ schwächeren Partien des Bandes schuld sein. Sonst aber ist das Motto nicht das Schlechteste: Konkret sei der Dichter, sachlich und kurz. Und was er sonst noch zu sein hat, das ist Andreas Okopenko auch.
PS: Ware das Wort von der „heimatlosen Linken“ nicht mindestens einmal gefallen, man hätte das Buch nicht glücklich aus der Hand zu legen vermocht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!