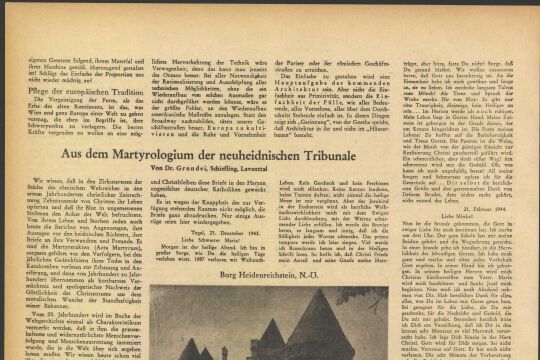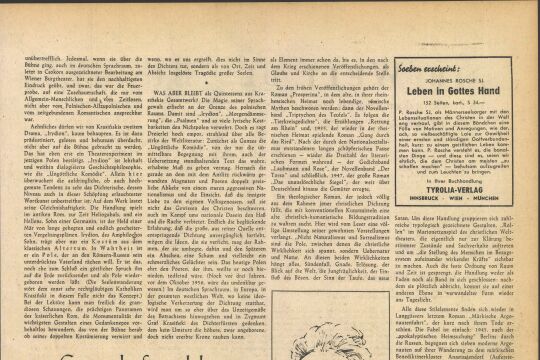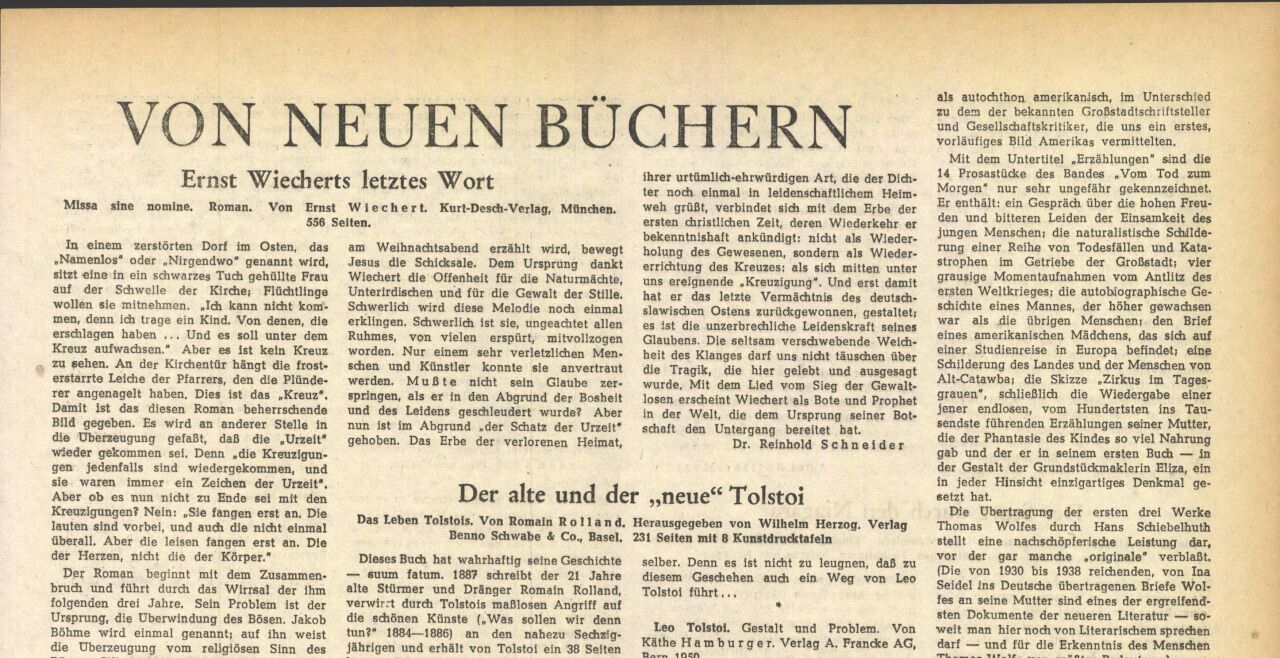
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ernst Wiecherts letztes Wort
In einem zerstörten Dorf im Osten, das „Namenlos“ oder „Nirgendwo“ genannt wird, sitzt eine in ein schwarzes Tuch gehüllte Frau auf der Schwelle der Kirche; Flüchtlinge wollen sie mitnehmen. „Ich kann nicht kommen, denn ich trage ein Kind. Von denen, die erschlagen haben ... Und es soll unter dem Kreuz aufwachsen.“ Aber es ist kein Kreuz zu sehen. An der Kirchentür hängt die frosterstarrte Leiche der Pfarrers, den die Plünderer angenagelt haben. Dies ist das „Kreuz“. Damit ist das diesen Roman beherrschende Bild gegeben. Es wird an anderer Stelle in die Überzeugung gefaßt, daß die „Urzeit“ wieder gekommen sei. Denn „die Kreuzigungen jedenfalls sind wiedergekommen, und sie waren immer ein Zeichen der Urzeit“. Aber ob es nun nicht zu Ende sei mit den Kreuzigungen? Nein: „Sie fangen erst an. Die lauten sind vorbei, und auch die nicht einmal überall. Aber die leisen fangen erst an. Die der Herzen, nicht die der Körper.“
Der Roman beginnt mit dem Zusammenbruch und führt durch das Wirrsal der ihm folgenden drei Jahre. Sein Problem ist der Ursprung, die Uberwindung des Bösen. Jakob Böhme wird einmal genannt: auf ihn weist die Uberzeugung vom religiösen Sinn des Bösen: „Wir bedürfen nämlich des Bösen, um gut zu werden.“ Ja, es braucht nicht einmal Feindschaft sein zwischen Guten und Bösen, „weil tief, ganz tief unten derselbe Urgrund für beide bereitet war.“ Die Aufgabe ist: das Dunkle auszulöschen, ein Menschenbild zuzudecken, in dem das Böse Gestalt angenommen hat: ihre gnadenhafte Lösung fällt dem zu, der am tiefsten in das Leid der Zeit hinabstürzte, der Anteil gewann am Bösen, weil er gut werden, weil er „Licht“ werden sollte. Das große Wort der Uberwindung ist: „Keine Gewalt“. Wohl ringt der Pfarrer Wittkopp schwer um seine Stellung in der Kirche; es ist ihm, als sei eine Kirche etwas, in der man nur mit Mühe näher bei Gott sein kann: so nahe, wie wir nun 6ein sollen. Er möchte einst „mit dem Spaten“ vor Gott erscheinen, nicht „über“ der Gemeinde sein, sondern „unter“ ihr, ein apostolischer Mann im Sinne der ersten Zeit, und somit nichts weniger als der Gründer einer Sekte.
Ernst Wiechert hat in diesem Buche die Antwort auf die Fragen gefunden, die er in seinen früheren Büchern mit Leidenschaft aufgeworfen hat. „Ich war damals noch in dem Lebensalter, in dem man urteilt“, heißt es einmal. Und gegen Ende: „Solange man ein Urteil spricht, außer über sich selbst, ist vieles verloren. Aber wenn man ein Urteil spricht, außer über die anderen, ist nichts verloren.“ Drei Jahre nach dem Zusammenbruch: das bedeutet drei Weihnachtsfeste. Vom Jesuskinde geht die bewegende Segensmacht aus: Gott hat es getan, heißt es ausdrücklich. Der Weg vom Alten zum Neuen Testament, vom Rechten mit Gott zur Ergebung ist offenbar zurückgelegt, die Verheilung des zerrissenen Gottesbildes geschehen. „Wenn die Leidenden die Menschen nicht anziehen, leiden sie falsch.“ Der Dichter hat aber, nach dem Zeugnis dieses Buches, recht gelitten.
Und also läßt er mit diesem Buche wohl die meisten seiner Widersacher, aber wohl auch viele seiner Verehrer weit hinter sich zurück. Man hat sein Fragen und Suchen oft nicht auf die rechte Weise aufgenommen, beantwortet; aber von diesem Werke her wird der Weg deutlich, die Sendung erst erkennbar. In der entsetzlich verwüsteten Welt erscheinen sinnvoll allein die Trümmer deT „alten Ordnung“: der Form, die in den aus dem Osten Herübergetriebenen, den Gutsherren, ihren Bauern und Dienstleuten, lebt. Ernst Wiechert wurde oft mißverstanden, weil nicht erkannt wurde, wie fremd er im Grunde in Deutschland war und ist, wie fremd aber auch in Europa. Er kommt aus dem Grenzgebiete, in dem sich Deutschtum und Slawentum verschmolzen in einer einzigartigen Melodie: in ihr ist 6ein Künstlertum beschlossen; alle seine Bücher, auch die großen Romane, sind im Grunde musikalischer Konzeption; von diesem Ursprung her wird auch sein religiöses Empfinden geprägt in Vieldeutigkeit und Widerspruch; sein Traten, Zaudern und Suchen, sein Verschweben ins Märchenhafte, in eine traumnahe Bilderwelt: als das Kind, von dem am Weihnachtsabend erzählt wird, bewegt Jesus die Schicksale. Dem Ursprung dankt Wiechert die Offenheit für die Naturmächte, Unterirdischen und für die Gewalt der Stille. Schwerlich wird diese Melodie noch einmal erklingen. Schwerlich ist sie, ungeachtet allen Ruhmes, von vielen erspürt, mitvollzogen worden. Nur einem sehr verletzlichen Menschen und Künstler konnte sie anvertraut werden. Mußte nicht sein Glaube zerspringen, als er in den Abgrund der Bosheit und des Leidens geschleudert wurde? Aber nun ist im Abgrund „der Schatz der Urzeit“ gehoben. Das Erbe der verlorenen Heimat, ihrer urtümlich-ehrwürdigen Art, die der Dichter noch einmal in leidenschaftlichem Heimweh grüßt, verbindet sich mit dem Erbe der ersten christlichen Zeit, deren Wiederkehr er bekenntnishaft ankündigt: nicht als Wiederholung des Gewesenen, sondern als Wiedererrichtung des Kreuzes: als sich mitten unter uns ereignende „Kreuzigung“. Und erst damit hat er das letzte Vermächtnis des deutschslawischen Ostens zurückgewonnen, gestaltetes ist die unzerbrechliche Leidenskraft seines Glaubens. Die seltsam verschwebende Weichheit des Klanges darf uns nicht täuschen über die Tragik, die hier gelebt und ausgesagt wurde. Mit dem Lied vom Sieg der Gewaltlosen erscheint Wiechert als Bote und Prophet in der Welt, die dem Ursprung seiner Botschaft den Untergang bereitet hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!