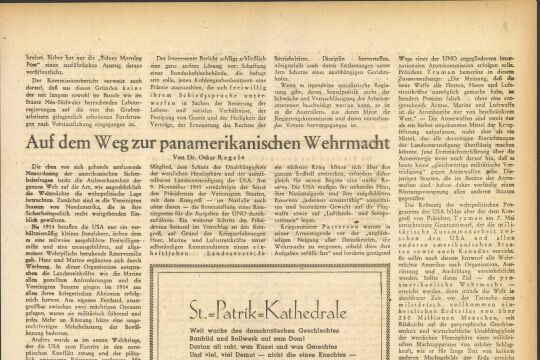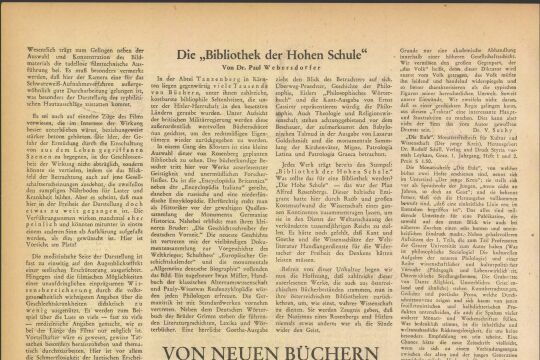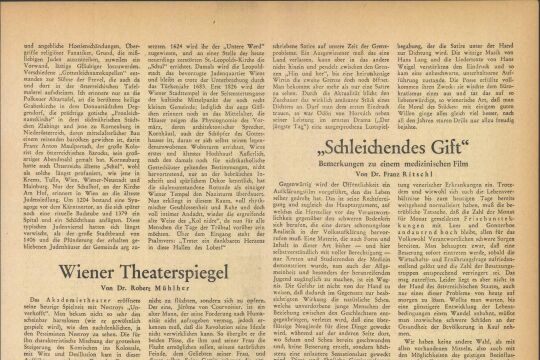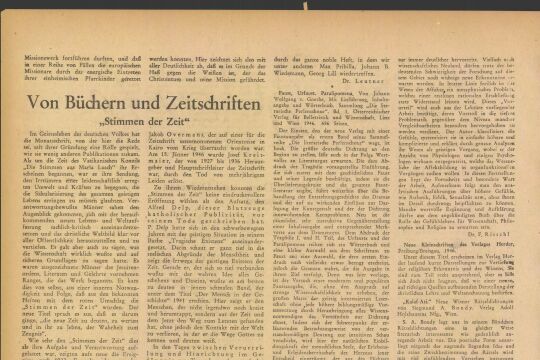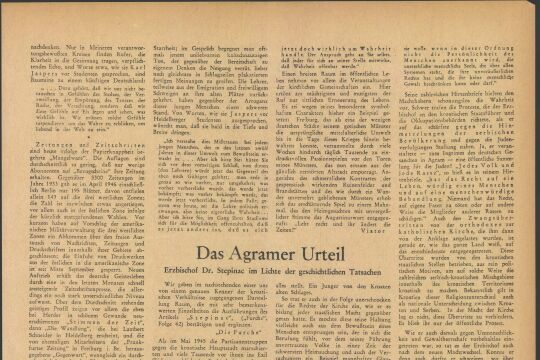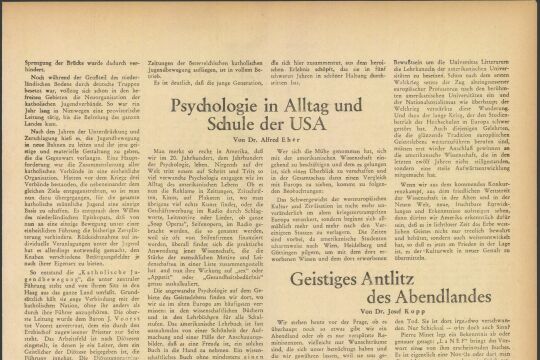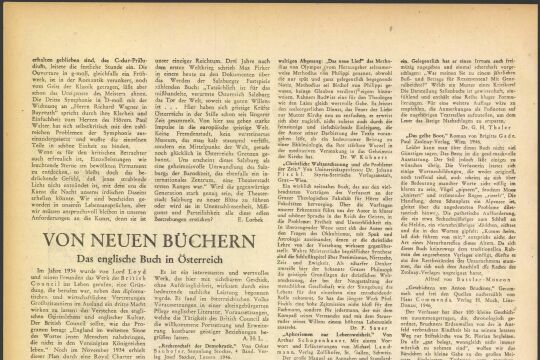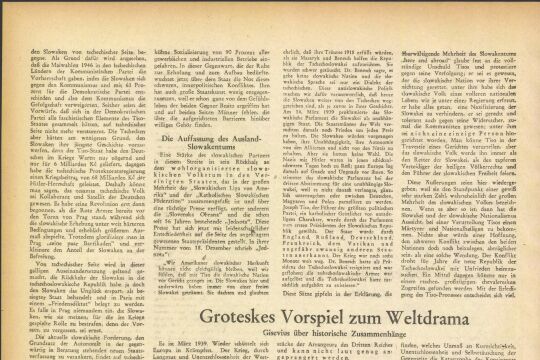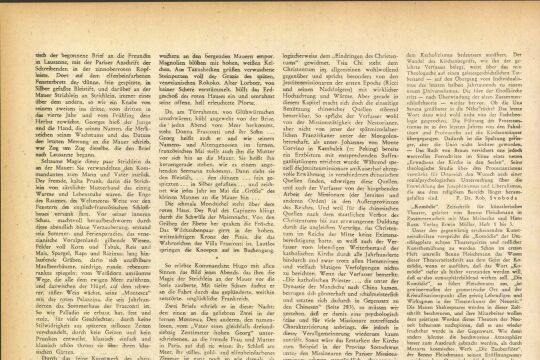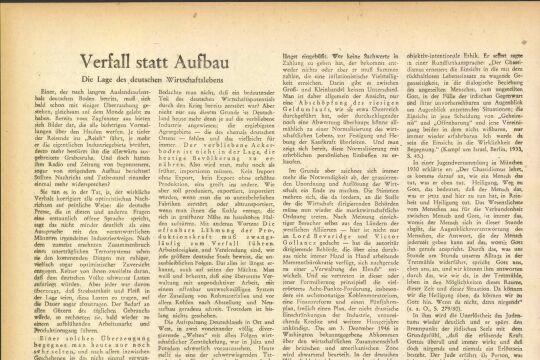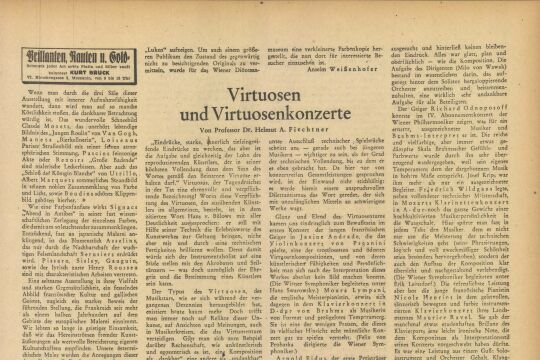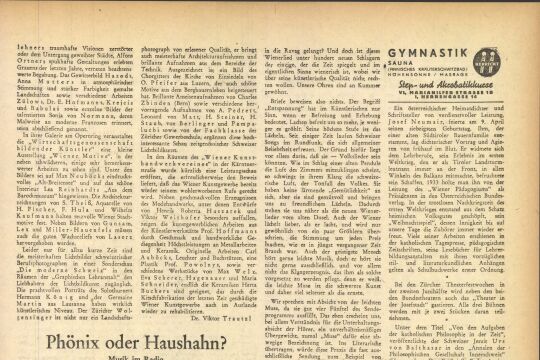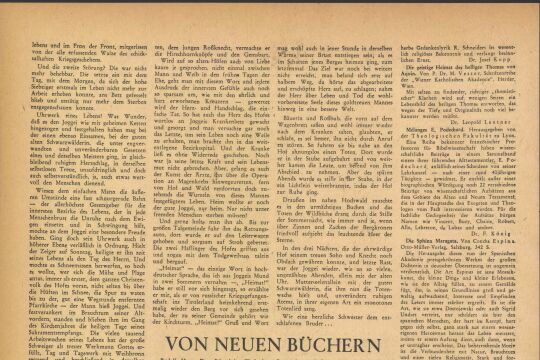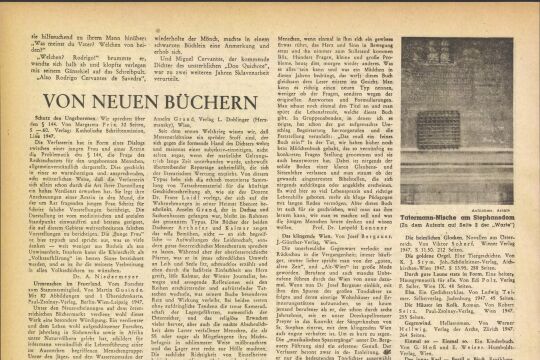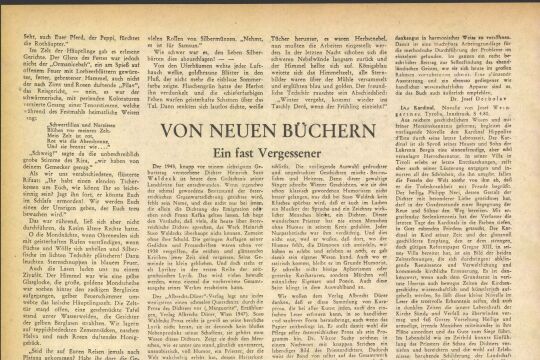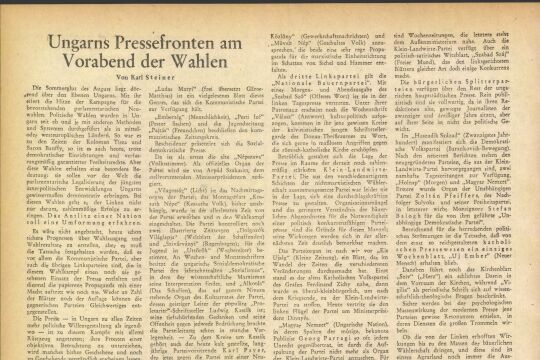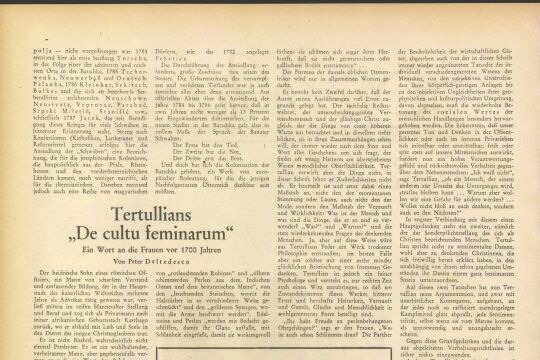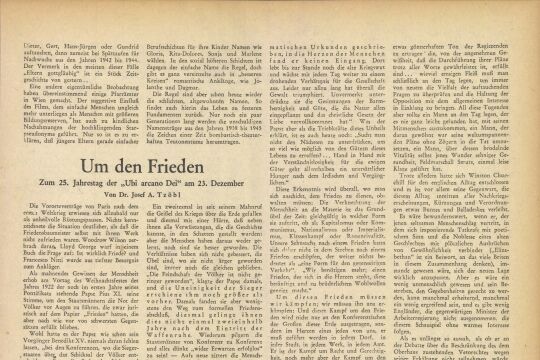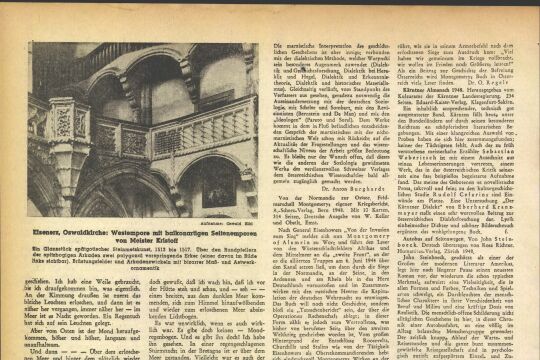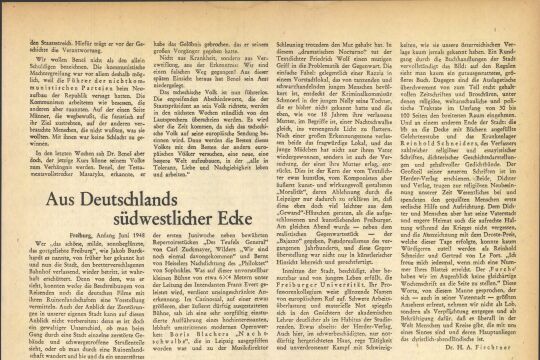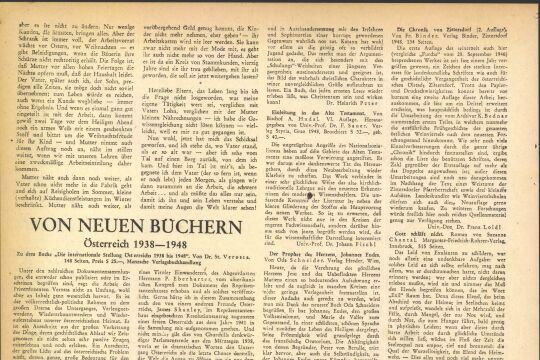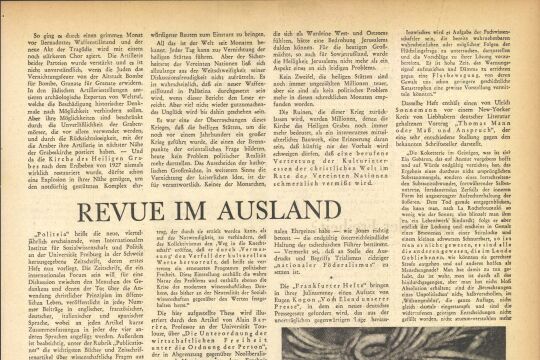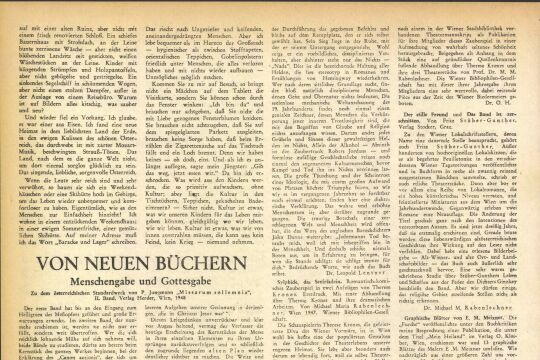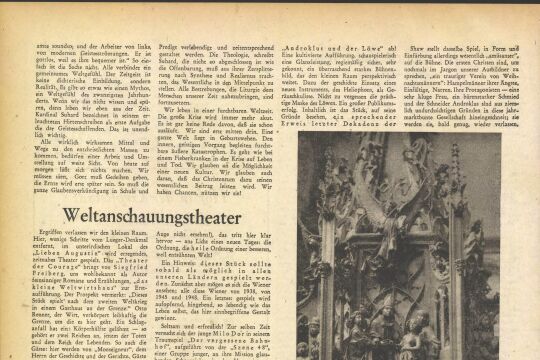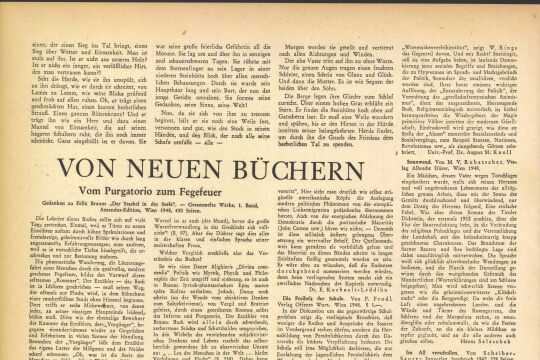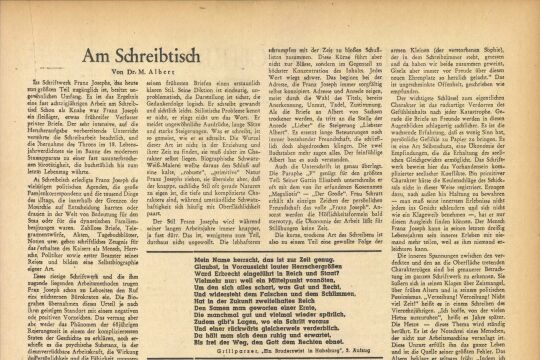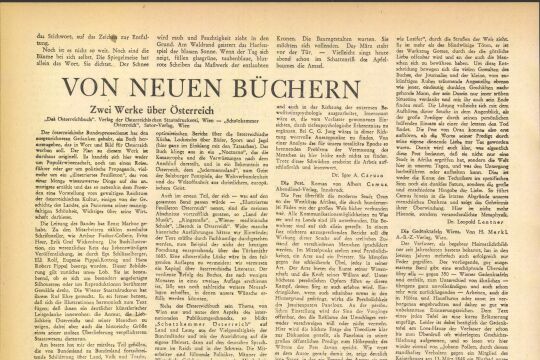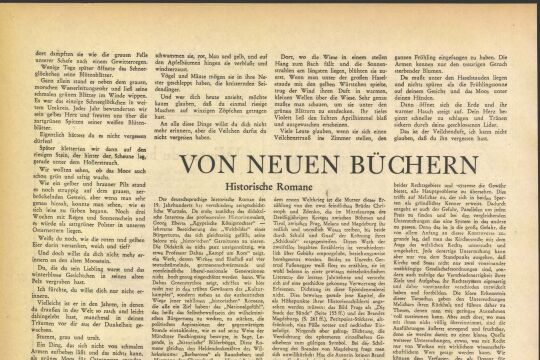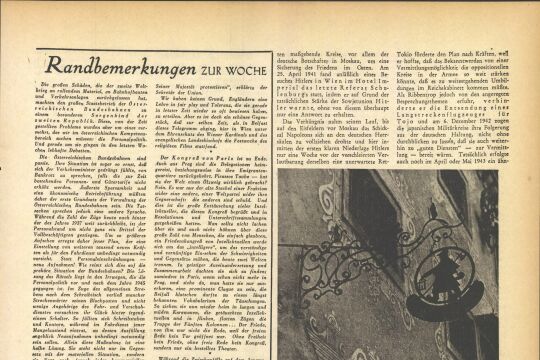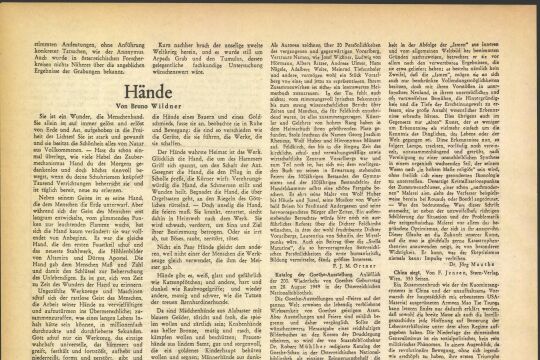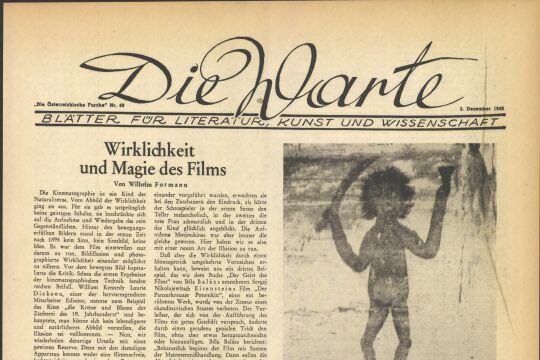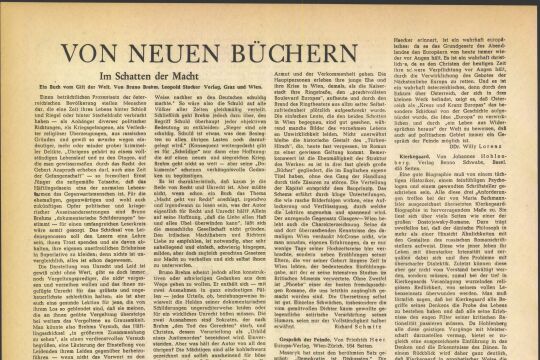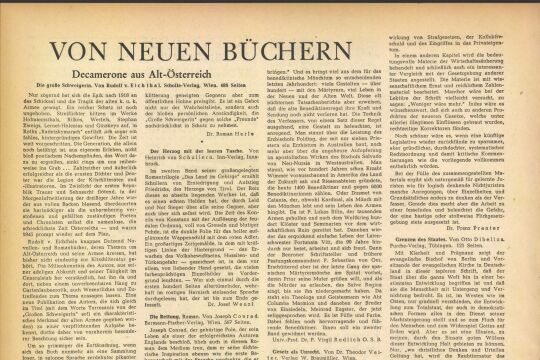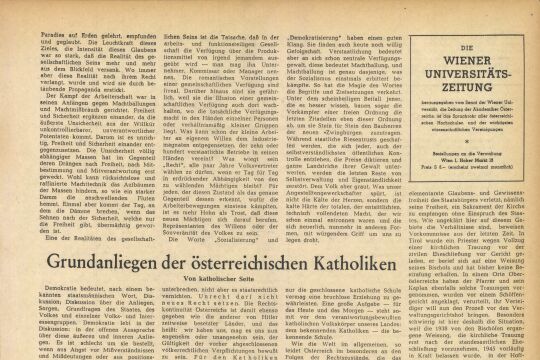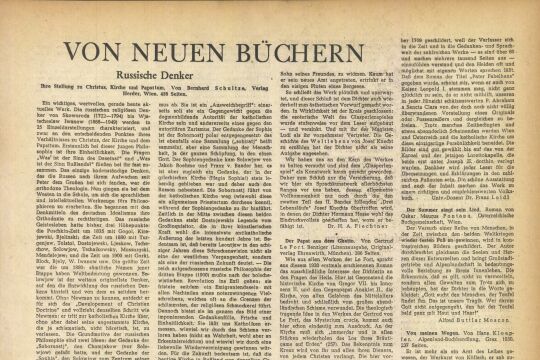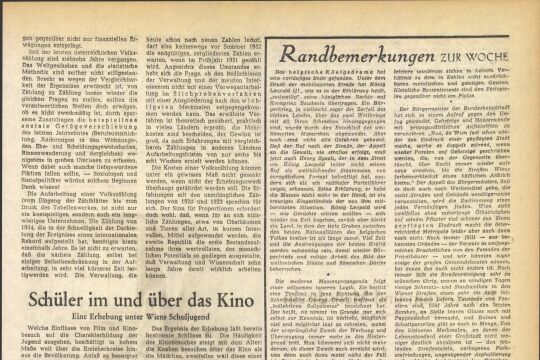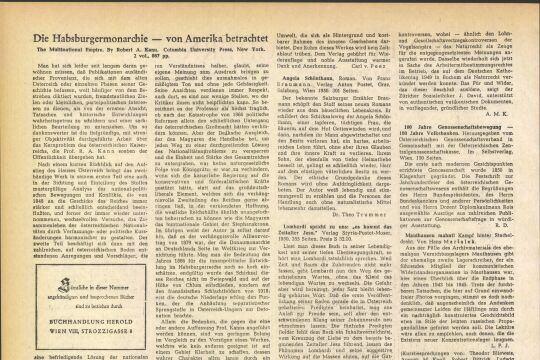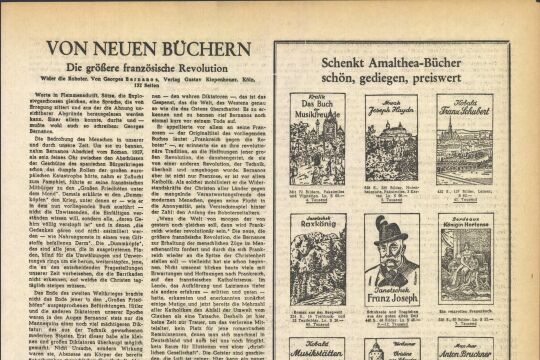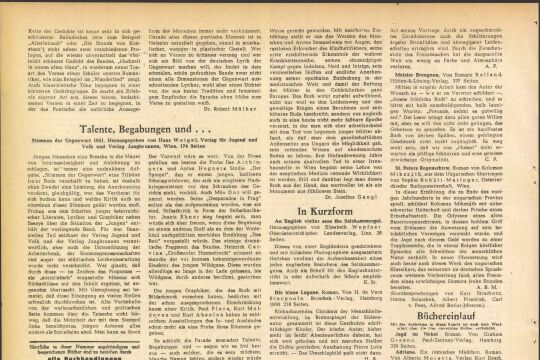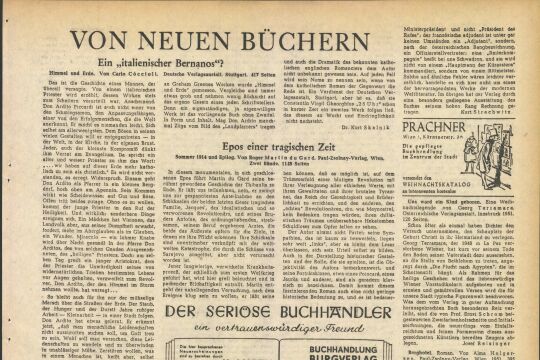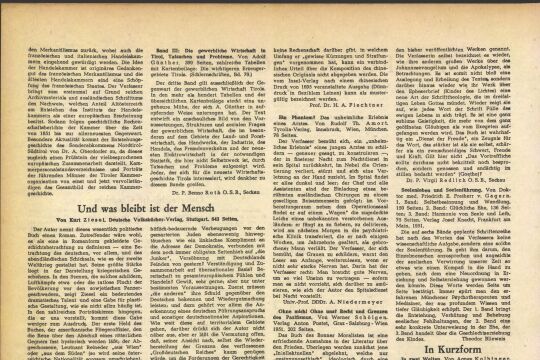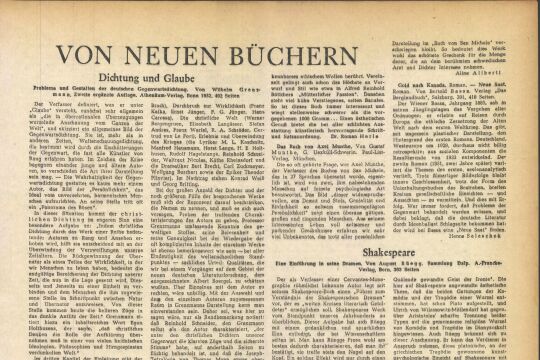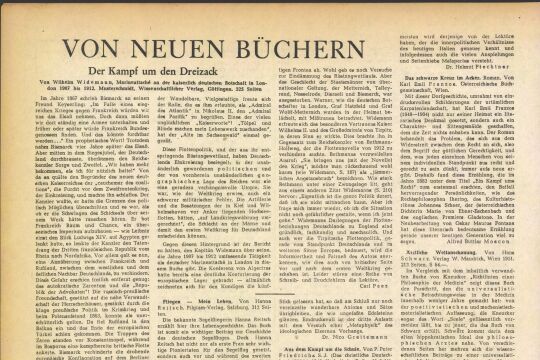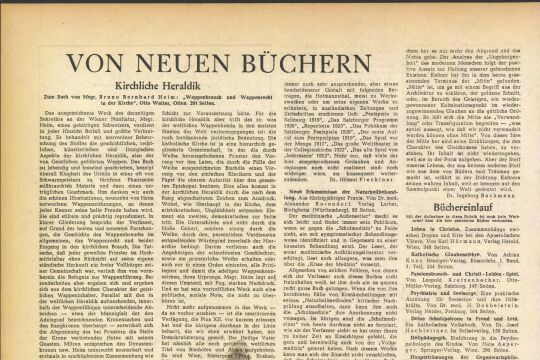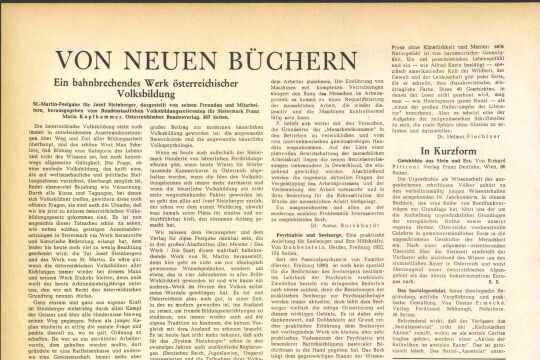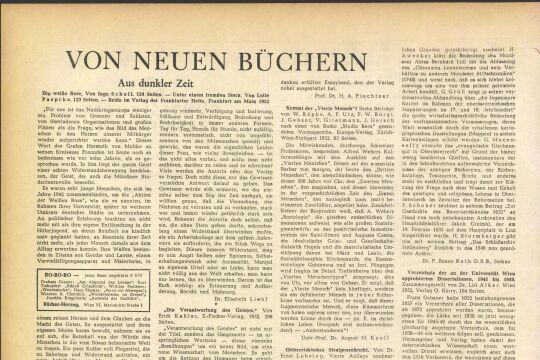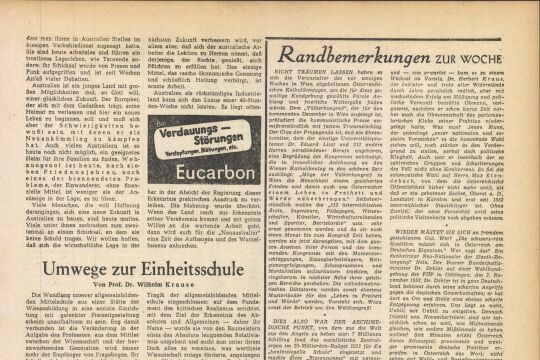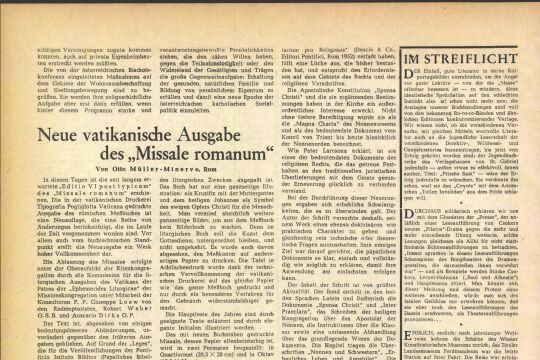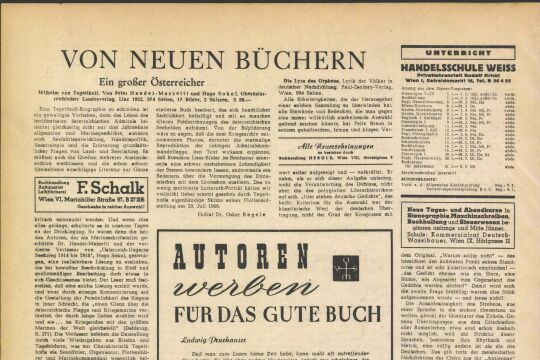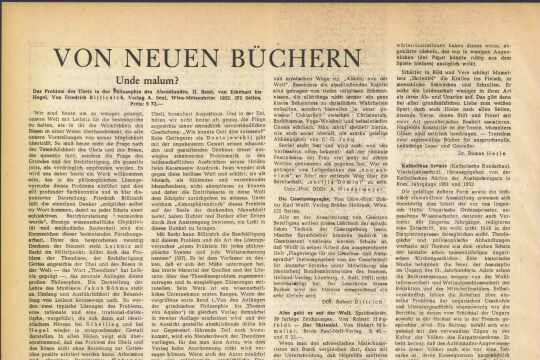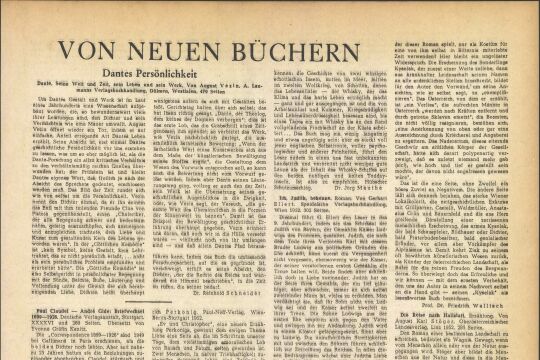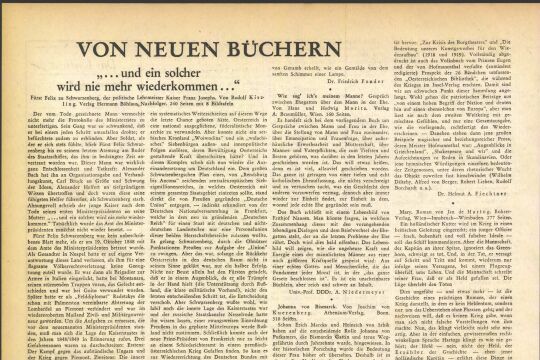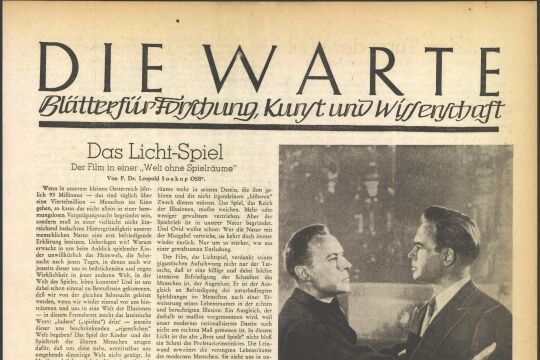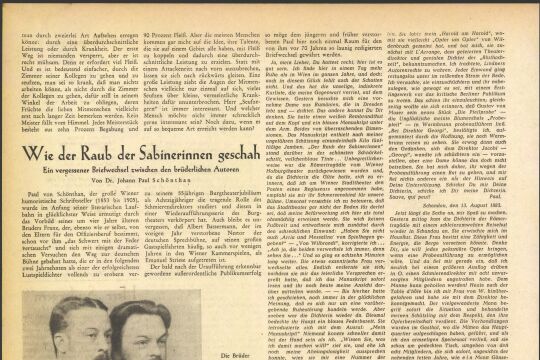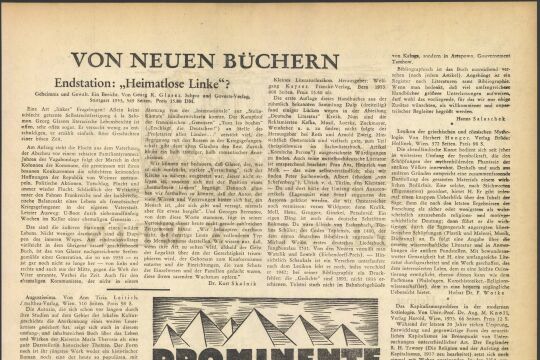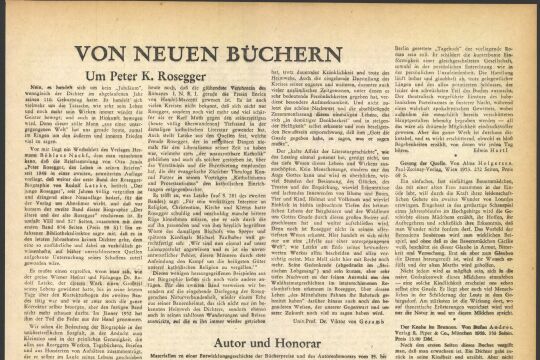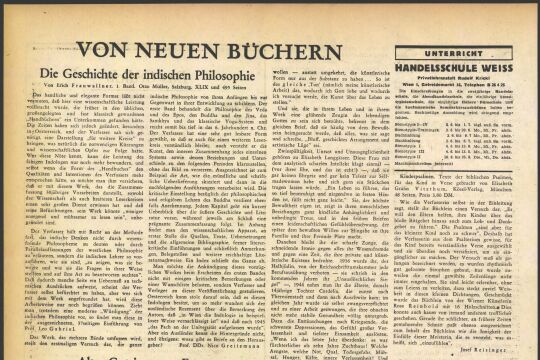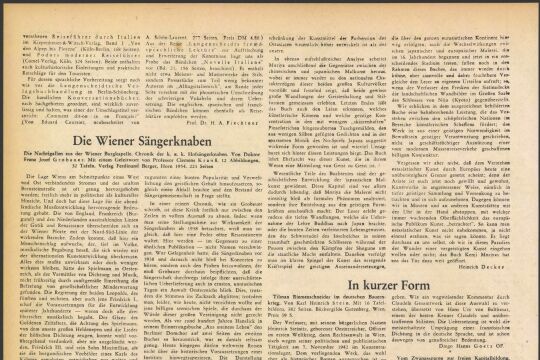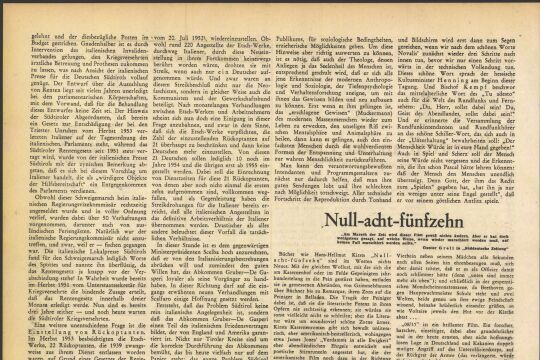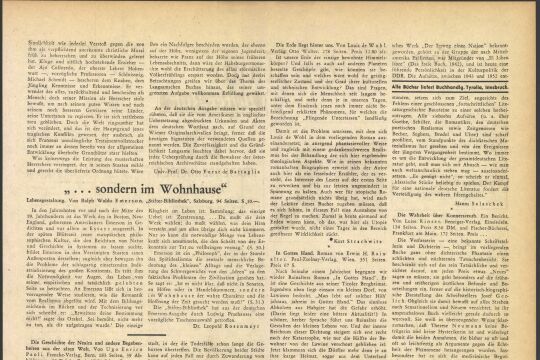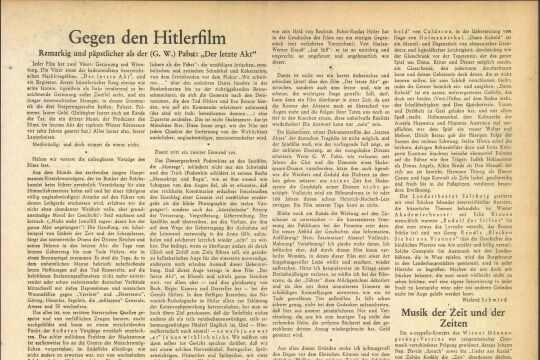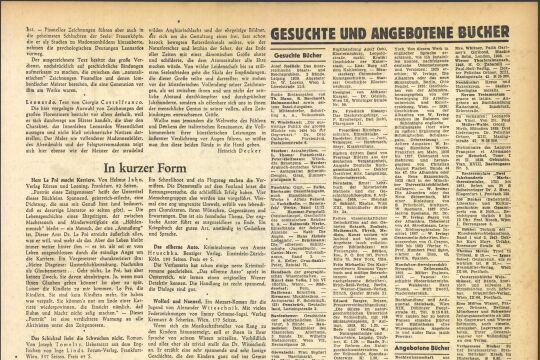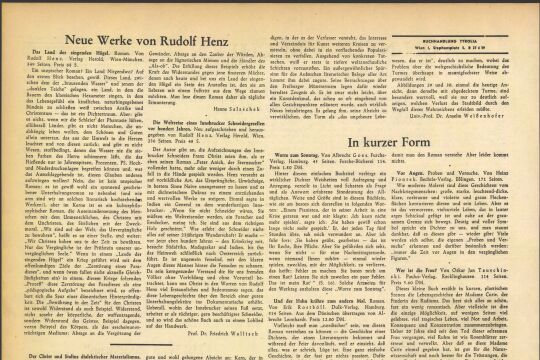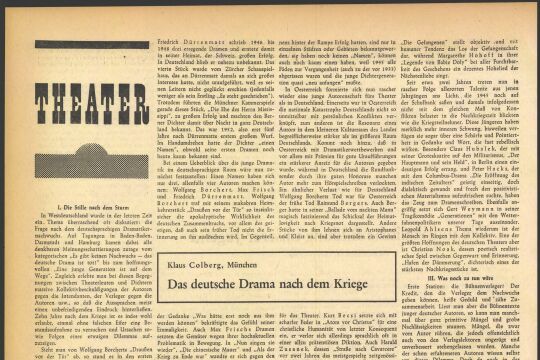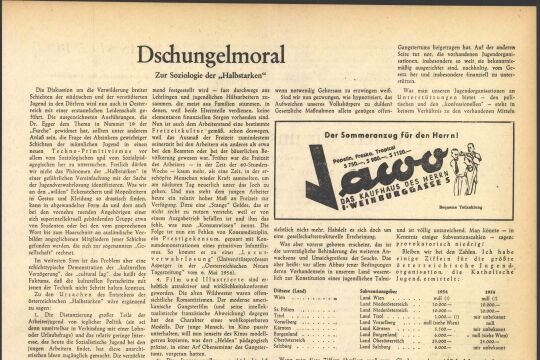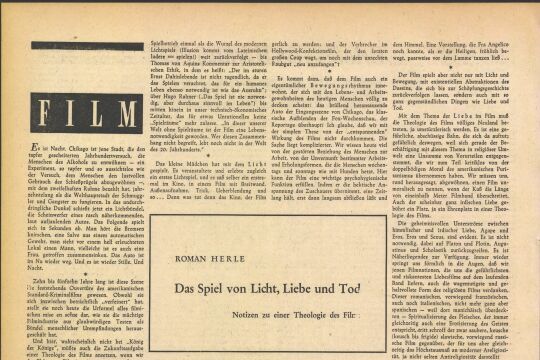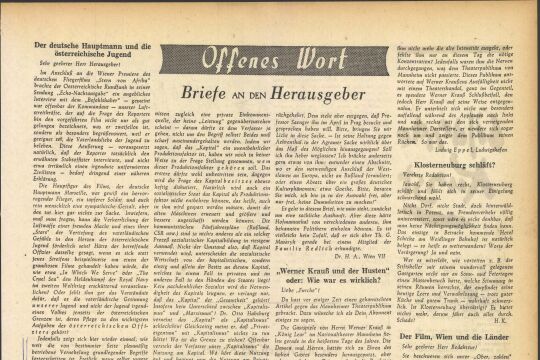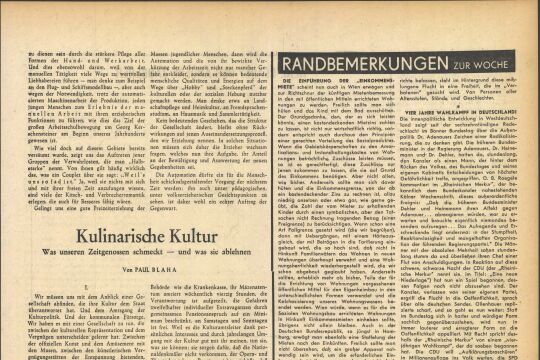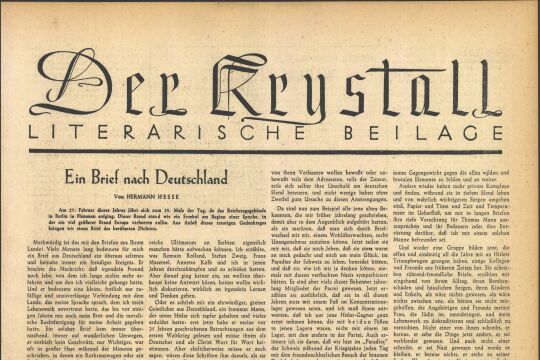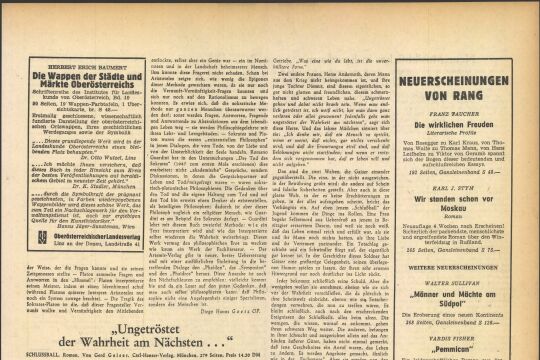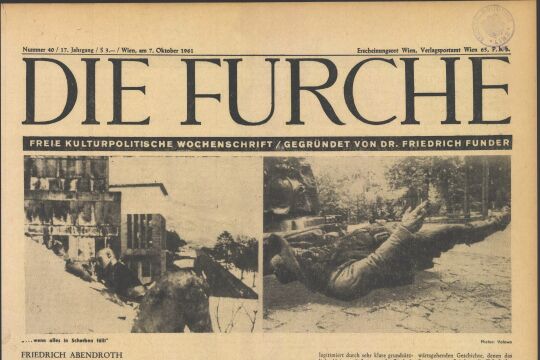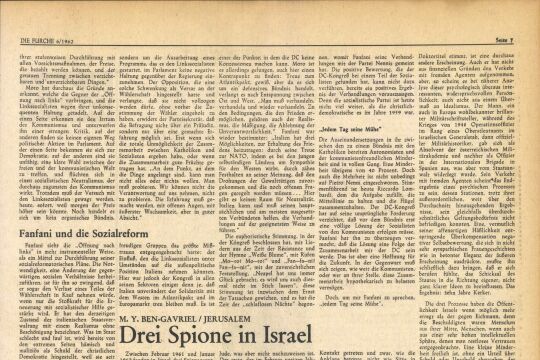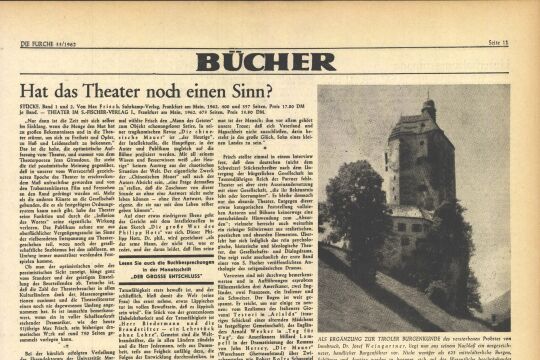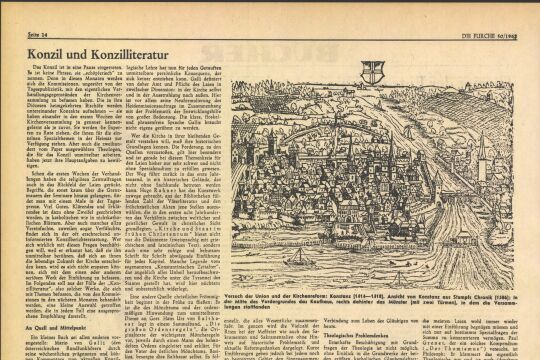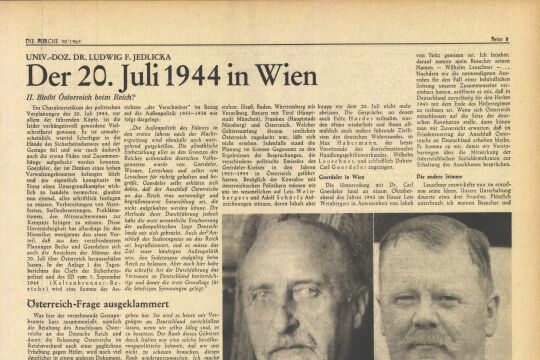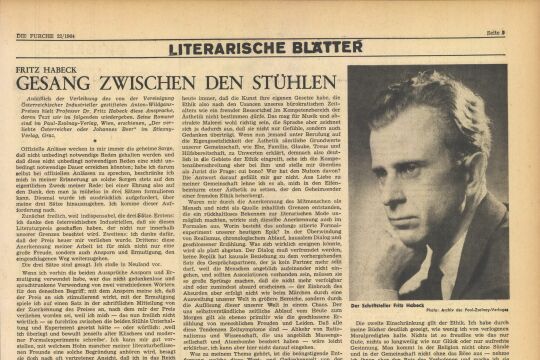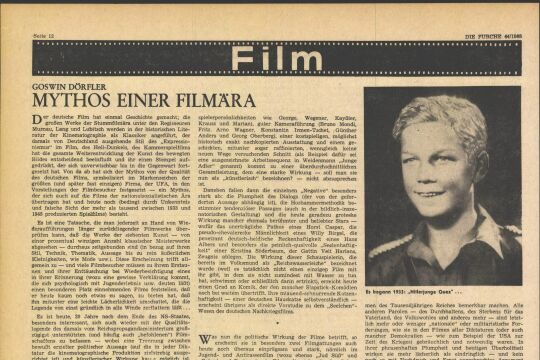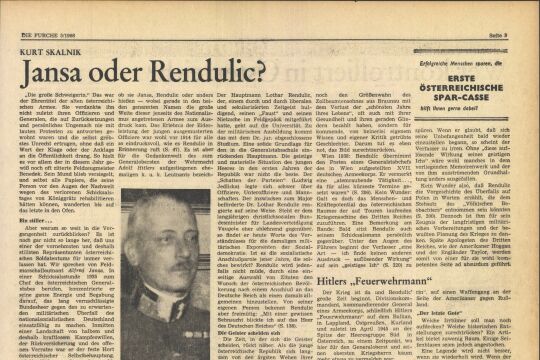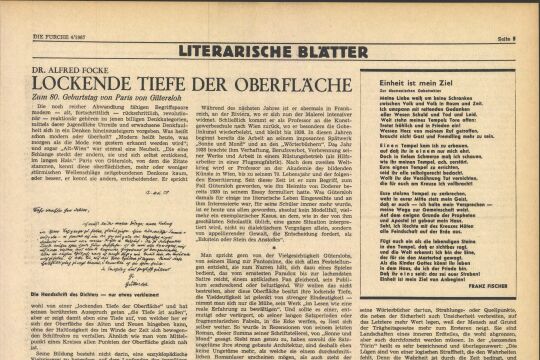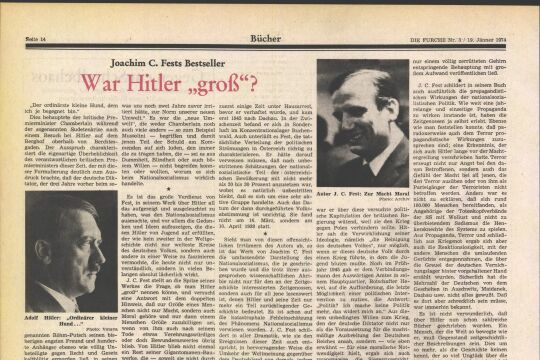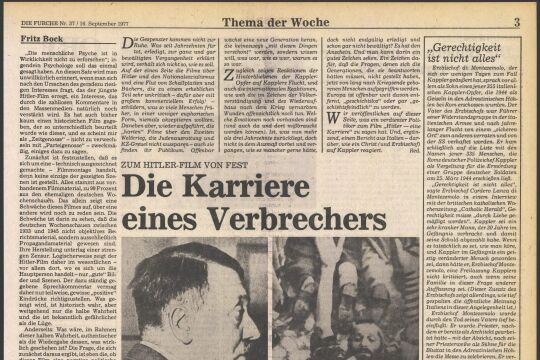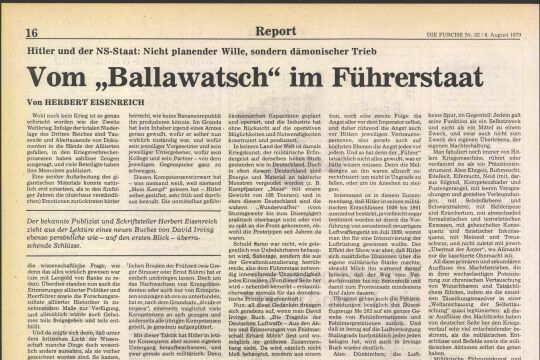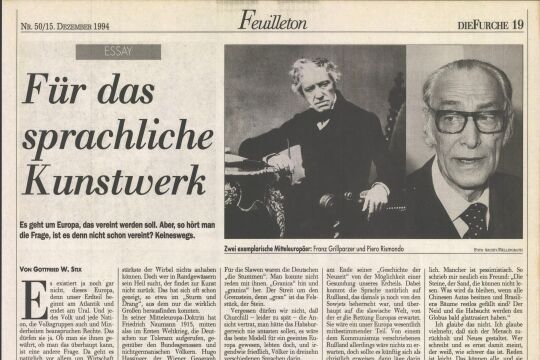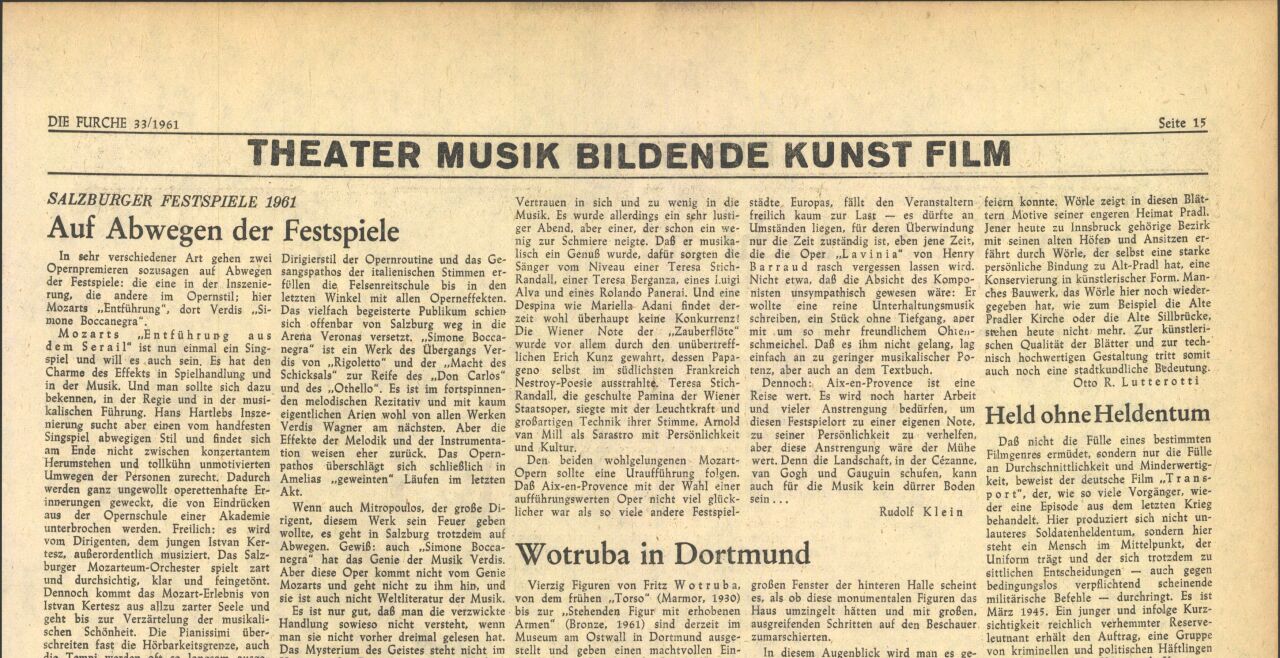
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Held ohne Heldentum
Daß nicht die Fülle eines bestimmten Filmgenres ermüdet, sondern nur die Fülle an Durchschnittlichkeit und Minderwertigkeit, beweist der deutsche Film „T r a n s- p o r t“, der, wie so viele Vorgänger, wieder eine Episode aus dem letzten Krieg behandelt. Hier produziert sich nicht unlauteres Soldatenheldentum, sondern hier steht ein Mensch im Mittelpunkt, der Uniform trägt und der sich trotzdem zu sittlichen Entscheidungen — auch gegen bedingungslos verpflichtend scheinende militärische Befehle — durchringt. Es ist März 1945. Ein junger und infolge Kurzsichtigkeit reichlich verhemmter Reserveleutnant erhält den Auftrag, eine Gruppe von kriminellen und politischen Häftlingen in der Endphase des Krieges als Kanonenfutter zu einem „Bewährungsbataillon" zu überstellen. Der bunte Haufen weiß nur zu genau, daß dieser letzte Einsatz fast gleichbedeutend mit dem Tod ist. Vom ersten Augenblick an beabsichtigt dieser „Transport“ zu flüchten, denn die Chance, zu überleben, ist gleich null. Die nahenden Amerikaner allerdings könnten vielleicht Rettung und tatsächliche Freiheit bedeuten. Der Leutnant, dem sein Kommandant nicht ohne Sadismus diesen schwierigen Auftrag erteilt, weiß, daß die Nichtbefolgung dieses Befehls seinen Kopf kosten kann. Er, der Schulmeister im Zivilberuf, hatte nie den Ehrgeiz, ein Held zu sein. Er sah auch in den Mannschaften und Gefangenen nie lediglich eine militärische Einheit oder Verbrecher, sondern . eben Menschen. Aus dieser Haltung heraus gewinnt er in dem gärenden Haufen zu allem bereiter, abgebrühter Gefangener bald ehrliche Helfer, und die erste Bewährungsprobe — einen Tieffliegerangriff auf den Transportzug — kann er bestehen. Immer mehr wächst er mit seiner Aufgabe, ringt sich aWh schliefilitfli kenirttrls seiber' persönlFchfctf Pflicht aisjÄ- seits von Phrasen und bequemer Befehlsautomatik durch. Man verzeihe dem Streifen manche reißerhaften Ansätze und besonders die Verfolgung in der Schlußphase, denn sie schränken die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Problem nur unwesentlich ein. Hannes Messemer spielt den Leutnant mit sparsamen und doch eindringlichen Mitteln, und man glaubt ihm seine Überzeugung, daß ein Befehl niemals einen Mord decken kann.
Wesentlich anders steht es um den französisch-japanisch-italienischen Streifen „W er sind Sie, D r. Sorge?“. Die zwielichtig schillernde Figur des bekannten Meisterspions Dr. Sorge wurde schon seinerzeit von Veit Harlan allzu wohlwollend und unsachlich filmisch interpretiert. Der französische Regisseur Yves Campi scheint von dem überreichen und widersprechenden Material erdrückt worden zu sein, denn sein Film ist, trotz mancher formaler Vorzüge, zu verwirrend, um tatsächlich besonderes Interesse erlangen zu können. Die eigentliche Frage, die der Film stellt, nämlich ob Dr. Sorge überhaupt damals hingerichtet wurde oder ob er noch lebt, bleibt unbeantwortet. Letztlich ist auch diese Frage nicht so entscheidend und die Person dieses Mannes heute längst nicht mehr so wichtig wie zur Zeit seiner hier geschilderten Tätigkeit. Die Sowjets, denen er als, überzeugter Kommunist diente, ohne anfangs so recht Glauben zu finden, denn seine Warnung vor dem bevorstehenden deutschen Angriff soll ja nicht ernst genommen worden sein, haben inzwischen sicher Generationen von bestausgebildeten Agenten in alle Welt geschickt, ohne einem Dr. Sorge nachzutrauern. Es ist das Schicksal dieses anrüchigen Gewerbes: Ist der Auftrag erfüllt, ist oft auch das Werkzeug verbraucht und wird zum alten Eisen gelegt oder liquidiert.
Die Wiener Stadthalle, das vielseitige Paradestück der Wiener Gemeindeverwaltung, tritt nun auch als Filmproduzent auf und beschert uns einen Franz-Antel-Film „und du, mein Schatz, b e i b s t hier“. Die Geschichte handelt nach abgebrauchter Schablone von einem Studentenjazzorchester, das mit aller Gewalt eine Chance bekommen möchte, um in einer großen Show herauszukommen. Viel besser als der beklagenswert untalentierte Nachwuchs schneidet die alte Wiener Komikergarde ab, allen voran Hans Moser, dann Paul Hörbiger, Rudolf Carl und Hans Olden, zusammen mit Josef Egger. Die in die Handlung eingebaute Monsterveranstaltung der Stadthalle mit einer Reihe von Schallplattenstars wirkt infolge der einfallslosen Regie und Ka- nera und vielleicht auch auf dem schwarzweißen Filmstreifen wenig ansehnlich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!