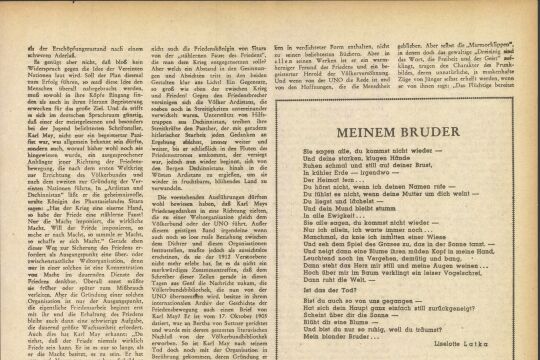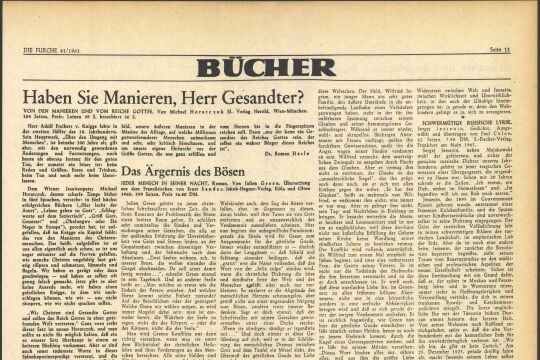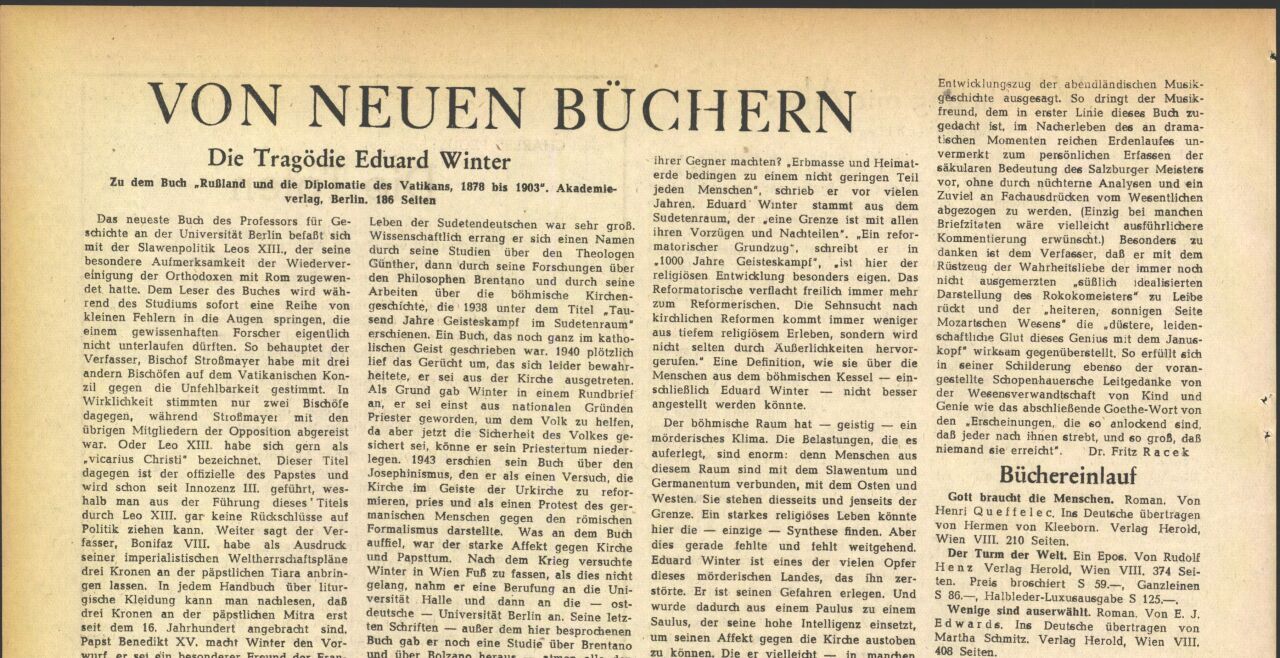
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ironie der Distanz
Der neue Roman Thomas Manns überrascht durch den Vorwurf: es ist die von Hartmann von Aue nach einer altfranzösischen Vorlage gestaltete Erzählung vom heiligen Gregor auf dem Steine. Gregor, von Geschwistern erzeugt, vermählt sich unwissend seiner Mutter, büßt, als er dessen inne wird, auf einem Feslen im Meere und wird nach siebzehn Jahren auf den Thron Sankt Peters erhoben. Mutter und Sohn begegnen einander wieder im Bereich der Gnade; wie
Sie sich nach großer Schuld Erwarben Gottes Huld ist der Inhalt des alten Gedichts von der gewaltigen Macht der Buße und abgründiggöttlicher Führung.
Thomas Mann läßt einen irischen Mönch im Kloster St. Gallen berichten, über den der „Geist der Erzählung“ kommt: „Nur ich, als alles vorwissender Erzähler, bin vollkommen heiter und unbekümmert“, sagt der Mönch gegen Ende. Diese Heiterkeit ist mit großer Kunst über das Ganze gebreitet, ein fein gewirktes Gespinst aus Ironie, das das Untragbare, Unaussprechliche leicht verhüllt; es ist die Ironie der Distanz, nicht allein zu den Personen und der Handlung, sondern auch zu den Glaubenswerten, die dieses entsetzliche Mysterium der Gnade allein erhellen können. Die Vorgänge spielen in frühchristlicher Zeit, aber durch den Erzähler in Sankt Gallen werden sie in die Empfindungs- und Formenwelt des hohen Mittelalters übertragen, dessen Ära Thomas Mann in einer großen Gestaltung noch nicht betreten hat. Es ist eine Ära der Uberfeinerung, ein Ubergang zwischen Form und Manier, zwischen Glaube und Skepsis, von gläserner Zerbrechlichkeit; aber hinter diesem vom Dichter mit Hingabe und allem Aufgebot ungewöhnlicher stilistischer Mittel, aus einfühlendem Wissen gestalteten Formen glüht verzehrende Sinnenlust und, in den tieferen Regionen des Personenkreises, dumpfe Gier.
Geschwisterliebe Ist letzte Form satanischer Selbstliebe; die Schwester liebt im Grunde nicht einmal mehr den Bruder, sie liebt sich in ihm, der Bruder liebt sich selbst in der Schwester, wie er sich in der Mutter liebt und die Mutter sich liebt im Sohn. Der Fluch dieser Selbstliebe treibt immer tiefer in die Sünde hinein, und es soll nur dargestellt werden, wie die Sünde die Gnade gewissermaßen herausfordert, Gnade zunächst als Buße, auf die sich die von Anfang geschehene Erwählung dann vollzieht. Die Erwählung geht über alle Vernunft: „Der Erwählte muß auch glauben, so schwer es ihm fallen möge. Denn alle Erwählung ist schwer zu fassen und der Vernunft nicht zugänglich.“ Die Erwählten — denn auch die Mutter ist erwählt — haben keinen Platz unter Menschen, in der irdischen Ordnung;' denn ihr Platz ist „über ihnen allen“, aber „sehr wohl kann aus dem Schlimmen die Liebe kommen und aus der Unordnung etwas sehi Ordentliches.“ Dies geschieht, weil in der Sünde ein „Schmachten“ ist.
Wer diese Idee so ernst nimmt, wie sie genommen werden will und muß, der muß an Takt und Ernst des Erzählers gewisse unabweisbare Forderungen stellen. Clemens, der irische Mönch in Sankt Gallen, bekennt jedoch: „Sehr oft ist das Erzählen nur ein Substitut für Genüsse, die wir selbst oder der Himmel uns versagen.“ Und er hält sich wahrlich an dieses Bekenntnis, dessen Wahrhaftigkeit nicht im mindesten angezweifelt werden soll. Flaubert hat in den „Trois Contes“ Heiligengeschichten erzählt, ohne zu glauben, aber er hat sie in eine Form gefaßt, in der sie auch den Gläubigen erreichen, erschüttern. Das ist hier nicht geschehen, wohl auch nicht gewollt — es bleibt bei einem Widerspruch zwischen dem Ernst der Idee auf der einen Seite und der Artistik und den Genüssen, die sich der Mönch Clemens verschafft, auf der anderen. Einmal ist es, als leuchte der warme Schimmer der Legende auf. Da die den künftigen Papst Suchenden durch ein Wunder in der Fischerhütte auf seiner Spur bestätigt werden, heißt es von der frrau des Fischers: „Wie die nämlich da kniete, unterm Kinn die Hände gefaltet, war ihr Herz so voll von Glauben und Glück, daß es deutlich um ihren Kopf herum etwas heller war als sonst im Funzeldunkel der Stube.“ Die Geschichte von Gregorius auf dem Steine hätte wohl nur in diesem Stile erzählt werden können.
Reinhold Schneider
Wolfgang Amadeus Mozart. Von Roland Tenschert. Verlag Karl Gordon, Salzburg 1951. 152 Seiten mit einer Farbtafel und elf Kunstdruckbildern, vier Faksimiledrücken und einer Notenbeilage (erste Druckveröffentlichung des vom Verfasser als Mozart-Komposition agnoszierten „Marche funebre“ aus dem Stammbuch der Babette Ployer).
Dies i6t das einfache Geheimnis der ewig jungen Kunst eines „Götterlieblings“: weil sie eich „in jeder Epoche neuartig spiegelt und zugleich auch individuell befruchtend wirkt, veraltet sie nicht, sondern bleibt stets lebhaften Anteils aicher“. Aus dieser Erkenntnis schöpft Tenschert den Antrieb, der umfangreichen Mozart-Spezialliteratur einen neuen Beitrag zuzugesellen. Daß es ihm hie-bei gelingt, auf verhältnismäßig engem Raum die schier unendliche Vielfalt der Erscheinungen, die zusammen den Begriff „Mozart“ formen, zu überzeugender Einheit zusammenzuschließen und seine eigene „Liebe, Verehrung und Bewunderung für den Genius“ auch im Herzen des Lesers zu entzünden, rechtfertigt vollends die empfehlenswerte Neuerscheinung, an deren Ausstattung der Verlag alle erdenkliche Sorgfalt wandte. Der Autor stützt sich vor allem auf sein eigenes vor zwanzig Jahren als ereter Band von Reclams Mu6ikerbiographien erschienenes Mozart-Budi, das er mit Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse einer durchgreifenden Neugestaltung unterzieht, wobei sorgfältig ausgewählte Briefzeugnisse die warmherzige Darstellung in große Lebensnähe rücken. Obwohl das Biographische durchaus den Gang der Schilderung bestimmt, ist in knappen Sätzen jeweils Hinreichendes über die einzelnen Werke, ihre Stellung im Mozartsdhen Gesamtscfaaflen and im großen
Entwicklung»>zug der abendländischen Musik-gesdiichte ausgesagt. So dringt der Musikfreund, dem in erster Linie dieses Buch zugedacht ist, im Nacherleben de6 an dramatischen Momenten reichen Erdenlaufes unvermerkt zum persönlichen Erfassen der säkularen Bedeutung des Salzburger Meisters vor, ohne durch nüchterne Analysen und ein Zuviel an Fachausdrucken vom Wesentlichen abgezogen zu werden. (Einzig bei manchen Briefzitaten wäre vielleicht ausführlichere Kommentierung erwünscht.) Besondere zu danken ist dem Verfasser, daß er mit dem Rüstzeug der Wahrheitsliebe der immer noch nicht ausgemerzten „süßlich idealisierten Darstellung des Rokokomeisters“ zu Leibe rückt und der „heiteren, 6onnigen Seite Mozartschen Wesens“ die „dü6tere, leiden-schaftlidie Glut dieses Genius mit dem Janus-kopf“ wirkbam gegenüberstellt. So erfüllt sich in seiner Schilderung ebenso der vorangestellte Schopenhauersdie Leitgedanke von der Wesensverwandtschaft von Kind und Genie wie das abschließende Goethe-Wort von den „Erscheinungen, die so anlockend sind, daß jeder nach ihnen strebt, und 60 groß, daß niemand sie erreicht“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!