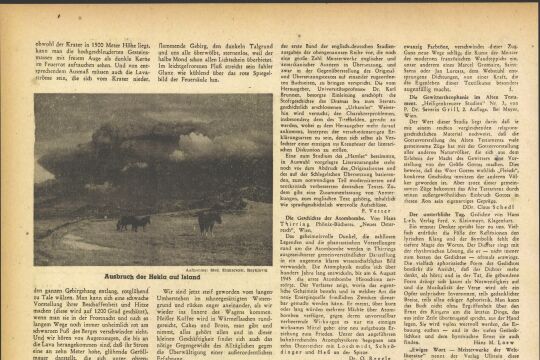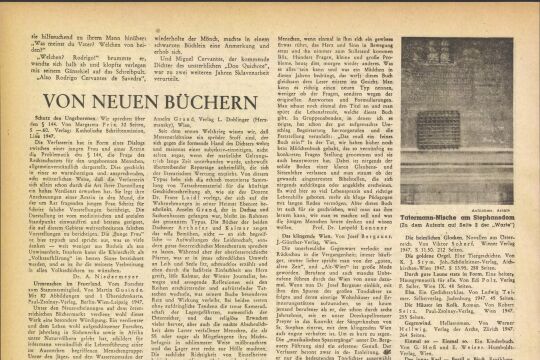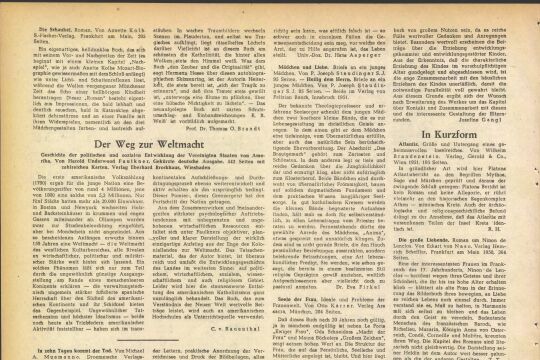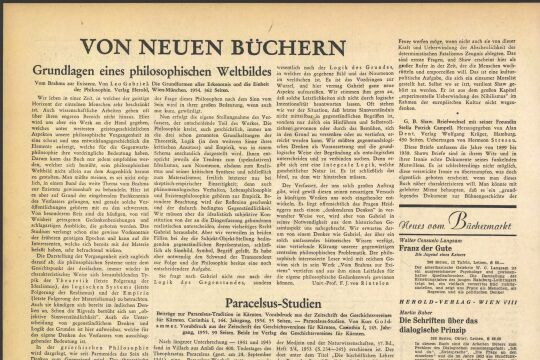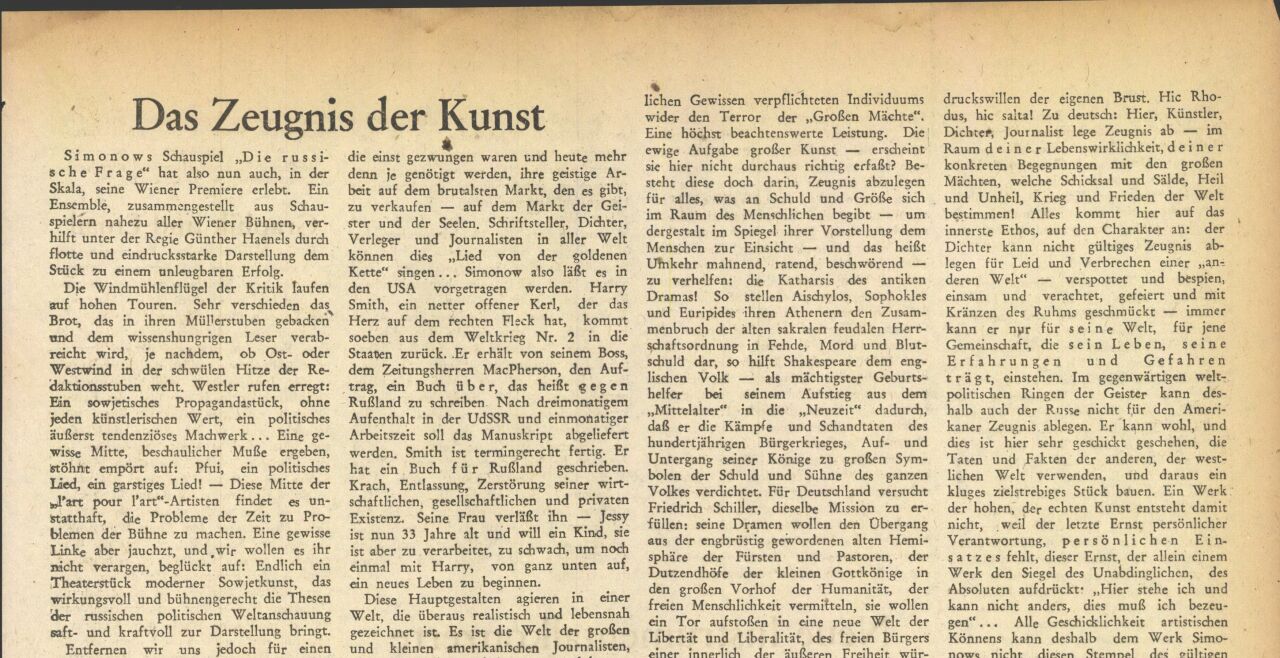
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Menschen und Masken
Wien sah in diesen Tagen die Premieren von drei „Lehrstücken", deren didaktischer %weck, die „Erziehung“ des Publikums, unverkennbar ist. Alle drei mit recht bemerkenswerten Absichten, alle drei gut gespielt, alle drei ein Erfolg. Eine seltene Woche! Beginnen wir mit dem schwächsten, weil inhaltlich brüchigsten Stück, mit Shaws „Mensch und Übermensch“. Leon Epp bringt es in einer sehr gepflegten, sehr sorgfältigen Aufführung in der „I n s e 1", weldie damit ihren erfolgreichen Shaw- Zyklus fortsetzt, heraus. Dieser Shaw von 1903 ist ein von seinen angelesenen Ideologien besessener Experimentator. Er experimentiert mit dem kostbarsten Versuchsmaterial — mit dem Menschen. Da die harte Zucht, die innere Starrheit, die erstaunliche Widerstandsfähigkeit der englischen Gesellschafts- und Lebensordnung es Shaw nicht gestattet, wie Hitler und Mussolini (als deren ideologischer Wegbereiter er sich gerade in diesem Stück offensichtlich erweist), mit dem Menschenmaterial auf der Bühne der Weltgeschichte Operationen erstaunlichsten und schauerlichsten Ausmaßes anzustellen, bleibt ihm, wie vielen seinesgleichen, nur die Bühne. Ein dankbares Thema für eine größere Untersuchung: die ausschweifende Exzentrik,
Phantastik und Gedankenakrobatik vieler angelsächsischer Autoren beruht nicht zuletzt auf der massiven Tatsache, daß die Stabilität der politischen und gesllschaftlichen Ordnung ihrer Hemisphäre Parforcereiter der Weltgeschichte, verkrachte Schauspieler, wie den falschen Zollemprinzen Harry Domela den Hauptmann von Köpenick und den Gefreiten von Braunau, nicht erträgt. Also: die Bühne! Hier trägt Shaw seinen „Katechismus des Umstürzlers" vor. Die romantische
Vitalismuslehre. des 19. Jahrhunderts, in Nietzsche und Bergson zu ungeahnter Explosivstärke reifend, ist die Großmutter der „Lebenskraft“-Theorie Shaws. Der höhere Mensch ist zu züditen — siegreich setzt sich wider gesellschaftliche Konvention und persönlichen Einspruch die List dieser Großmutter durch. In Shaws Exempel: der allzu kluge John Tanner, der reiche Taugenichts und Salonsozialist der Fabier-Zeit, muß also dieses kleine listige Ding, Anne Whitefield, heiraten. Vergebens hat er sich als ihr Vormund und philosophierender Freund zu tarnen gesucht — das Frauchen verfolgt ihn bis in die Wüsten des finsteren Spaniens. Die Lebenskraft will es ... Auf dem Höhepunkt dieser Menschenjagd (im Stil von 1903) schaltet Shaw eine Traumszene ein — in der Hölle, welche die „Insel“ mit Recht im Stil eines zwischen Chirico und Salvadore Dali schwebenden Surrealismus dekoriert. Diese Kunstexperimentatoren der vierziger Jahre sind die echten Erben des Ideenexperimentators Shaw, der so tut, als ob er im Jahre Null agieren könnte, als ob nicht die Menschen seiner Zeit konkret.einzustehen hätten für das, was ihre Väter getan, was ihre Söhne vertun werden. Shaws Jahr Null ist eben doch das Jahr 1900 — und so steht zwischen ihm und seinen surrealistischen Erben als Zwischenspiel das Großexperiment jener Ver. Sucher, welche ganze Völker und Welten zu ihren Experimenten mißbrauchen. Dies muß man im Auge haben, wenn man Shaws artistische Spielereien um Himmel und Hölle in obgenannter Höllenszene verstehen will. Gott sei Dank bleibt es nicht bei den Spiegelfechtereien mit den Rapieren aus der Mottenkiste der ideologischen Großmutter „Lebenskraft“. Mutter dieser Bühnenmen- sdien aus „Mensch und Übermensch“ bleibt doch Shaws gesunder Mutterwitz. So entsteht ein Spiel vom „Kampf der Geschlechter“, nicht so tief wie bei Strindberg, nicht so echt wie bei den großen Russen, aber doch noch: ein echter Shaw.
Wider die These vom „Kampf der Geschlechter“ kämpft J. B. P r i e s 11 e y in seinem höchst moralischen und amüsanten Bildtraktat „Ever since Pw. r a d i s e“ (im HolzkniippeJldeutsch der Titelübertragung: „S it Adam und Ev a“), dessen österreichische Uraufführung das KleineHaus der Josefstadt übernommen hat. Priestley, der jüngeren Generation jener englischen Kathedersozialisten entstammend, zu denen einst auch Shaw nach seinen ersten Flegeljahren stieß, ist hier Lehrer von Beruf und Berufung. Ein sehr charmanter, sehr menschlicher Herr Lehrer, der seinen schwierigen Schülern und Schülerinnen, welche sich seit 8 bis 80.000 Jahren bemühen, eine der schwersten Schulaufgaben des Lebens, die Führung einer guten Ehe, zu erlernen, hilfreich zur Seite stehen will. Priestley schlägt ein musikalisches Bilderbuch auf, in dem drei Paare, ein verlobtes, ein noch verheiratetes und ein geschiedenes, drei Ehen zusammen-reden und zusammen-spielen. Die Heilslehre einer Zwei- bis Drei-Zimmer- Wohnurtg: seid rücksichtsvoll zueinander, als Mann und als Frau, als Gatte und als Gat-, tin, eckt nicht bei den Schwächen und Müdigkeiten eures Lebens- und Wohnungspartners an, gewährt euch gegenseitig eine gewisse Schonzeit! Achtet euer Eigen- und Innen leben, nützt eure Gefühle und Stimmungen nicht, wie eure Möbelgarnituren, frühzeitig ab. Mit Takt und Geschmack, etwas Klugheit und Commonsense lassen sich viele Schwierigkeiten meistern: eine Apotheose also des gesunden englischen Hausverstands, der sich hier wahrhaftig als Haus-Verstand bewährt. So. wie er hier auf der Bühne in der Liliengasse seine Befähigung erweist, Risse im Gebäude des menschlichen Innenlebens zu verkitten, hat er ja, im Bau des Empire und in der englischen Weltpolitik, sich oft und olt redlich gemüht, auch größere Bruchstellen zu heilen: wir verstehen, daß diese Aufführung unter der Patronanz der österreichisch-britischen Gesellschaft stattfindet.
Unter der Patronanz der Menschheit sollte jedoch jenes Thema stehen, das Hans M ü 11 e r - E i n i g e n "in seinem Stück „D e r Helfer Gottes“ behandelt. Der Autor nennt sein Drama einen „Kampf um die Liebe in zehn Stationen“, der Hauptaktor des Stücks bezeichnet sein Leben in der real- politischen Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts als „Tragödie der Vergeblichkeit“. — Es kommt vor, daß Menschen durch ein einmaliges Erlebnis völlig aus der scheinbar geradlinig vorgezeichneten Bahn ihres Lebens gerissen werden: eine große Liebe, eine tiefe Freude, ein Gewittersturm, -eine Frühlingslandschaft, der Fall eines Apfels im Garten, das Schwingen eines Pendels, das Zucken eiiles Froschschenkels — und Dichter und Denker, Erfinder und Naturforscher werden zu ihrem eigentlichen Beruf erweckt. Das erste Erleben eines Dante, Luther, Leonardo, Newton, Galilei und Volta schwingt dann nach, überglänzt und überschattet alle Taten und Wege eines Menschenlebens, das zu einmaliger Bedeutung in der Geschichte der Menschheit aufsteigt, weil es einmal ganz offen stand, ganz Hingabe an die Gnade einer Stunde war. Diese Stunde, die den Menschen früherer Epochen in der Kirche, in der mönchischen Zelle, in der Studierstube, im Garten, im schön geschlossenen Kreis engeigenen Lebens traf, trifft den Sohn des 19. Jahrhunderts auf dem Schlachtfeld. Der Genfer Bürger und Bankier Henri Dunant findet seine „große Liebe“ am 24. Juni 1859 in Sol- ferino: es ist der Schmerz, das Leid, der Tod seiner Mitmenschen.
Dunant, der Sohn einer freien, zur Selbstverantwortung erzogenen Bürgergemeinde einer Stadt, welche durch Calvin, J. J. Rousseau und Franz von Sales unauslöschliche Stigmen eines weltumfassenden Aktivismus des Glaubens, der Menschlichkeit und der Liebe empfangen hat, wird angesichts der Elenden und Sterbenden des Krieges kein larmoyanter Dichter, der sich in Ressentiment, Weltschmerz und schöngeistiger Eigensucht verschließt; kein E en- ker, der eitle, mit eigenem und fremdem Schmerz schauspielemdc Philosopheme des
Nichts, der Verzweiflung, des „Als-ob“, des „Trotzdem“, des „Ich-allein“ erfindet, wie so viele störische ungute Geister vor, nach und zwischen den letzten Kriegen ... Dunant bückt sich — und beugt sich unter das Leid seiner Mitmenschen, aller Kriegs- und „Friedens“- versehrter dieser Erde — und nimmt, als Atlas einer neuen Menschheit, diese bittere Bürde auf sich. Er wird sie nie wieder los werden. Wohl gelingt ihrr die Gründung des „Roten Kreuzes“ — fünf Jahre nach Solferino treten zwanzig Nationen der Genfer Konvention bei. Die Kriege der nächsten Jahre — zumal jene von 1866 und 1870 — zeigen jedoch Dunant, daß diese wohltätige Gründvng für viele ein Beschwichtigungsmittel — ein Beruhigungsmittel für charpiezupfende Damenseelen, zudem ein willkommenes Institut für kühlplanende Strategen des Zukunftskrieges, welches ihren Planungen höhere Sicherheit garantieren soll, geworden ist. Entsetzt sieht Dunant, wie der böse Stern der Zwietracht, der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung immer höher auf teigt über dem Horizont des Abendlandes. Nein, mit Friedenskonferenzen und schöngeistigen Reden, mit Wohltätigkeits Veranstaltungen und
Rot-Kreuz-Binden läßt sich der Dämonie des entfesselten Jahrhundetxs nicht beikommen: verarmt, verfemt, aus der
„guten Gesellschaft“ seiner Zeitgenossen ausgestoßen, stirbt Dunant im Armenhaus Heiden im Appenzellischen.
Um diese Tragödie eines Gott- und
Menschensuchers des 19. Jahrhunderts hat Müller-Einigen ein sehr achtbares Stück geschrieben. Gewisse Sentimentalitäten, Deh nungen und Kniffe des bühnenkundigen Routiniers wirken hier und dort störend. Wolfgang Heinz, als Regisseur, hat jedoch viel getan, um den starken Fluß des tatsächlichen Geschehens auch auf der Bühne möglichst ungehemmt strömen zu lassen. Die „Himmelfahrt“ am Schluß wäre besser unterblieben — hier stünde besser die zu verändernde Eingangszene, zumal mit den Worten des „Sprechers des deutschen Volkes“. Gerade im Geiste Dunants würde dann an die Stelle einer doch recht billigen Poetisierung, Verniedlichung und „Verschönerung“ des harten leidvollen Geschehens noch einmal ein sehr ernster Anruf treten — der Ruf nach Gerechtigkeit —, dem auf dieser Welt einzig und allein die Tat der Liebe Rede und Antwort stehen kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!