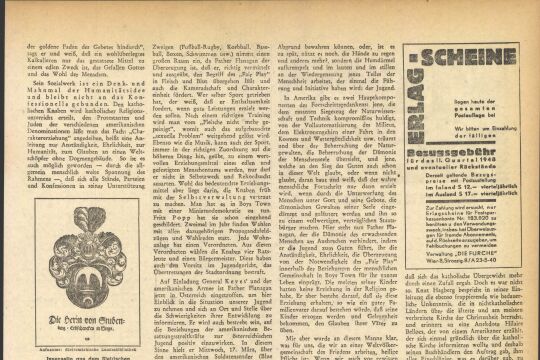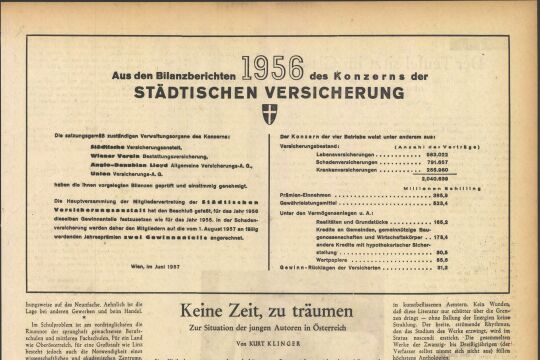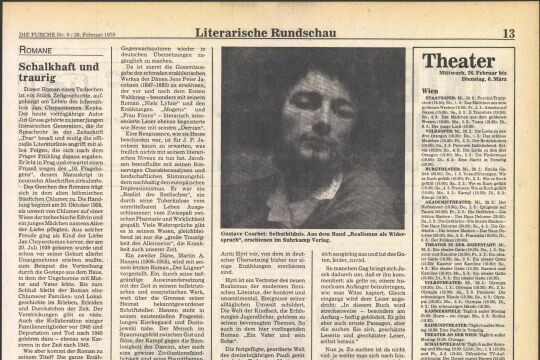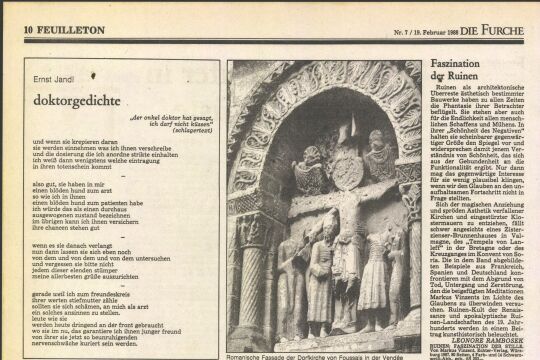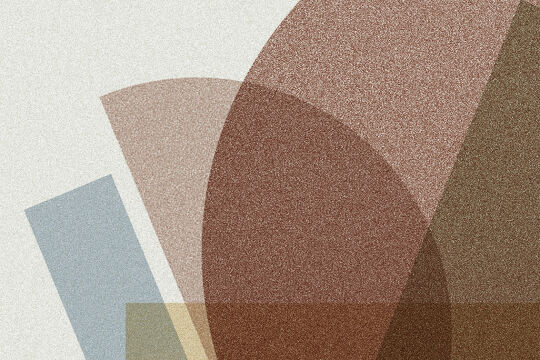Preis der Leipziger Buchmesse: "Echos Kammern" von Iris Hanika
Eine Auseinandersetzung mit dem Mythos von Echo und Narziss sowie Stadterkundungen in New York und Berlin ziehen sich als roter Faden durch Iris Hanikas Roman „Echos Kammern“, für den sie am 28. Mai den Leipziger Buchpreis erhalten hat.
Eine Auseinandersetzung mit dem Mythos von Echo und Narziss sowie Stadterkundungen in New York und Berlin ziehen sich als roter Faden durch Iris Hanikas Roman „Echos Kammern“, für den sie am 28. Mai den Leipziger Buchpreis erhalten hat.
Der diesjährige Preis der Leipziger Buchmesse geht also an die deutsche Autorin Iris Hanika. Pandemiebedingt hat die Verleihung Ende Mai und nur virtuell stattgefunden. Hanika hat sich im Bereich Belletristik vor Friederike Mayröcker, Christian Kracht, Judith Hermann und der letztjährigen Bachmannpreisträgerin Helga Schubert durchgesetzt. Diese Shortlist ist damals unmittelbar nach ihrer Bekanntgabe in einem offenen Brief kritisiert worden. Darin heißt es, dass die Auswahl Diversität vermissen lasse, obgleich es sich bei allen Nominierten zweifellos um „hochverdiente Autor:innen“ und „würdige Preisträger:innen“ handle.
Auch Hanikas Roman „Echos Kammern“, der im vorigen Sommer im Droschl-Verlag erschienen ist, wurde vom Feuilleton durchwegs sehr positiv aufgenommen und war in den letzten Monaten immer wieder auf diversen Bestenlisten zu finden. Die Buchpreis-Jury spricht von einem „herrlich palimpsesten Roman“, in dem „es blitzt und spiegelt“ und in dem „nur so vor sich hin“ experimentiert werde. Gerade der experimentelle Charakter dieses Textes muss tatsächlich besonders unterstrichen werden. Denn Hanika geht es vordergründig weniger um kontinuierliche Handlungslinien als vielmehr um Blitzlichter auf Umstände, historische und gesellschaftspolitische Verflechtungen, um Denkweisen, Stimmungen, Erfahrungen oder psychologisch durchleuchtete Verhaltenstableaus. All dies findet sich in dieser Prosa innovativ miteinander verschmolzen und auf sehr anregende Weise zusammengefügt.
Leidenschaftliche Flaneurin
In einem bunten Wechsel von auktorialen Erzählerpassagen, Zitaten, E-Mails, Ausschnitten aus fiktiven Binnentexten, Manuskripten oder Verszeilen lässt Hanika die Dichterin Sophonisbe in den Vordergrund treten. Ihr Name geht auf ein Selbstporträt einer gewissen Sofonisba Anguissola aus dem 16. Jahrhundert zurück, das heute im Kunsthistorischen Museum in Wien betrachtet werden kann. Ungewöhnlichen Namen kommt hier überhaupt eine Schlüsselrolle zu. Die leidenschaftliche Flaneurin Sophonisbe wird zur zentralen Verbindungsfigur, auch wenn es nicht immer um sie geht.
Zwei wichtige Bezugspunkte bilden die Städte New York – hier nimmt die Prosa ihren Ausgang und hierher führt sie am Ende auch wieder zurück – und Berlin. Sophonisbe arbeitet gerade an einem Buch über New York, aber in einer eigenen Sprache (lengevitch), stets im Konflikt, ob sie eher Dichtung produzieren oder doch „Ratschläge [...] erteilen“ solle. Dazu muss sie erst einmal – eingehüllt in Fremdes und Multikulturalität – herausfinden, „wie die Stadt funktioniert“, die sie durch den Filter der Fremdsprache erlebt. Wohnen mit Blick auf eine Backsteinwand ohne Chance auf den Himmel, Aufstiegswunder und absolute Geldherrschaft lassen manche Viertel für viele als Wohngegend unerschwinglich werden. Nur selten gibt es Übriggebliebene, die sich nicht in die Riege der Reichen inmitten der Luxustempel einreihen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!