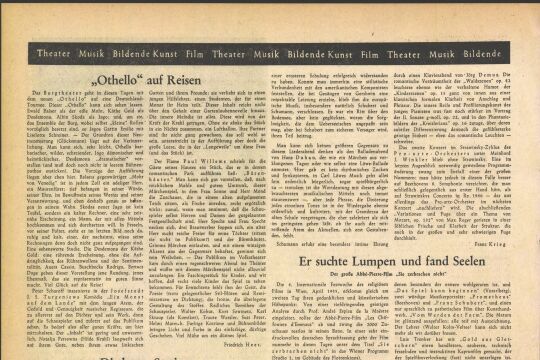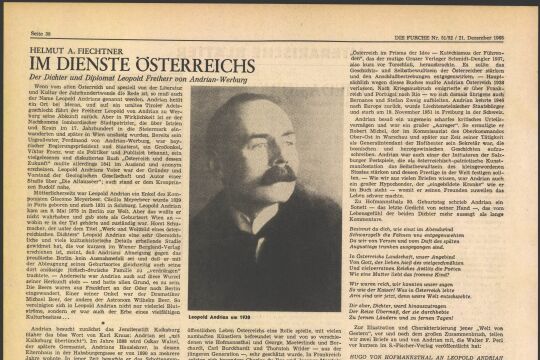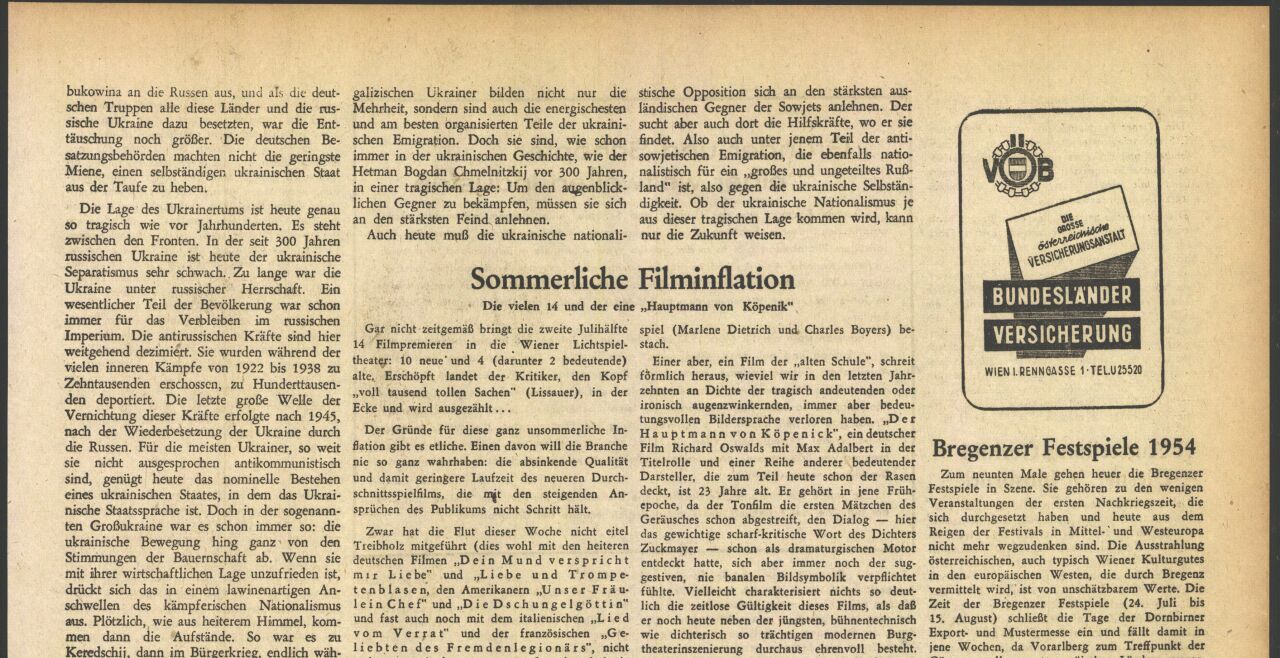
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sommerliche Filminflation
Gar nicht zeitgemäß bringt die zweite Julihälfte 14 Filmpremieren in die Wiener Lichtspieltheater: 10 neue’ und 4 (darunter 2 bedeutende) alte. Erschöpft landet der Kritiker, den Kopf „voll tausend tollen Sachen" (Lissauer), in der Ecke und wird ausgezählt
Der Gründe für diese ganz unsommerliche Inflation gibt es etliche. Einen davon will die Branche nie so ganz wahrhaben: die absinkende Qualität und damit geringere Laufzeit des neueren Durchschnittsspielfilms, die mjt den steigenden Ansprüchen des Publikums nicht Schritt hält.
Zwar hat die Flut dieser Woche nicht eitel Treibholz mitgeführt (dies wohl mit den heiteren deutschen Filmen „Dein Mund verspricht mir L i e be" und „Liebe und Trompetenblasen, den Amerikanern „Unser Fräulein Chef" und „Die Dschungelgöttin" und fast auch noch mit dem italienischen „Lied vom Verrat" und der französischen „Ge- liebten des Fremdenlegionärs", nicht mehr ganz mit der verworrenen Sexualpsychologie des französischen Films „Zur Liebe verdammt“); aber schon in „Bis 5 nach 12" (hier schon besprochen) reicht das Programm durch die Dämonie dieses politischen Dokuments über das Gewöhnliche des Filmalltags hinaus, noch mehr noch in „Mandy" (englisch), dem Verzweiflungskampf eines taubstummen Kindes gegen die Umwelt um Licht und Liebe und Leben, und dem italienischen, stellenweise, nicht ganz, geglückten Episodenfilm um die Wertherschen Leiden der Gegenwart: „M orgen ist ein anderer Tag".
Man hat natürlich auch früher schon Belanglosigkeiten gedreht; Reprisen wie „Q u a x, der B r u c h p i 1 o t“ (deutsch) und der amerikanische Film „Der Pirat und die Dame" beweisen das. Auch Filme wie „Der Garten Allahs" gab es schon, an denen nicht das (hier recht spinöse) Sujet, sondern lediglich das gelöste Star spiel (Marlene Dietrich und Charles Boyers) bestach.
Einer aber, ein Film der „alten Schule", schreit förmlich heraus, wieviel wir in den letzten Jahrzehnten an Dichte der tragisch andeutenden oder ironisch augenzwinkernden, immer aber bedeutungsvollen Bildersprache verloren haben. „D e r Hauptmann von Köpenic k", ein deutscher Film Richard Oswalds mit Max Adalbert in der Titelrolle und einer Reihe anderer bedeutender Darsteller, die zum Teil heute schon der Rasen deckt, ist 23 Jahre alt. Er gehört in jene Frühepoche, da der Tonfilm die ersten Mätzchen des Geräusches schon abgestreift, den Dialog — hier das gewichtige scharf-kritische Wort des Dichters Zuckmayer — schon als dramaturgischen Motor entdeckt hatte, sich aber immer noch der suggestiven, nie banalen Bildsymbolik verpflichtet fühlte. Vielleicht charakterisiert nichts so deutlich die zeitlose Gültigkeit dieses Films, als daß er noch heute neben der jüngsten, bühnentechnisch wie dichterisch so trächtigen modernen Burgtheaterinszenierung durchaus ehrenvoll besteht. Gewiß muß der weitgespannte Bogen Zuckmayers da und dort verkürzt werden (so begnügt sich der Film in den Porträts des verabschiedeten Gardeoffiziers oder des Schwagers Voigts mit einigen wenigen, allerdings immer scharfen Strichen), aber die Fülle an tragischen, delikaten oder satirischen Details, die er dafür bietet, ist immens. Vollends die Großaufnahmen Max Adalberts lassen das ganze Unglück der gequälten menschlichen Kreatur ahnen, wie sie auf der Bühne von Büchner zu Zuckmayer niemals sichtbar werden konnte. Stellt man sich vor, daß die moderne technische Entwicklung des Films dieses Prinzip der Großaufnahme einmal wird opfern müssen (Breitwand- und 3-D-Verfahren knabbern bereits am Damm), so kann man einigermaßen ermessen, über welche Opfer hinweg Filmtechnik und Filmwirtschaft von heute und morgen ihrer „Endstation Sehnsucht" zuhoppeln und -poppeln.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!