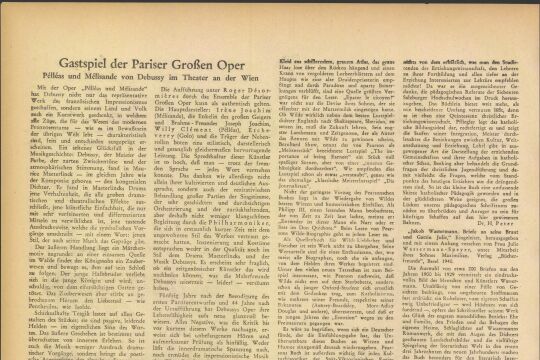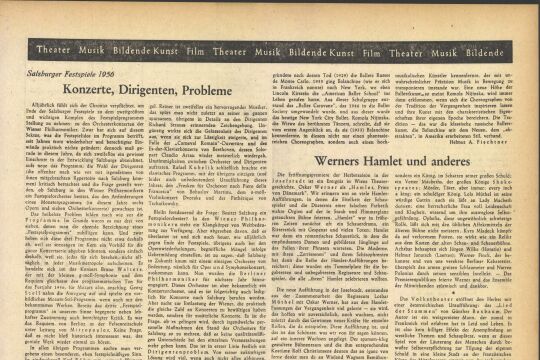Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ungewohnter „Hamlet“
Während der UrfauSt gelegentlich gespielt wird, kennen wir den UrHamlet nicht. Es ist das ein möglicherweise von Thomas Kyd in den achtziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts geschriebenes Stück, auf das vermutlich Shakespeares „Hamlet“ zurückgeht. Die „Historia Danica“ des Saxo Grammaticus aus der Zelt um 1200, In der die Begebenheiten um „Amleth“ erzählt werden, kannte Shakespeare vermutlich nicht, da sie, als er an dieser „tragischen Geschichte“ arbeitete, nur im lateinischen Original und in französischer Übersetzung vorlag.
Während der UrfauSt gelegentlich gespielt wird, kennen wir den UrHamlet nicht. Es ist das ein möglicherweise von Thomas Kyd in den achtziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts geschriebenes Stück, auf das vermutlich Shakespeares „Hamlet“ zurückgeht. Die „Historia Danica“ des Saxo Grammaticus aus der Zelt um 1200, In der die Begebenheiten um „Amleth“ erzählt werden, kannte Shakespeare vermutlich nicht, da sie, als er an dieser „tragischen Geschichte“ arbeitete, nur im lateinischen Original und in französischer Übersetzung vorlag.
Nun sieht man derzeit im Volksihea-ter einen auf dem Theater völlig ungewohnten „Hamlet“. Es wird der von Ludwig Berger übersetzte Text der Quartoausgabe aus dem Jahre 1603 gespielt, während die uns geläufige, ständig aufgeführte Fassung sich auf die Quarto 1604 und die Folio 1623, wie sie nach den Formaten genannt werden, stützt. Georg Brandes hatte vermutet, die Quarto 1603 sei eine Piratenausgabe, er spricht von einem „verhudelten und verdorbenen Text“, meint aber, die Unterschiede zu den Ausgaben 1604 und 1623 seien zu groß, um sie nur durch Nachlässigkeiten des Kopisten zu erklären. Goethe dagegen, der den Text 1603 las, bald nachdem er in England im Jahre 1821 gefunden worden war, bezeichnete ihn als „großes Geschenk“ und bewunderte „die Sicherheit der ersten Arbeit, die ohne langes Bedenken, einer lebendig leuchtenden Erfindung gemäß, wie aus dem Stegreif hingegossen erscheint.“
Der Text der Quarto 1603 hat etwa den halben Umfang des uns bekannten „Hamlet“, schwingt nicht so weit aus, wirkt konzentrierter, dramatischer. Hamlet ist hier nicht dreißig Jahre alt, sondern jünger, impulsiver, allerdings hat sein Erkenntnisdrang nicht die gleiche bohrende Intensität. Der berühmte Monolog „Sein oder Nichtsein“ — um dreizehn Zeilen kürzer — und die Szene mit Ophelia sind vor der Szene mit den Schauspielern und dem nachfolgenden Monolog „Welch ein Schurk und niedrer Sklav bin ich“ eingesetzt. Das Gebet des Königs — um 26 Zeilen kürzer — wirkt eindringlicher, die Gewissensnot des Brudermörders ist spürbar stärker. Während in den Fassungen 1603 und 1623 die Mitwisserschaft der Königin an der Ermordung ihres Gatten ungeklärt bleibt, weiß sie hier nichts davon und ergreift sofort die Partei des Sohns. Der Ablauf der Geschehnisse ist, von diesen Unterschieden abgesehen, der gleiche, mag auch der Tiefgang, der metaphysische Gehalt geringer sein. Doch das entspricht merkwürdig
einem heutigen Trend. Daß Hamlet mit dem Rachemord am König so sehr zögert, daran könnten Kommentatoren bei der Fassung 1603 ebenso unberechtigt herumrätseln wie bei der bisher gespielten. Unberechtigt, denn es ist gar nicht so selbstverständlich, wie es seltsamerweise immer wieder vorausgesetzt wird, dem Mörder des Vaters kurzerhand einen Dolch in den Leib zu stoßen. Der Geist des Vaters wie auch einst herrschende Auffassungen treiben Hamlet zur Rache, er glaubt, ihnen folgen zu müssen, vermag es aber nicht, denn' er ist bereits der Mensch einer späteren Zeit, für den Rache atavistisch wirkt. Nur in hitziger Zornaufwallung tötet er jäh, unbedacht.
Goethe hob hervor, daß in der Fassung 1603 keine Lokalität, keine Theaterdekoration festgelegt ist, und meint, „man nimmt sich die Zeit nicht, um an örtlichkeiten zu denken“. Und Strindberg fordert selbst für die Wiedergabe des bisher verwendeten Textes: „Keine Dekoration! Ein abstrakter Rahmen, der durch das ganze Drama stehen bleibt.“ Im Volkstheater dagegen wird das Stück in dem Bühnenbild von Hubert Aratym vor dem transparenten Schloßeingang gespielt, wobei die Bühne sonst neutral bleibt. Optische Widersprüche zu dialogbedingten örtlichen Fixierungen ergeben sich. Aratym entwarf auch die farbenprächtigen Renaissancekostüme. Regisseur Gustav Manker sorgt dafür, daß — nochmals Goethe — alles „unaufhaltsam seinen sittlich-leidenschaftlichen Gang“ geht, wobei er die besonders dramatischen Stellen heraushebt. Die Eigenart dieser Fassung kommt zu adäquater Wirkung. Michael Heitau ist ein aktiv frischer, sympathischer Hamlet, dem allerdings die Aura des Adeligen, die Ansätze zu Hintergründigem, die auch diese Gestalt besitzt, fehlen. Mädchenhaft innig, doch ohne poetischen Reiz, wirkt Kitty Speiser als Ophelia. Aladar Kunrad hat die lächelnde Heimtücke des Königs, Elisabeth. Epp das hoheitsvoll Mütterliche der
Königin. Friedrich Haupt glaubt man das aufrecht Vertrauenswürdige des Horatio, Eugen Stark bleibt als Laertes nur forsch, Egon Jordan gibt dem Corambis (spätere Fassung: Polonius) das servil Präpotente des Hofmanns. Wirkungssicher setzt Herbert Propst das Pathos des 1. Schauspielers ein, Walter Langer zeichnet scharf das Kauzige des Ersten Clowns (Erster Totengräber). Was die Erscheinung des Geists betrifft, zweifelt Hamlet, er will „sichren Grund“, daher darf der tote König nicht wie hier als volle Realität wirken. Hanns Krassnitzer deklamiert seine Worte vollends lautstark. Das ließe sich zurücknehmen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!