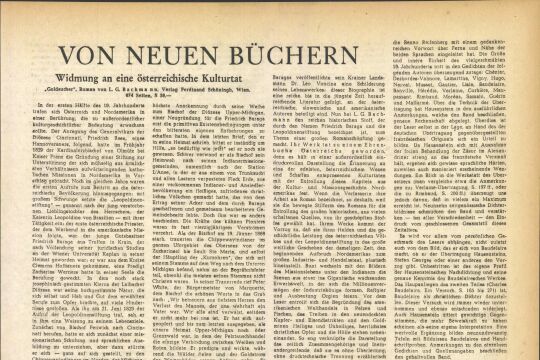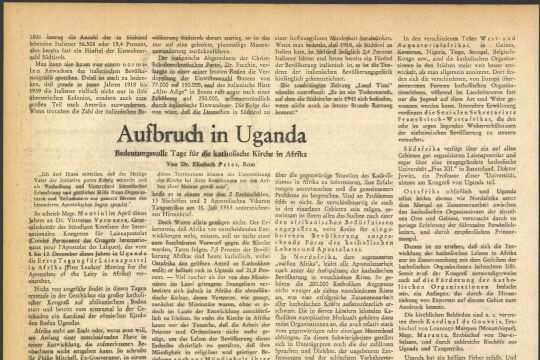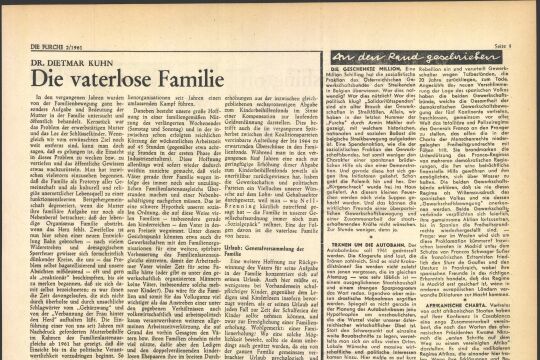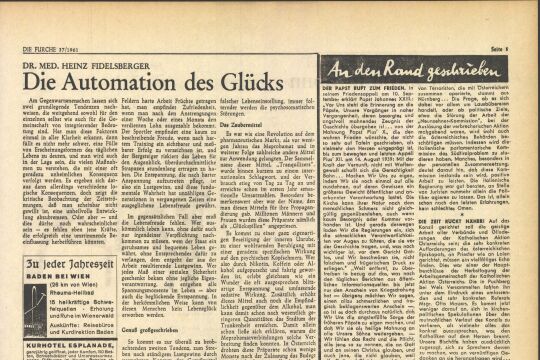Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Christen und Revolutionäre
Auf eindringliche Weise gedachten Jung-Katholi-ken in Linz des fünften Todestages von Erzbischof Oscar Romero, der am 24. März 1980 in der Kathedrale von San Salvador ermordet worden war.
Auf eindringliche Weise gedachten Jung-Katholi-ken in Linz des fünften Todestages von Erzbischof Oscar Romero, der am 24. März 1980 in der Kathedrale von San Salvador ermordet worden war.
Sie pilgerten am Wochende des 23./24. März nach Linz zu einer Tagung in die Bischöfliche Pädagogische Akademie, die von Helmut und Brigitte Ornauer umsichtig vorbereitet und durchgeführt worden ist. Organisatoren der Tagung waren die Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, die Katholische Aktion Österreichs sowie die österreichische Kommission Justitia et Pax.
Vorgestellt und diskutiert wurde einmal mehr die schwierige Situation in Mittelamerika im Sinn einer nicht nur materiell teilenden, sondern anteilnehmenden Hilfe für die Armen und Unterdrückten, eine Aufgabe, die nur mit einfühlendem Verstehen, mit kritischer Information und deren Verarbeitung geschehen kann — wie Weihbischof Florian Kuntner es in der Begrüßung von den Tagungsteilnehmern forderte.
Gerhard Drekonja, Gastprofessor für Entwicklungssoziologie an der Universität Wien, riß in seinem Einleitungsreferat auf ungewohnte Weise die Dramatik der mittelamerikanischen Situation auf. Mittelamerika, so Drekonja, addiert sich zu einer doppelten Tragödie, weil zu dem nach wie vor ungelösten Bodenbesitzproblem, das als Wurzel aller politischen Auseinandersetzungen in der Zone gelten kann, die Dominanz der Vereinigten Staaten komme.
Seit Anfang des Jahrhunderts gehört Mittelamerika — aus der Perspektive Washingtons — zu einer hochsensiblen Sicherheitszone, aus der vor allem die Europäer draußen zu halten sind. In der heutigen Situation heißt das: Die Sowjetunion (und Kuba) sind genau so unerwünscht wie westeuropäische Akteure, z. B. die Europäischen Gemeinschaften, die Sozialistische Internationale, die Internationale Demokratische Union, die Kirchen, die Gewerkschaften. Sie alle sind heute mit eigenen Entwicklungsprojekten in der Region präsent.
Dieser Realität müssen sich vor allem die schwachen mittelamerikanischen Staaten beugen, deren „limitierte Souveränität” zu allererst die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten berücksichtigen muß. Das gilt heute auch und vor allem für Nikaraguas Sandinistas, die dem Reagan-Washington als „totalitäre Marxisten” erscheinen, weil sie Müi-tärberater aus Kuba, der DDR und Bulgarien nach Managua beriefen.
Deshalb zeigte Washington in den vergangenen Dekaden eine so betonte Vorliebe für die mittelamerikanischen Diktatoren, weil diese zwar die Menschenrechte mit Füßen traten, aber ansonsten für „Stabilität” und „Ordnung” sorgten, verläßlich antikommunistisch auftraten und damit die Sicherheitsinteressen der USA garantierten.
Was kann man in solcher Situation tun? Eine Möglichkeit, auf die Georg Gaupp-Berghausen (siehe Kasten), verwies, sind die punktuellen Hilfsprojekte, getragen von christlicher Solidarität.
Im Moment vielleicht weniger lohnend, aber auf lange Sicht zweifellos ergiebiger mögen die Druck- und Uberredungsversu-che sein, die Europa im direkten
Gespräch mit Washington auf die offizielle Politik der Vereinigten Staaten nehmen könnte. Eine Praxis, der noch viel zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie sich in der Diskussion herausstellte.
Leo Gabriel, Direktor der unabhängigen APIA-Presseagentur in Managua, zeigte agitatorisch gleich eine Möglichkeit auf, nämlich auf den österreichischen Vertreter bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank — die dieser Tage in Wien ihr 26. Jahrestreffen abhielt — einzuwirken, um gegen den Blockierungsversuch von US-Außenminister George Shultz gegen ein nikaraguanisches Kreditansuchen für private Kleinbauern aufzutreten.
„Die glaubhafte Kirche ist eine der Armen und nicht eine für die Armen.”
Am zweiten Diskussionstag sprach Pater Reginald Kessler, Dominikanerspiritual aus der Schweiz, mitreißend über die Kirche im Spannungsfeld Zentralamerikas. Mit der Wortgewalt von ewig jungen Bibelzitaten forderte der Konferenz-Prediger eine Kirche Jesu, die nicht für die Armen da ist, mit Almosen, Spenden, Decken und Lebensmittelhilfe, sondern die die Kirche der Armen sein muß, will sie in der heutigen Situation glaubhaft bleiben.
Diese Botschaft verdichtete der Befreiungstheologe aus Managua, Padre Uriel Molina, zur Verpflichtung des Christen zugunsten der Revolution, und zwar nicht abstrakt als theologische
Plauderei, sondern als Engagement an der jeweiligen konkreten historischen Situation.
Was im Fall Nikaraguas heißt: Engagement zugunsten einer Revolution, die mit der Waffe in der Hand gekämpft hat und nun weiterkämpfen muß und dabei bereits 50.000 Tote hinterlassen hat. Deswegen eröffnete Padre Molina sein „Centro Ecumenico Valdivie-so” in Managua, das Christen, die sich der revolutionären Praxis — und somit auch dem bewaffneten Kampf — widmen, vom Glauben her begleiten will.
Und das heißt nach Padre Molina in der heutigen Situation des belagerten Sandinismus: Der Priester muß dem jungen nikaraguanischen Christen, der seine Wehrpflicht gegen die konterrevolutionären Eindringlinge im Norden des Landes ableistet, pastoral zur Seite stehen.
Ohne Zweifel, hier wächst ein neues Christentum heran. Es mußte in Linz nicht diskutiert werden, weil die anwesenden Jung-Katholiken es nicht in Zweifel stellen wollten.
So unterblieb — leider — auch wieder einmal die Diskussion, ob der Weg des bewaffneten Kampfes wirklich der Weg des neuen Christentums sein soll; ganz zu schweigen von den Positionen divergierender kirchlicher Gruppen, die gegen diesen Weg - in-und außerhalb Nikaraguas — opponieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!