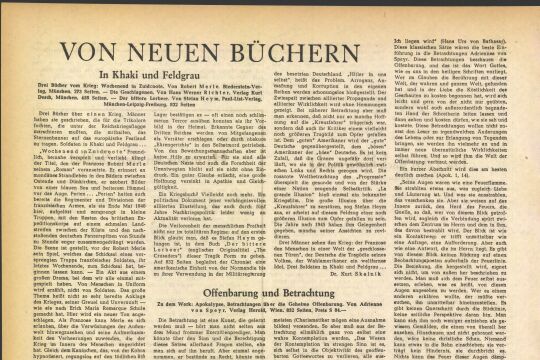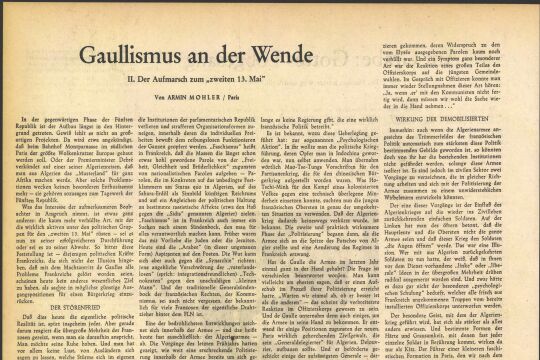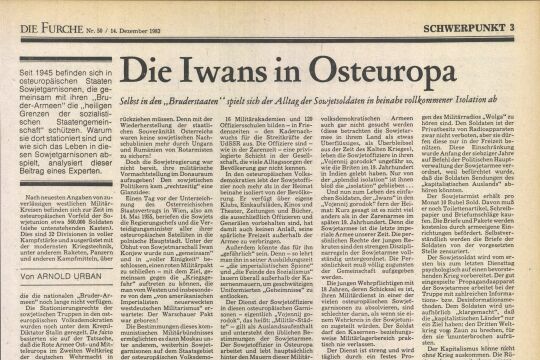Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Degradiert zu Fez und Schlapfen
Der Film „Camp der Verlorenen" wirkt wie eine bösartige Verleumdung der Kolonialmacht Frankreich. Doch derFilm des Senegalesischen Regisseurs Ousmane Sembene beruht auf einer wahren Begebenheit.
Der Film „Camp der Verlorenen" wirkt wie eine bösartige Verleumdung der Kolonialmacht Frankreich. Doch derFilm des Senegalesischen Regisseurs Ousmane Sembene beruht auf einer wahren Begebenheit.
Ort der Handlung: Senegal, Zeit: 1944. Die Soldaten einer afrikanischen Infanterieeinheit der französischen Armee werden bei der Entlassung und Heimkehr in ihre Dörfer von den französischen Offizieren um einen Teil ihres Soldes geprellt, lehnen sich auf, man verspricht ihnen den vollen Sold, umstellt in der folgenden Nacht ihr Lager und schießt die Unbotmäßigen zusammen.
„Camp der Verlorenen" („Camp de Thiaroye") läuft diesen Freitag im Österreichischen Fernsehen (30. August, FS 2,22.30 Uhr, Dauer zweieinhalb Stunden). Der Film wurde im Nobelghetto der „Kunststücke" gut versteckt. Einerseits paßt er dorthin. Es ist nicht nur ein spannender, sondern auch ein kunstvoll gemachter Film. So werden auch In der deutschen Fassung einige Dialoge Französisch gesprochen, was der Atmosphäre dient, ohne daß die Verständlichkeit der Handlung leidet.
Andererseits würde eine zeitgeschichtliche „Episode" dieser Art die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums und einen Platz im Hauptabendprogramm verdienen. Sollte jemand der Meinung sein, der in Frankreich grassierende Rassismus sei erst als Folge der Dckolonialisierung entstanden, als eine große Zahl von Algerien-Franzosen, die sogenannten pieds-noirs, „Schwarzfüße", ins Mutterland kamen, oder er sei gar eine Reaktion auf die Zuwanderung aus vielen afrikanischen Ländern in den letzten Jahren (nicht jeder kennt schließlich Sartres Arbeit über den traditionellen französischen Antisemitismus), dann wird ihn dieser Film eines Schlimmeren belehren.
Sembene zeichnet ein scharfes Porträt einer speziellen Art von Rassenvorurteil, nämlich des kolonialistischen. Es schlägt in einer Situation zu, in der es dafür nicht nur keine Entschuldigung (die gibt es nie), sondern außerdem nicht den Schatten einer soziologischen Erklärung (Massenzuwanderung, Unsicherheit, Angst um Arbeitsplätze...) gibt. Thema ist denn auch nicht rassistische Emotion, sondern eine Mischung von militärischem und Rassendünkel, deren Kontinuität vom deutschen Herero-Massaker über die Massenmorde der deutschen Besatzungsmacht in Polen und Rußland bis Vietnam (man denke an den von Amerikanern in My Lai begangenen Mord an Frauen und Kindern) reicht.
Die afrikanischen Infanteristen („Tirailleurs") haben Seite an Seite mit ihren französischen Kameraden in Europa gegen Hitlers Wehrmacht gekämpft. Ein Teil ist von den Deutschen gefangengenommen, in Konzentrationslager gesteckt, von den vorrückenden Franzosen wieder befreit worden. Im Camp warten sie nun auf den Rücktransport in ihre Dörfer in Gabun, Niger und an der Elfenbeinküste. Die Verpflegung ist mangelhaft, für die muslimischen Mitglieder unakzeptabel, aber sie erreichen Abhilfe.
Noch tragen sie ihre schönen, von den Amerikanern zur Verfügung gestellten Uniformen, noch haben sie das Selbstbewußtsein von Soldaten, die erfolgreich für eine gerechte Sache gekämpft haben, noch wissen sie sich gegen rassistische Übergriffe von Mitgliedern einer in der Nachbarschaft stationierten amerikanischen Einheit, die sich an einem Afrikaner vergreifen, zur Wehr zu setzen.
Aber mit den schönen Uniformen zieht man ihnen auch ihr Selbstbewußtsein aus. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen: Den von der Front heimgekehrten Afrikanern werden Fez, Shorts und Schlapfen des afrikanischen Dienstpersonals verpaßt. Auf diese Weise werden sie optisch degradiert. Sie sollen sich nur nicht einbilden, den Franzosen gleichgestellt zu sein. An der Front mögen sie es gewesen sein - im Senegal gelten wieder die alten Regeln.
In der beeindruckenden Bildsprache und Dramaturgie der afrikanischen Filme (dieser ist eine Senegalesisch-Tunesisch-Algerische Koproduktion) und mit einem kräftigen Schuß trockenen Humors läßt Sembene langsam erkennbar werden, daß der Rassismus der französischen Offiziere noch bösartiger ist als der kleiner amerikanischer GI's. Er äußert sich nicht in punktueller Aggression, sondern als Haltung. Den Schwarzen begegnet er als autoritär formalisierte Kommandostruktur, verbal deklariert wird er prinzipiell nur außerhalb ihrer Hörweite. Sembene ist ein hervorragender Beobachter.
Selbstverständlich werden die schwarzen Tirailleurs auch nicht von den französischen Offizieren einfach bestohlen. Jedenfalls nicht für deren eigene Tasche. Sie bekommen nominell den zugesicherten Sold, aber nachdem sie für Frankreich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, soll er nun in der französischen Kolonialwährung ihrer Bestimmungsländer zu einem überholten Umrechnungskurs, der für sie den Verlust eines Großteils ihrer Ersparnisse bedeutet, ausgezahlt werden. Auch die Enteignung ihrer gemeinsam aufbewahrten Barbestände ist kein Willkür-, sondern wird als ein mit dem Verdacht des Diebstahls motivierter Verwaltungsakt „gerechtfertigt". Abgesichert ist das alles durch die militärische Disziplin, denn noch sind sie Soldaten.
Einer von ihnen, psychisch schwer beschädigt in einem deutschen KZ, dreht durch und nimmt den General als Geisel. Der General gibt sein Offiziers-Ehrenwort, daß die Forderungen der Einheit erfüllt werden. Die Tirailleurs lassen ihn frei und feiern ihren Sieg - in der folgenden Nacht werden ihre Baracken in Grund und Boden geschossen. Diese Szene ist derfilmische Schwachpunkt, lieblos und antiquiert realisiert.
Der Schluß des Films hat's dann aber wieder in sich: Eine neue afrikanische Einheit geht hochgestimmt in Dakar an Bord, um in Europa gemeinsam mit den Franzosen zu kämpfen - welch bittere Pointe.
Die große Stärke von „Camp de Thiaroye": Regisseur Ousmane Sembene, dessen erster Film vor zwölf Jahren im Senegal verboten wurde, betreibt alles andere als Malerei in Schwarz und Weiß. Er verallgemeinert nicht, denunziert nicht Frankreich, sondern bekennt sich zu seiner eigenen Liebe zur französischen Kultur. In Ibrahim Sane hatte er einen hervorragenden Hauptdarsteller zur Verfügung - schon seinetwegen ist der Film sehenswert. Dem schwarzen Sergeant-Major Diatta, den Sane spielt, gab Ousmane Sembene (der in Frankreich mehrere Bücher schrieb) Züge von sich selbst: auch Unteroffizier Diatta hat in Frankreich studiert, hat Vercors' „Das Schweigen des Meeres" auf seinem Bücherbrett stehen und hört in seiner Baracke Klassik. Und der Mensch unter den Offizieren, Captain Raymond, verkörpert das humane Frankreich. Seine Begegnung mit Dianas Onkel, dessen Dorf die Franzosen ausradierten und dessen Eltern sie ermordeten und der ihn würdevoll abweist, ist ein kleines Kunstwerk für sich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!